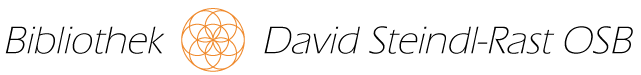Digitaler Benediktiner – «Bruder David KI-Bot» hilft bei spiritueller Sinnsuche (2025)
Radiosendung im Gespräch Benedikt Schulz mit Jörn Florian Fuchs im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag vom 3. Juli 2025
Mitschrift von Klaudia Menzi-Steinberger
Benedikt Schulz
Der österreichisch-amerikanische Benediktiner Mönch David Steindl-Rast ist weltbekannt als Brückenbauer zwischen den Religionen, vor allem als Ratgeber in spirituellen Sinnfragen. Seine Bücher erreichen hohe Auflagen, seine Vorträge über den Wert der Dankbarkeit werden millionenfach geklickt und er ist sogar einmal von der US-Talkmasterin Oprah Winfrey eingeladen worden. In wenigen Tagen wird er 99 Jahre alt und wenige Tage vor seinem Geburtstag wurde nun an der Universität in Salzburg etwas vorgestellt, was diesen spirituellen Ratgeber in gewisser Weise unsterblich macht. Der Bruder David KI Bot, also KI – künstliche Intelligenz – oder präziser gesagt, maschinelles Lernen, soll das Lebenswerk dieses Benediktiners auf besondere Art zugänglich machen. Und ja, der Bot spricht und klingt sogar genauso wie sein reales Vorbild. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs hat sich schon häufiger mit dem umfangreichen Werk von David Steindl-Rast beschäftigt. Deswegen war er auch bei der Vorstellung dieses Bruder David KI-Bots in Salzburg dabei. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können und ihn erst einmal gefragt, was genau macht und was genau kann dieser Bot eigentlich?
Jörn Florian Fuchs
Der Bot beantwortet Fragen, und zwar ganz viele Fragen. Man darf eigentlich alle Fragen stellen, die einem so auf der Seele im Wortsinne liegen. Der Hintergrund ist, dass ein Team das so programmiert hat. Es wurden etwa 800 Publikationen verwendet und es war auch ein bisschen eine Urheberrechtsfrage, was man verwenden darf von David Steindl-Rast. Diese sind verarbeitet in eine KI und die wiederum speist diesen Bot. Die Fragen können ganz einfach sein, wie z.B., was ist Glück oder ich habe eine schwere Zeit, wie geht es mir besser bis hin zu vertrackten theologischen Fragen. All das habe ich ausprobiert und auf all das gibt es relativ schnell Antworten, die sich natürlich, wenn man David Steindl-Rast ein bisschen kennt, aus seinem Lebenswerk speisen und die auch seine Stimme anbieten. Man kann einfach nur einen Text lesen oder man drückt dann das kleine Signal, um seine Stimme zu hören. Später soll sogar noch sein Bild dazu kommen. Da steht mal einfach nur ein Zitat aus seinen Werken, aber auch mal durchaus was Konkretes mit weiterführenden Hinweisen. Es geht wirklich z.B. darum, welches Gedicht, welcher Künstler kann einem in der schweren Zeit helfen und dann wird Rilke zitiert, gleich kommt das passende Gedicht dazu.
Benedikt Schulz
Das heißt, ich sollte ihn schon Dinge fragen, die grob, ich sag mal mit der Gedankenwelt von David Steindl-Rast zu tun haben oder könnte ich ihn jetzt auch ganz banal gefragt, einfach nach dem Wetter auch Vorhersagen fragen?
Jörn Florian Fuchs
Ich habe das natürlich ausprobiert, weil man ja neugierig ist! Man stellt auch Fragen, die ganz weit davon weggehen und es gibt auch Leute, die gar nicht wissen, wer ist denn David Steindl-Rast, die sich jetzt vielleicht nicht vorher einarbeiten, sondern einfach mitbekommen, es gibt diesen Bot und ich probiere das mal aus. Es ist relativ simpel. Da erhält man Antworten wie, das habe ich nicht in meinem System oder darauf habe ich keine Antwort oder auch, das ist außerhalb von dem, was ich beantworten möchte. Wichtig ist das, wenn es um politische Fragen bzw. um Politik und Religion geht, weil dies manchmal auch ein Überlappungsbereich ist, wo es sehr konkret zu einer Position, Stichwort, aber auch vielleicht um links oder rechts, oder so geht. Das ist etwas, was grundsätzlich nicht beantwortet wird. Steindl-Rast sagte selber, er möchte auch nicht seine politischen Überzeugungen im Bot haben. Da wird sehr viel Wert daraufgelegt und man findet das auch nicht darin. Es bleibt wirklich bei einer theologischen und eher dann würde ich sogar noch sagen, lebenspraktischen, lebensphilosophischen Herangehensweise bei dieser KI.
Benedikt Schulz
Wobei es ja auch eine gewisse philosophische Haltung verrät, wenn die KI sagt, das weiß ich nicht, denn die meisten KI's, die im Umlauf sind, z.B. ChatGPT, antworten in jedem Fall, oder?
Jörn Florian Fuchs
Ganz genau, das finde ich wirklich eine der positiven Dinge. Ich habe gerade diese App geöffnet, da geht es jetzt um das Gottesbild, einfach um die Frage, was ist Gott, wer ist Gott? Hier ist David Steindl-Rast ein bisschen zurückhaltend. Er sieht es als das «große Geheimnis», wie er das nennt. Das ist manchen Theologen dann ein bisschen zu schwammig, doch er bereichert diese Zurückhaltung etwa durch literarische Zitate und Quellen, die seine Deutung vertiefen. Es gibt hier auch so einen Dreischritt an Antworten. Man kann der Sache folgen, indem man jetzt sozusagen einen Impuls aufnimmt und dann geht es mit dieser KI weiter oder es gibt ein konkretes Zitat. Interessant ist das Thema Nachhaltigkeit, das Steindl-Rast sehr wichtig ist. Das kommt auf eine sehr charmante Weise in dieser KI vor. Wir hören jetzt den jungen Felix Hörbinger, der diese KI im Wesentlichen programmiert hat. Es geht darum, dass die KI auch versucht, Energie zu sparen.
«Wir arbeiten an der App auch daran, dass sie möglichst geringgehalten wird, indem wir aus unserer Datenbank möglichst genaue Texte raussuchen und dann ein eher kleines Sprachmodell nehmen, das weniger Computer-Rechenleistung braucht und dadurch auch weniger Strom verbraucht....»
Benedikt Schulz
David Steindl-Rast war selbst vor Ort, er hat sich sozusagen in gewisser Weise oder sein digitales Alter-Ego selbst befragt. War er zufrieden mit sich selbst sozusagen?
Jörn Florian Fuchs
Ja, man hat gemerkt, dass er, und das hat er auch gesagt, zunächst mit dieser Idee, dass es diesen Bot geben soll, schon gefremdelt hat. Man muss sagen, dass er ja jemand ist, der sich nicht so in den Vordergrund rückt. Das klingt jetzt ein bisschen Paradox, vielleicht auch bei der Anzahl von Publikationen und den ganzen Auftritten über diese vielen vielen Jahrzehnte, aber das Interessante ist eben, die Universität Salzburg will den Bot langfristig weiterentwickeln und hat sich da, wie man neudeutsch so schön sagt committed. Nicht nur, was die Technik betrifft, sondern auch ein bisschen natürlich darauf zu schauen, was jetzt das theologisch-philosophische betrifft. Eine Sache, die bei dieser Pressekonferenz auftauchte ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist ja klar, dass so eine Frage wahrscheinlich einige eingeben werden. Da kam als Antwort zwar nicht ganz konkret, wie das aussieht, aber dass es eben eine andere Dimension ist. David Steindl-Rast hat selber gesagt, bei der Antwort ist es ein bisschen schwierig, das ist ihm da zu konkret, das würde er in persönlichen Gesprächen nicht so sagen. Dies wurde gleichsam auf der Pressekonferenz mit hineingenommen, es ist auch ein Work in Progress. Ganz interessant war, dass er wiederum diese KI befragt hat, ja, eigentlich zur KI selber und zu dieser Situation. Das hören wir jetzt, David Steindl-Rast im Gespräch mit David Steindl-Rast:
Dass du mir diese Frage auf diese Weise stellen kannst, zeigt, dass ich als digitale Stimme wirken kann.
«Ich bin immer offen für Neues und bin fast erstaunt, dass ich in meinem hohen Alter auch noch einen Bot habe, aber ich freue mich darüber und hoffe, dass er viel Gutes tut.»
Jörn Florian Fuchs
Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, Steindl-Rast bräuchte das vielleicht auch nicht unbedingt. Er sah das sehr positiv, dass es eben weitergeht mit seinem Lebenswerk. Ihm geht es immer auch um dieses konkret seelsorgerliche, dieses extrem zugewandte. Und schon der Wille, zu versuchen, jemanden auch vielleicht auf neue Ideen zu bringen, auf neue Impulse, das muss man vielleicht noch mal sagen, das ist nicht ein theologisches dogmatisches Weltbild, was sich vermittelt, sondern das ist viel mehr. Steindl-Rast findet Bilder aus der Literatur, aus der bildenden Kunst etwa, die er einem dann mitgibt – Dankbarkeit ist das große Thema in vielen seiner Publikationen. Deswegen kann man in diesem Bot auch ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das hat er selber, Steindl-Rast, auch seit vielen Jahrzehnten geführt und führt es weiterhin. So ein Tagebuch kann man im Bot führen und auch abspeichern, so dass man sich selber ein bisschen in dieser KI findet und vielleicht dann nach zwei, drei Jahren einmal zurückblicken kann, welche Fragen man wo gestellt hat, in welcher Situation und wofür man eben dankbar war.
Benedikt Schulz
Ein KI Bot als digitales Alter Ego des Benediktiners David Steindl-Rast.
Digital Benedictine – «Brother David AI-Bot» helps with spiritual search for meaning (2025)
Radio program conversation between Benedikt Schulz and Jörn Florian Fuchs, aired on Deutschlandfunk in the show Tag für Tag on July 3, 2025
Transcript by Klaudia Menzi-Steinberger
Benedikt Schulz
Austrian-American Benedictine monk David Steindl-Rast is world-renowned as a bridge-builder between religions, especially as a guide in spiritual matters of meaning. His books are bestsellers, his lectures on the value of gratitude are viewed millions of times, and he was even once invited onto Oprah Winfrey’s talk show. In just a few days, he’ll turn 99 years old, and shortly before his birthday, something was presented at the University of Salzburg that, in a way, makes this spiritual advisor immortal: the Brother David AI Bot. That is, AI – artificial intelligence – or more precisely, machine learning, is being used to make this Benedictine’s life’s work accessible in a unique way. And yes, the bot even speaks and sounds like the real Brother David.
My colleague Jörn Florian Fuchs has long been engaged with Steindl-Rast’s extensive body of work, was present at the unveiling of the Brother David AI Bot in Salzburg. I had the chance to speak with him before the presentation and first asked: what exactly does this bot do, and what is it capable of?
Jörn Florian Fuchs
The bot answers questions – lots of them. You can ask pretty much anything that’s on your heart, literally. The background is that a team programmed it that way. They used around 800 of Steindl-Rast’s publications – with some copyright considerations about what could legally be included. These were processed into an AI model, which then powers the bot.
The questions can be simple, like: «What is happiness?» or «I’m going through a tough time – how can I feel better?» all the way to complex theological inquiries. I tried all of that, and the bot offers fairly quick answers, which, if you're familiar with Steindl-Rast, clearly draw from his life’s work – even using his actual voice. You can either read the responses as text or press a little button to hear his voice. Eventually, an image of him will also be added. Sometimes you get just a quote from his work, other times you’ll receive specific, actionable suggestions. For example, if you ask for artistic inspiration during a difficult period, the bot might quote Rilke and provide the corresponding poem.
Benedikt Schulz
So ideally should I ask questions that align with the worldview of David Steindl-Rast, or could I just, say, ask about tomorrow’s weather?
Jörn Florian Fuchs
Of course, I tried that – curiosity wins! People might ask random questions, especially if they don’t know who Brother David is. Some will just hear about the bot and want to try it out without any background.
If you ask something completely unrelated, you’ll usually get a reply like: «That’s not in my system,» or «I don’t have an answer for that,» or even, «That’s outside the scope of what I’m here to respond to.» This becomes especially relevant when it comes to politics or the intersection of politics and religion – areas that can be tricky. The bot avoids taking political stances, whether left or right. Steindl-Rast himself emphasized that he didn’t want his political views encoded into the bot. So it’s strictly theological and, I would say, focused on practical life philosophy.
Benedikt Schulz
Although, it already reveals a kind of philosophical stance when the AI says «I don’t know,» doesn’t it? Most AIs, like ChatGPT for example, usually give some kind of answer regardless.
Jörn Florian Fuchs
Exactly – and that’s actually something I appreciate. For instance, I opened the app recently and asked about the concept of God. Steindl-Rast is quite reserved there. He refers to God as «the great mystery,» which some theologians might find a bit vague. But he enriches that ambiguity with literary quotes and references that deepen his interpretation.
The bot gives answers in three steps: an initial impulse, a continuation of the thought process through the AI, and sometimes a direct quote. Sustainability is another key topic for Steindl-Rast, and the AI reflects that in a very charming way. Here’s Felix Hörbinger, the young developer behind the bot, explaining how the AI is designed to save energy:
«We're working on keeping the app as lightweight as possible by selecting precise texts from our database and using a smaller language model that requires less computing power – and therefore consumes less electricity...»
Benedikt Schulz
Brother David was present at the launch himself – in a way, he interviewed his own digital alter ego. Was he satisfied with himself, so to speak?
Jörn Florian Fuchs
Yes, you could sense it. He even said that he was initially a bit skeptical of the whole idea. He’s not someone who seeks the spotlight – which sounds paradoxical considering his many publications and public appearances over the decades.
The University of Salzburg has committed to the bot’s long-term development – not just technically, but also with respect to the theological and philosophical aspects. One interesting moment during the press conference was when the classic question came up: «Is there life after death?»
The bot didn’t give a precise description, but rather said it’s another dimension. Steindl-Rast commented that this answer was maybe too specific for his taste – he wouldn’t say it quite like that in a personal conversation. They made it clear this is still a work in progress.
What was particularly interesting was when he used the bot to ask about the bot itself. Let’s listen to David Steindl-Rast speaking with... David Steindl-Rast:
The fact that you can ask me this question in this way shows that I can continue to have an impact as a digital voice.
«I’m always open to new things – and I’m honestly surprised that, at my advanced age, I now have a bot. But I’m glad about it and I hope it does a lot of good.»
Jörn Florian Fuchs
I always had the sense that Brother David didn’t need this bot – not personally. But he sees the value in continuing his legacy. His concern has always been about pastoral care, deep empathy, and sparking new ideas in people.
This isn’t a rigid theological dogma that’s being conveyed – it’s much broader. Steindl-Rast draws imagery from literature, from the visual arts, and offers that to others. Gratitude is the major theme in many of his publications. That’s why the bot even includes a gratitude journal feature. Steindl-Rast has kept such a journal himself for decades and still does. The digital version allows users to record their own entries and even look back after a few years – to revisit what they asked, in what situations, and what they were grateful for at the time.
Benedikt Schulz
An AI bot as the digital alter ego of Benedictine monk David Steindl-Rast.
Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 3, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
Leben im Doppelbereich
von Ich und Selbst
Ich-Selbst und Ego
Verzögerte Bedürfnisbefriedigung
Begriffe wie ‹selbstlos› und ‹selbstvergessen›
Was bedeutet der Begriff ‹Seele›?
Zazen
Das Boddhisattva-Ideal
Tag 3: Donnerstagvormittag: 5. Impulsvortrag (Bruder David):
Bei diesem Seminar Lebensorientierung gehen wir jeden Tag von anderen Gesichtspunkten aus: Am ersten Tag waren die Ich-Du-Beziehungsachse und die Ich-Es-Beziehungsachse das Thema. Beide kommen aus dem Geheimnis und führen dahin. Am zweiten Tag haben wir uns mit dem Geheimnis beschäftigt. ES ist das, worum es letztlich im Leben geht. ES ist eine Wirklichkeit, ist etwas, das auf uns einwirkt. Die Wirklichkeit ist unbegreiflich, wir müssen uns ergreifen lassen. Im Augenblick der Ergriffenheit verstehen wir, verstehen wir das Unbegreifliche.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153) sagt:
«Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.»
Leben im Doppelbereich von Ich und Selbst
Zwei Begriffe, die eng zum Doppelbereich gehören, sind:
Innen und Außen.
Die Wissenschaft versucht immer von außen zu sehen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Leben beginnt, wenn es ein Innen und Außen gibt, und etwas durch die Haut dazwischen hinein und hinaus gehen kann.
Wir haben die Ausdrucksweise:
Ich gehe in mich.
Was geschieht da?
Ein Schulkind antwortete auf die Frage:
Wozu ist Denken gut?
Damit man Geheimnisse haben kann.
Wir haben in uns eine Innerlichkeit, zu der kein anderer Mensch Zugang hat.
Wir kennen Innerlichkeit. Wenn wir in uns gehen und uns beobachten, bis wir der Beobachter sind, den niemand mehr beobachten kann, dann sind wir bei unserem Selbst.
Über das Selbst können wir verschiedenes aussagen, z.B. dass es nicht in Raum und Zeit ist. Das Ich dagegen ist offensichtlich in Raum und Zeit. Das Selbst ist immer da. Wir gehören dem immateriellen und dem materiellen Bereich an.
Wenn das Selbst immateriell ist,
ist es unteilbar.
Es ist verbunden mit dem Ich, es ist nicht unabhängig vom Ich. Das Selbst ist immer im Jetzt. Selbst und Ich sind immer verbunden. Die Konsequenz daraus:
Wir alle haben nur e i n gemeinsames Selbst.
Das ist keine neue Einsicht. Spirituelle Menschen wissen das seit Jahrtausenden. Es ist verankert in dem Gebot:
‹Liebe deinen Nächsten als dich selbst›!
Dein Nächster ist dein Selbst, ist mit demselben Selbst verbunden wie du. Wenn du das eingesehen hast, kannst du ihn nur anschauen und wissen, das ist mein Selbst.
Wie ist dieses Selbst mit dem Ich verbunden? Das Selbst ist Einheit und hat Bestand. Das Ich dagegen ist Vielheit und dem Wandel unterworfen.
Rilke nennt das Selbst in der Elegie an Marina Zwetajewa-Efron:
«Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst.»
Das immaterielle Selbst ist Geist.
Wie Geist und Materie verbunden sind,
so sind Ich und Selbst verbunden.
Materie ist die Außenseite von dem, was innen Geist ist. Außen bin ich Materie, innen Geist.
Ich-Selbst wird im indischen a-dwaita genannt,
die Nicht-Zweiheit.
[Bruder David in seinem Buch Orientierung finden (2021): ‹Innen / Außen ‒ zwei Aspekte der einen Wirklichkeit›, 76f.; siehe auch Jetzt im Doppelbereich: Ergänzend: 3.1.:
Von biologischem Leben können wir erst sprechen, wenn es ‒ wie bei den einfachsten Einzellern, die wir kennen, ‒ ein Innen gibt, das, durch die Zellwand vom Außen getrennt, auf die Außenwelt reagiert. Auf unser menschliches Leben und Erleben angewandt, sind Innen und Außen bildliche Ausdrücke für zwei Aspekte der einen Wirklichkeit.
Der Unterschied ist uns aus täglicher Erfahrung vertraut: Im Außen kennen wir nur Vielfalt. Innen aber können wir jene Einheit erfahren, welche die Vielfalt zusammenfasst, enthält und übersteigt.
So übersteigt unsre innerste Du-Erfahrung Einheit, aber auch Zweiheit.
Darum spricht der Hinduismus hier nicht von Einheit, sondern von Nicht-Zweiheit ‒ a-dwaita. Was mir als Außen bewusstwird, ist an Raum und Zeit gebunden und beständigem Wandel unterworfen. Als Innen kann ich etwas erleben, was unteilbar und immer jetzt ist. Rilke spricht von der ‹Mitte des Immer› und drückt mit diesem Bild ein innerstes Bleibendes aus.]
Wie hängen Ich und Selbst zusammen?
Das Selbst: grenzenlos, unteilbar, eins,
ist so unerschöpflich,
dass es sich immer wieder ausdrücken möchte in jedem Ich.
Ein spielerisches Bild dazu: Ein Puppenspieler spielt mit seinen Händen verschiedene Rollen. Er weiß, dass es nur ein Spiel ist. Doch es ist Spiel und Ernst zugleich.
Unsere Rolle ist, sich selbst bewusst zu spielen:
In diesem Doppelbereich Ich-Selbst zu leben,
ist das Entscheidende.
Die Persona ist nur die Maske, durch die das Selbst durchtönt. Das Wort ‹persönlich› kommt vom Lateinischen ‹per-sonare›: durchtönen.
Das Ich S. H. des Dalai Lama ist sehr betont, und trotzdem scheint das Selbst sehr durch. Da kann man fühlen: das bin ja ich!
Das ist das selbst-bewusste Leben, das Ich-Selbst.
Ich-Selbst und Ego
Und jetzt wissen wir auch, was das Ego eigentlich ist.
Das Ego ist das Ich in dem Augenblick,
in dem das Ich das Selbst vergisst.
Es ist das vereinzelte Ich, bzw. das Ich, das sich vereinzelt meint und sich mit der Rolle identifiziert. Wenn eine Schauspielerin plötzlich glaubt, sie sei die Minna von Barnhelm, ist sie verrückt geworden. Und wir sind die meiste Zeit verrückt, weil wir uns mit unserer Rolle identifizieren.
Wenn ich mein Selbst vergesse,
schrumpft mein Ich zusammen und fürchtet sich.Das Erste, was der Furcht entspringt, ist Gewalttätigkeit.
Das Zweite ist Konkurrenz,
das Vorankommen um jeden Preis.
Und das Dritte ist die Gier aus Angst,
dass nicht genug für mich da ist.
Diese drei Haltungen charakterisieren das Ego: Gewalttätigkeit, Konkurrenzkampf und Gier.
Wenn Furcht auftaucht, ist das für mich ein Hinweis, dass ich die Verbindung zum Selbst verloren habe und ins Ego gerutscht bin, denn das Selbst hat keine Furcht.
Unsere ganze Gesellschaft ist ins Ego gerutscht,
ist zu einer Egogesellschaft geworden.
Wenn das Ich die Furcht, das sich Sträuben gegen das Leben, aufgibt, wird es gewaltfrei. Das ist unsere einzige Freiheit.
Das Gegenteil von Gewalttätigkeit, Konkurrenzkampf und Habsucht
ist Gewaltfreiheit, Zusammenarbeit und Teilen,
was oft noch in armen Kulturen gelebt wird.
Unsere Ausrichtung ist der Einsatz für eine Welt, die nicht durchs Ego, sondern durchs Ich-Selbst geprägt wird. Wir gehen darauf zu, indem wir uns ans Selbst erinnern und Netze von Netzwerken bilden.
Bruder David zu Fragen im anschließenden Gespräch:
Vanja stellt die Frage: Dies ist ein Wissen seit Jahrtausenden. Warum sind wir in diesen Mustern, in dieser Welt gefangen? Was bremst uns da? Warum fallen wir immer wieder in die Falle des Ego?
Die persönliche Freiheit und Unabhängigkeit, die wir heute genießen, ist eine große Errungenschaft, aber wir haben sie zu weit getrieben – so weit, dass wir uns in Entfremdung und Vereinzelung verlieren. Das fordert, dass wir alles, was wertvoll ist an unserer Unabhängigkeit, schätzen und bewahren, jetzt aber lernen, persönliche Freiheit mit dem Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit zu verbinden.
Stichwort: Verzögerte Bedürfnisbefriedigung (deferred gratification):
Etwas vom Wichtigsten, das Eltern den Kindern beibringen können, ganz im Gegensatz zum heutigen Trend: Warten lernen, nicht alles gleich haben wollen. Unsere Ungeduld tut dem Leben Gewalt an, und die Gewaltfreiheit ist letztlich, sich aufs Leben zu verlassen. Auch hinsichtlich der Zeit, die es braucht.
Begriffe wie selbstlos und selbstvergessen:
Manchmal treffen wir ‒ wie bei Furcht und Angst ‒ auf Ausdrücke, die sehr verwirrend sind. Da hilft uns die Sprache nicht, da muss man vorsichtig sein. Statt Selbstlosigkeit müsste man richtigerweise ‹Egolosigkeit› sagen, die Selbstlosigkeit ist genau, was dem rechten Selbstbewusstsein entspringt.
‹Bruder David, meinst du mit Selbst dasselbe wie der Ausdruck Seele?›
Der Begriff Seele hat in der westlichen Tradition eine ganz klare Definition.
Seele ist, was mich zu mich selbst macht, was diesen Leib zu diesem Leib macht. Und nicht nur zum Leib, sondern:
Was diesen Menschen zu diesem einzigartigen Menschen macht.
Der Begriff Seele entspringt der Verwunderung: Wie können wir so viele verschiedene Ichs sein, obwohl wir alle e i n Selbst sind?
Es gibt so viele Missverständnisse. In mittelalterlichen Bildern sieht man die Seele als kleines Püppchen, das herauskommet, wenn man stirbt. Die Seele als ein Homunculus, ein kleines Menschlein, das da drinnen sitzt, manchmal nicht rein ist und gewaschen werden muss.
Jede Vergegenständlichung der Seele tut dem Begriff Seele Gewalt an.
Seele heißt einfach: Ich-Selbst. Mein wahres Wesen: Was mich zu mich macht, anders als die andern. Das kann nicht das Selbst sein ‒ das Selbst kann sich nicht teilen ‒, das kann nur das Materielle sein. Das Materielle macht den Unterschied aus. Das Immaterielle haben wir gemeinsam. Wir sind materiell sehr voneinander verschieden, ganz einzigartig.
So wie die Verschiedenheit nicht herumhüpft, ist die Seele nicht ‹etwas›, sondern ein abstrakter Begriff dafür, dass wir alle so ganz einzigartig und verschieden sind.
Thomas von Aquin (1225-1274) sagt: «Anima forma corporis est»:
‹Forma corporis› heißt:
Was diesen Leib zu diesem Leib macht,
und nicht nur zum Leib,
sondern was diesen Menschen
zu diesem einzigartigen Menschen macht.
‹Forma› als ‹Form› zu übersetzen ist falsch. Der Ausdruck ‹Forma› bedeutet soviel wie ‹causa formalis› in der Vierursachenlehre des Aristoteles (384-322 v. Chr.):
1. Causa materialis (Materialursache): Woraus ist es gemacht? Verweis auf das Material (hýle)
2. Causa formalis (Formursache): Was macht es zu dem, was es ist? Verweis auf die Wesensform (idéa, eídos: Gestalt, Urbild)
3. Causa efficiens (Wirkursache): Durch was ist es bewirkt? Verweis auf den Ursprung der Entstehung (arché tes kinéseos)
4. Causa finalis (Zweck-, Zielursache): Wozu dient es? Verweis auf die Ausrichtung, den Zweck, das Ziel (télos)
Seele ist der Begriff dafür, wie sich das Selbst durch mich ausdrückt,
dieses Einzigartige.
Eine Teilnehmerin: Für mich ist Seele der göttliche Funke, der jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze erfüllt, durchdringt und umgibt und mit diesem Lebewesen zusammen sich ausformt und zum Blühen kommt.
Bruder David: Dieser Funke heißt in der klassischen Philosophie: ‹logos spermatikos›. ‹Logos› ist das allumfassende WORT, durch das das Ur-Du mein Ur-Ich anspricht. Darum gibt es alles, und alles, was ES gibt, alle diese Dinge als WORT haben ein Fünklein in sich, oder mit einem anderen Bild: ‹sperma›, ein kleiner Same: das Fünklein, das zu einem Brand werden kann, oder der Same, der aufblühen und Frucht bringen kann. Und wenn dieses Fünklein aufleuchtet, dann bin ich wirklich Ich s e l b s t . Dann ist diese Blume oder dieser Stein oder was immer es ist, wirklich es selbst. Und in dem Augenblick scheint die Seele auf: das, was es wirklich in seinem Wesen ist.
Es ist viel wichtiger,
dass wir die Dinge so ausdrücken,
wie wir sie erleben,
als wenn wir genau die traditionelle Terminologie verwenden.
Donnerstagnachmittag: 6. Impulsvortrag (Vanja):
Zazen heißt soviel wie ‹in sich gehen und beobachten›. Es ist eine Haltung, die Haltung, achtsam zu sein gegenüber dem, was in uns vor sich geht. Es ist eine Art passiver Haltung. Die Qualität von Wohlwollen ist dabei, eine großmütterliche Haltung uns selbst gegenüber. Eine Großmutter sieht die Anlagen und fördert sie. Ich halte innerlich Ausschau nach Gesichtspunkten, die mich beruhigen und aufbauen. Freude ist so ein magnetischer Nordpol für meine Orientierung. Ich bin achtsam auf das, was mich positiv beeinflusst. Das ist oft nicht so leicht für Weltverbesserer. Als solcher gerät man leicht in eine negative Spirale, sieht und kritisiert das Schlimme.
Bruder David hat einmal gesagt, es geht darum, das Gute in jeder Situation zu unterstützen. 90% sollte unterstützend und positiv sein. Wir können das potenziell Gute in jeder Situation herausspüren. Hier im Felsentor feiern wir das gute vegane Essen und nebenbei kann die Botschaft vermittelt werden, dass das vegane Essen nicht nur das Beste für unsere eigene Gesundheit ist, sondern auch für die Ökologie der ganzen Welt. Auf diese Weise kann man ein Anliegen andern besser nahebringen.
Was mich auch inspiriert und berührt, ist das Ideal der Bodhisattvas, wie Buddhisten sie nennen.
[Bruder David in seinem Buch Credo: Ein Glaube, der alle verbindet (2015), 106:
Tiefes Mitgefühl lässt jene, die Befreiung von Selbstentfremdung erlangt haben, das Leid all derer teilen, die sich noch um Befreiung mühen. Diese ‹Bodhisattvas› ‒ wie Buddhisten sie nennen ‒ erreichen die Schwelle höchster Seligkeit, kehren aber um, weil sie an der Befreiung (Erlösung) mithelfen wollen, bis auch die Verstricktesten endlich befreit sind.
Wie tief sie auch aus Mitgefühl ins Leiden hinabsteigen,
sie strahlen doch immer die Freude aus, die sie schon verkostet haben.
Die Archetypen von Christus und Bodhisattva treffen da zusammen.]
Wir selbst können uns als Bodhisattvas sehen: Ich bin in dieser Welt, weil ich der Welt dienen möchte.
Wenn ich in Schwierigkeiten komme, hilft mir der Bericht einer italienischen Biologin, was im Bewusstsein einer Raupe vorgehen mag, wenn sie sich einspinnt. Erst passiert die totale Katastrophe, sie zersetzt sich und löst sich auf in Zellen. Doch dann kommt es zu einer neuen Findung von Zellen, die zum Schmetterling führt.
Gibt es vielleicht in einer Situation,
die wir als Katastrophe empfinden
und die sich immer weiter zuspitzt,
einen guten Ausgang, eine Verwandlung?
Mitgefühl und Weisheit sind die beiden Pfeiler, die sich gegenseitig ausbalancieren. Weisheit ist der Geist, der bereit ist für Neues, offen und frisch. Er hat nichts zu tun mit Fakten und Konzepten. Er ist älter als die Konditionierungen. Er hängt nicht an fixen Vorstellungen. Weisheit ist ein mutiger Geist, der die Fähigkeit hat, sich von der vertrauten Landschaft der mentalen Geschäftigkeit zu lösen. Er kann verweilen in der stillen Realität der Dinge und ihren Eigenwert sehen. Jedes Ding hat seinen Selbstwert, seinen Eigenwert.
Dem Gong zuzuhören ist auch eine Form von Zazen. Auch hier wenden wir die Achtsamkeit nach innen. Musik, der Gong kann ein Dharmator sein, eine Eintrittspforte ins Bewusstsein des Selbst.
Die Klänge des Gongs, den Vanja spielt, vibrieren in uns und durch uns.
Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 4, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
In die Antwort hineinwachsen
Willensfreiheit
Verzögerte Bedürfnisbefriedigung
Blitzentscheidungen
Das Jetzt ‒ im Schnittpunkt
von Zeit und Ewigkeit
Ent-scheidung:
Die Weisheit des Selbst
gewaltfrei durch uns fließen lassen
Entwicklung auf zwei Ebenen
Sterben und Tod
Weiterführende Fragen
Unsere Berufung
Drei Innenwelten des Gebets
Tag 4: Freitagvormittag: 7. Impulsvortrag (Bruder David):
In die Antwort hineinwachsen
Was ich versuche zu geben sind nicht Antworten auf Fragen, sondern sind nur Anregungen zu klarerer Fragestellung, das ist schon wichtig. Und die Antworten werden ja immer nur durch die Erfahrung gefunden.
Wir stellen die Fragen klar,
und wie Rilke sagt:
leben die Fragen in die Antworten hinein:
Wir l e b e n die Fragen: Wir machen sie zu einer Lebensfrage. Und wachsen so in die Antworten hinein. Die Antworten sind meist wieder nicht, was man so klar ausdrücken könnte, sondern sie sind bereichert mit unserem Leben.
[Rilke in seinem Brief 1903 an Franz Xaver Kappus in ‹Briefe an einen jungen Dichter›:
«Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben.
Leben Sie jetzt die Fragen.
Vielleicht leben Sie dann allmählich,
ohne es zu merken,
eines fernen Tages in die Antwort hinein.»]
Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir uns immer dieses Doppelbereiches bewusst sind.
Am Dienstagmorgen, Tag 1 haben wir Orientierungsachsen festgelegt, und da gleich gefunden, dass diese Achsen immer einerseits vom Raum-Zeitlichen kommen und dann doch immer in das Geheimnis führen.
Wir sind hineingestellt in diesen Doppelbereich, in das Raum-Zeitliche und das Überzeitliche, in das Materielle und das Geistige.
Am Mittwochmorgen, Tag 2, haben wir versucht, mehr über dieses Geheimnis auszusagen, unser Verhältnis zu diesem Geheimnis, das Unbegreifliche, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen im Leben. Und dass wir verstehen können, ohne es begreifen zu können.
«Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.»
(Bernhard von Clairvaux)
Gestern, am Donnerstagmorgen, Tag 3, haben wir wieder überlegt: Wer bin ich? Was meine ich, wenn ich Ich sage, nicht nur in meiner Beziehung zum Du? Es ist ein Unterschied, ob ich Ich-Selbst sage oder nur Ich. Das Ich kann zusammenschrumpfen zum Ego. Der entscheidende Unterschied ist Vertrauen, was im religiösen Vokabular Glaube heißt, oder Furcht. Das ist die große Entscheidung. Und durch mutiges Vertrauen werde ich Ich s e l b s t .
Willensfreiheit
Aber wie Vanja immer betont: In unseren Versuchen uns zu orientieren, geht es ja letztlich um die Frage: Was soll ich jetzt tun? Welche Handlungsweise, welche Haltung beim Handeln entspringt dieser Orientierung?
Und da sind wir gestern Nachmittag auf die Frage gestoßen:
Wie frei bin ich denn überhaupt im Handeln?
Und das ist heute so unser Ansatzpunkt: Wie frei bin ich?
Dazu gehört das Stichwort ‹Willensfreiheit› und ein anderes Stichwort, das ich vorziehe: ‹freie Entscheidung›, also die Begriffe ‹Wille› und ‹Freiheit›.
Was will der Wille im Zusammenhang von
Denken ‒ Fühlen / Empfinden ‒ Wollen?
Der Begriff ‹Wille› kommt daher, dass wir uns über unsere Handlungsweisen und unsere innere Beziehung zur Umwelt und Mitwelt irgendwie klar werden wollten, und da haben wir einerseits den Intellekt, die Einsicht, Verstehen, Begreifen, also intellektuelle Auseinandersetzung mit der Umwelt und Mitwelt: das Denken.
Dann haben wir das Fühlen. Das ist anders als das Denken. Das Denken analysiert, zerlegt, setzt zusammen, arbeitet mit Begriffen, das Gefühl schwingt mit: Im Gefühl ist viel mehr Körperlichkeit als im Denken, auch unsere Sinne schwingen mit.
Und die dritte Art, uns auf unsere Um- und Mitwelt einzustellen ist das Wollen und das ist ein ‹nach etwas streben›, ‹etwas anstreben›. Das ist etwas, was sich schon im allerersten Beginn des Lebens äußerlich beobachten lässt: Die einfachsten Formen des Lebens, die einfachsten Einzeller streben nach etwas und fliehen vor etwas. Sie wissen genau ‒ da muss auch das ‹Wissen› irgendwie drin sein ‒
So sehr wir uns von diesen einfachsten Lebewesen unterscheiden, es gibt trotzdem einen Zusammenhang: Unser Wissen ist eine Weiterentwicklung von dem, was schon Einzeller auszeichnet und die einzelnen Zellen in unserem Körper: Sie wissen, was sie wollen, was ihnen guttut, und sie wissen irgendwie, wovor sie flüchten sollen ‒ diese Polarität ist schon drinnen ‒, und sie wollen auch etwas: Sie wollen, was ihnen guttut. Und dass sie etwas fühlen, das kann man annehmen, aber nicht beobachten.
Und in diesem Sinne, auf dieser Ebene und in diesem Verständnis
ist der Wille eigentlich nie frei.
Denn wir können nicht etwas wollen, was unser Verstand nicht als gut zeigt. Das ist sehr fest verankert in der westlichen Philosophie: Wille und Intellekt gehören engstens zusammen, und was das Denken uns als erstrebenswert zeigt, das erstrebt der Wille und kann nichts anderes wollen. Der Wille will immer das Gute im Sinn: was mir guttut oder was für mich gut ist.
Mephistopheles in Goethes Faust:
«Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will
und stets das Gute schafft.»
Man kann das Böse, was uns zerstörerisch und böse erscheint, wollen, aber nur unter dem Gesichtspunkt, dass es für mich gut ist. Das Böse wird dann von außen gesehen. Von innen gesehen kann niemand das Böse wollen. Das ist ein Widerspruch. Das kann man nicht wollen. Wir wollen immer das Gute, immer das, was uns gut erscheint.
Und man kann sich vorstellen, dass jemand sich zu etwas entschließt, was offensichtlich auch für einen Massenmörder schlecht und zerstörerisch vorkommen muss: Ich werde jetzt halt da hineingehen und diese Kinder im Klassenzimmer erschießen mit einem Maschinengewehr ‒ das kommt ja vor: Ein solcher Täter kann auch das nur wollen, weil es ihm gut erscheint, etwa: Dadurch zeige ich jetzt, wer ich bin.
Also auf dieser Ebene ist der Wille nie frei, weil er immer das tut, was das Denken ihm als wünschenswert vorstellt: Das kann ein ganz verdrehtes und ganz versponnenes Denken sein.
Weil der Wille in dieser Hinsicht nicht frei ist, sondern immer tun muss, was uns gut erscheint, spreche ich nicht gerne von Willensfreiheit, sondern lieber von freier Entscheidung.
Frage zum verzweifelten Ausruf des hl. Paulus in Röm 7,19.
Der Vers wird meist so übersetzt:
«Denn ich tue nicht das Gute, das ich will,
sondern das Böse, das ich nicht will.»
Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt:
«Denn das Gute, das ich will, verwirkliche ich nicht.
Aber das Schlechte, das ich nicht will, das vollbringe ich.»
Da kommt wieder herein, was wir gestern angesprochen haben mit dem Schlüsselwort Verzögerte Bedürfnisbefriedigung:
Wir wollen etwas, das verzögerte Befriedigung verlangt, aber wir wollen lieber eine sofortige Befriedigung.
Der Intellekt ist vielschichtig: Er stellt mir etwas dar, das sehr naheliegend ist und sagt mir unter Umständen, wenn er gebildet ist, dass es darüber hinaus ein größeres Gut gibt.
Das Pauluswort vielleicht besser übersetzt:
«Das, was ich möchte, tue ich nicht»,
können wir so verstehen: Ich will die nächstbeste Befriedigung, obwohl ich eigentlich etwas Besseres möchte. Ich weiß z.B., dass für mich am besten ist, was für alle gut ist. Aber naheliegend ist, was vielen Menschen schadet, aber für mich jetzt sehr günstig ist. Wir sind die, die recht genau wissen, was wir eigentlich möchten, und doch das naheliegende wollen anstatt das wirklich Befriedigende.
[Ergänzend dazu, was Bruder David in seinem Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021) im Kapitel: ‹Berufung ‒ Folge deinem Stern›, 96f., schreibt:
Was nun die psychische Unrast betrifft, die es uns heute so schwer macht, uns auf Dauer zu etwas zu verpflichten, so ist sie kaum zu übersehen. Die Medien müssen sich auf Schnellfeuerberichterstattung umstellen, um mit unsrer Begierde nach immer neuer Aufreizung Schritt zu halten. Kaum jemand liest noch Texte, die lang genug sind, einem Thema gerecht zu werden. Der Inhalt muss wegen unsrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die immer kürzer wird, auf ‹Soundbites› reduziert werden. Wer eine Nachricht sendet, will eine sofortige Antwort.
Alles, was Zeit braucht,
macht uns ungeduldig.
Wir haben verlernt, die Vorfreude auszukosten,
die uns geschenkt wird,
wenn wir auf etwas warten müssen ‒
die Fähigkeit zu Impulskontrolle
und Belohnungsaufschub,
wie Psychologen sie nennen. Ihr Fehlen ist ein ernster Persönlichkeitsmangel und weist auch auf ein gestörtes Verhältnis zur Zeit hin: auf eine dauernde Angst, Zeit zu verlieren, mehr Zeit zu brauchen, keine Zeit zu haben. Wir fühlen, dass die Zeit verrinnt und wir mit ihr.]
Blitzentscheidungen
Ein günstiger Ansatzpunkt zum Thema ‹frei entscheiden›, sind Erinnerungen an Augenblicke, meist sehr dramatische Augenblicke, in denen wir etwas tun, ohne darüber nachdenken zu können, ob wir es wollen oder nicht.
Ein Schnellzug fährt heran und das Kind steht auf den Schienen und die Mutter reißt es weg. Es scheint fast unmöglich so etwas zu leisten, aber sie leistet es, ohne überhaupt daran zu denken.
Oder ein Feuerwehrmann geht in ein Haus hinein und setzt sich der größten Gefahr aus, rettet diesen erstickenden Hund oder dieses erstickende Kind, und nachher fragt man die Mutter oder den Feuerwehrmann: ‹Wie haben Sie sich das zugetraut, den Mut dazu gehabt›? Und die sagen immer:
‹Das habe ich schon getan,
bevor ich überhaupt Zeit hatte,
darüber nachzudenken.›
Und wir kennen ‒ vielleicht weniger dramatisch ‒, Augenblicke, in den wir die rechte Entscheidung treffen, ohne Zeit zu haben, darüber nachzudenken.
Und manchmal sogar, wenn wir uns mühen müssen und lange Zeit brauchen, um eine Entscheidung zu treffen: Das kommt bei mir öfters vor, dass ich einen Strich über ein Blatt mache und links alles hinschreibe, was dagegenspricht, und rechts, was dafürspricht, das dauert lang, wochenlang, aber die Entscheidung kommt dann plötzlich im Schlaf sozusagen. Wenn man gar nicht darüber nachdenkt: Man weiß es plötzlich.
Das Jetzt ‒ im Schnittpunkt von Zeit und Ewigkeit
Im Nachhinein, beim Erzählen eines solchen Erlebnisses, weisen wir immer auf einen Punkt hin: Keine Zeit:
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken!
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Sprache uns da auch wieder nahelegt: Genau verstanden heißt das eigentlich: Ich war nicht in der Zeit befangen, sondern ich war völlig im Jetzt. Und wenn wir völlig im Jetzt sind, dann entscheiden wir frei.
Blitzentscheidungen treffen wir immer im Jetzt.
Und da möchte ich Impulse geben, damit wir klarer sehen, was wir mit dem Jetzt meinen und was wir mit Entscheidung meinen.
Ich habe das schon so oft gemacht, dass manche von euch das sicher schon von mir gehört haben, weil es immer wichtig ist, das zu machen:
Wir stellen uns spontan meistens die Zeit so als eine lange Linie vor in der die Zeit verfließt ‒ so ein Strom ‒, die lange, lange Strecke der Vergangenheit und die unbestimmte Strecke der Zukunft und dazwischen dieser kleine Augenblick, diese kleine Strecke der Zeit, die wir ‹Jetzt› nennen.
Und jetzt können wir ohne große Schwierigkeit ein Gedankenexperiment machen, indem uns klar wird, dass das Jetzt n i c h t eine Strecke der Zeit ist, ganz gleich wie kurz. Denn nehmen wir mal diese kurze Strecke der Zeit und unterteilen wir sie, dann ist der eine Teil nicht mehr, weil er schon vergangen ist, und der andere Teil ist auch nicht, weil er noch nicht ist. Da bleibt diese kleine noch dünnere, noch kürzere Strecke, die ist. Aber solange es eine Strecke ist, solange können wir sie noch teilen, und die eine Hälfte ist nicht, weil sie nicht mehr ist, und die andere Hälfte ist nicht, weil sie noch nicht ist. Und das kann man dann ad Infinitum fortsetzen. Und das zeigt uns schon, einfach intellektuell, dass das Jetzt, das wir meinen, nicht in der Zeit ist.
Aber wir wissen, was Jetzt heißt. Und jetzt können wir darüber nachdenken, dass irgendein Punkt in der Vergangenheit, an den wir uns erinnern, immer jetzt ist. Wir können uns an viele vergangene Punkte erinnern, wir wissen, sie sind vergangen, aber im Augenblick, in dem wir uns erinnern, sind sie jetzt, und das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn wir uns die Zukunft vorstellen, können wir sie immer nur als Jetzt vorstellen. Und dieser Augenblick, dieser gegenwärtige Augenblick ist auch Jetzt.
Und wenn es i s t ,
nicht war oder sein wird,
sondern i s t ,
ist es immer Jetzt.
T. S. Eliot in einem seiner großen Dichtungen: ‹Four Quartets: Burnt Norton, V›:
«All is always now.» ‒
«Alles ist immer jetzt.»
Das klingt so wie eine Binsenweisheit, aber es ist eine ganz tiefe Einsicht.
Wenn es nicht Jetzt ist, ist es nicht. Da können wir also dann mit Berechtigung sagen:
Das Jetzt ist nicht in der Zeit,
sondern die Zeit ist im Jetzt.
Das muss man sich wirklich einprägen.
Das Jetzt ist der Gegensatz zur Zeit.
Zeit und Jetzt: Wir sagen gewöhnlich Zeit und Ewigkeit. Aber das ist das gleiche. Ewigkeit, richtig verstanden, ist nicht eine lange, lange Zeit. Und dieser Ausdruck ‹von Ewigkeit zu Ewigkeit› ist ungeschickt.
Bruder David erzählt, wie man ihm im Religionsunterricht Ewigkeit erklärte mit der Geschichte eines Vogels, der alle tausend Jahre auf der Spitze des größten diamantenen Berges der Welt sich den Schnabel wetzt. Wenn das Kratzen des Vogels den ganzen Berg abgetragen hat, wird eine Sekunde der Ewigkeit vorbei sein.
Augustinus (354-430) definiert Ewigkeit zutreffend als «nunc stans», «das Jetzt, das bleibt, das besteht.»
Und die Zeit ist in dieser Ewigkeit aufgehoben.
[Das Wort ‹aufheben› im dreifachen Sinn von G. W. F. Hegel ist ein Schlüsselbegriff im späteren Abschnitt ‹Sterben und Tod›.]
Ent-Scheidung:
die Weisheit des Selbst gewaltfrei
durch uns fließen lassen
[An dieser Stelle sei ausdrücklich hingewiesen auf die Seiten 86-88 im Kapitel ‹Entscheidung ‒ Was will das Leben jetzt von mir?› im Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021).]
Was bedeutet das Wort ‹Entscheidung›?
Es bedeutet die Überwindung der Scheidung
zwischen dem Ich,
das in Zeit und Raum handelt
und dem Selbst, das über Zeit und Raum erhaben ist.
Also die Entscheidung, die ich treffe ‒ wieder auch schön ausgedrückt, ‹ich treffe sie, wie ein Pfeil trifft› ‒, diese Entscheidung treffe ich, wenn ich im Jetzt bin. Und das ist immer die rechte Entscheidung.
Denn wenn ich im Jetzt lebe,
fließt die Freiheit des Selbst
ganz frei ‒ gewaltfrei ‒
durch das Ich durch.
Was immer das Ich tut, mit der besten Absicht, ist immer in Gefahr, der Wirklichkeit Gewalt anzutun.
Wenn ich aber aus der Entscheidung im Jetzt handle,
dann fließt die Weisheit des Selbst
gewaltfrei ‒ das ist die einzige Freiheit, die es gibt ‒,
in die mitfühlende Handlung des Ich.
Entscheidung und die Ent-Scheidung, die Aufhebung der Scheidung von Ich und Selbst, ist ein und derselbe Akt.
Und das erleben wir in unsern Blitzentscheidungen. Daher haben wir immer so einen Vorgeschmack und ein Modell und können uns sagen:
Was du in solchen Blitzentscheidungen machst, das sollte das Modell sein für jede Entscheidung, für jedes Handeln. Und das ist dann freie, gewaltfreie Entscheidung.
Und da sind wir dann wieder in diesem
Doppelbereich von Außen und Innen:
Außen handeln wir in der Zeit, innen ist, was Rilke in der Elegie an Marina in einem wunderbaren Satz sagt: Innen ist die
«Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst» ‒
das ist unsere Innerlichkeit.
Die letzte Weisheit liegt im Selbst. Man kann sogar sagen:
Das Selbst i s t die Weisheit.
In der christlichen Tradition ist die Weisheit, was wir den kosmischen Christus nennen. Deshalb sagt Paulus in Gal 2,20:
«Ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir.»
Und zugleich sagen wir: Christus: die Christuswirklichkeit ‒ nicht: Jesus Christus ‒ i s t die Sophia, die alttestamentliche Weisheit (Spr 8,23-31) und Jesus Christus nimmt Teil an dieser Christuswirklichkeit.
Und diese Weisheit drückt sich in unsern körperlichen Spontanreaktionen sehr gut aus. Da können wir es auch sehr gut beobachten, z.B. wie sich die Hand zurückzieht vom Feuer. Das geht aber durch alle Bereiche und man könnte dann sagen:
Eine freie Entscheidung zu treffen,
heißt auf der höchsten inneren Ebene,
das durchfließen zu lassen,
was wir in unseren Spontanreaktionen
auf der materiellen Ebene
immer ganz richtig tun.
Das ist ein und dasselbe, aber auf ganz verschiedenen Ebenen des Bewusstseins.
Frage: In welchem Zustand war Buddha nach seiner Erleuchtung?
Bruder David: Vielleicht war dieser erste Zustand nach der Erleuchtung reine Präsenz des Selbst, noch kein Ich-Selbst. Aber solange ich hier auf der Erde bin, muss ich beides, Ich und Selbst, zusammenhalten.
Entwicklung auf zwei Ebenen
Worum geht es im Leben?
Es geht um Entwicklung.
[Zum Schlüsselbegriff ‹Entwicklung› sei auf die Seiten 52f. und 134 hingewiesen im Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021) im Kapitel ‹Das Leben ‒ Ort der Begegnung mit dem Geheimnis›. In diesem Buch nennt Bruder David drei Bedeutungen des Wortes Entwicklung.
Im Vortrag Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog im Juni 2014, transkribiert in Mitschrift und Sterben, sowie im Retreat im September 2014 in Flüeli-Ranft Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II, 105-107, hatte Bruder David den Begriff ‹Entwicklung› noch scharf vom Begriff ‹Anreicherung› abgegrenzt: ‹Bereicherung, ganz was anderes wie Entwicklung. Bereicherung geht in einer Linie, Entwicklung ist kreisförmig›.]
Dieses Schlüsselwort Entwicklung stellt sich ganz verschieden dar auf den zwei Ebenen des Doppelbereichs. Bezogen auf Raum und Zeit ist Entwicklung der Ablauf von Empfängnis, wachsen, reifen, sterben.
Im Bereich des Nichtzeitlichen gibt es auch Entwicklung. So sprechen wir davon, dass jemand einen Sprachschatz entwickelt. Diese Art der Entwicklung ist mehr ein Anreichern. Bezogen auf unser Leben ist die Entwicklung auf überzeitlicher Ebene ein Einsammeln der ganzen Fülle des im Jetzt Erlebten in das große Selbst.
Nur ich, der ich so verschieden von allen anderen bin,
kann diesen, meinen besonderen Beitrag leisten.
Wir bringen unser einzigartiges Erleben in das Selbst ein
und bereichern dadurch das Selbst.
Rilke im Brief vom 13. November 1925 an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz:
«Wir sind die Bienen des Unsichtbaren
und wir heimsen den Nektar des Sichtbaren
in die goldene große Honigwabe des Unsichtbaren ein.»
Diese beiden Entwicklungen geschehen nebeneinander.
Sterben und Tod
Was ereignet sich im Sterben? Ein Loslassen. Das Loslassen übe ich in der Bemühung, im Jetzt zu leben.
Tod bedeutet, dass unsere Zeit um ist.
Es ist nicht hilfreich,
von einem Leben n a c h dem Tod zu sprechen,
denn das geht nicht, weil die Zeit um ist.
Wir können sagen ‹über den Tod hinaus›, dann sprechen wir den überzeitlichen Bereich an:
Was bleibt über den Tod hinaus?
Meine Identität wird aufgehoben im Tod.
Der Schlüsselbegriff ‹aufheben› hat nach G. F. W. Hegel drei Bedeutungen:
1. außer Kraft setzen, wie ein Bahnhof, der aufgehoben wird
2. auf eine höhere Ebene hinaufheben, erhöhen
3. bewahren, verwahren
Das Selbst bleibt und auch meine Seele bleibt.
Meine Seele ‒ meine Identität ‒, die zum Selbst gehört,
nimmt zugleich am Überzeitlichen teil
und diese Identität bleibt.
Die Identität von Verstorbenen kann uns nahe sein.
Frage: Was geschieht, wenn ein Lebensprozess, wenn Entwicklung nicht abgeschlossen ist? Kommt dann Reinkarnation?
Bruder David: Reinkarnation und Fegefeuer sind beides dichterische Bilder. Wir dürfen sie nicht wörtlich nehmen.
Weitere Themen mit Bruder David im anschließenden Gespräch: Die starke Tendenz, das Selbst zu vergessen ‒ Blitzentscheidungen im Spannungsfeld von Innen- und Außenperspektive ‒ Wollen im Sinn von Wu wei: Handeln im Nicht-Handeln (Der Fließweg).
Freitagnachmittag: 8. Impulsvortrag (Vanja):
Ergänzung zum Wort Entwicklung: Neben dem reifer werden und wachsen kann Entwicklung auch die Auflösung von inneren und äußeren Verwicklungen bedeuten. Dadurch kommen wir mehr zum eigenen Selbst.
Der Lotus, das Symbol der Reinheit,
blüht im trüben Wasser.
Er braucht diese trübe Welt.
Frage: Braucht das Selbst das Ich, um sich selbst seiner bewusst zu sein?
Bruder David: Das scheint mir sehr einleuchtend zu sein. Warum gäbe es sonst so viele Ichs.
Durch das Ich wird sich das Selbst seiner bewusst.
Vanja ergänzt zu Freiheit innen und außen: Wir in Mitteleuropa haben eine enorme äußere Freiheit, soweit das möglich ist in dieser Welt. Die innere Freiheit versuchen wir zu kultivieren, wie wir das hier im Felsentor versuchen.
Sie besteht darin, zu w o l l e n , was wir tun und lassen.
Wenn du wissen willst, was du willst,
schau, was du tust,
und dazu Ja zu sagen ist innere Freiheit.
Bei der Frage, wohin geht es, schaue ich von Tag zu Tag. Aber wir brauchen eine allgemeine Richtung, in der wir gehen wollen: Wir wollen dieser Welt dienen, für uns selber und für alle anderen die Freude mehren und Leid mindern. Was das konkret jeden Tag heißt, weiß ich nicht. Wenn ich zu sehr fixiert bin auf etwas, kann es sein, dass ich Möglichkeiten verpasse.
So wichtig Konzepte und Verständnis sind, wenn es darauf ankommt, kann es sein, dass sie nicht hilfreich sind. In einer lebensbedrohlichen Situation liegt uns ein Stoßgebet wie ‹O Maria hilf› vielleicht näher.
Früher war es selbstverständlich, dass eine Spezies gemeinsam handelte. Wir müssen uns heute als Spezies bewusst werden, dass wir ein Krebsgeschwür geworden sind. Während meiner Lebenszeit haben wir Menschen uns verdreifacht. Täglich sind wir 200’000 mehr.
Unsere Berufung
Bruder David: Oft wird mir die Frage gestellt, was soll ich tun? Wie kann ich dienlich sein?
Jeder Mensch hat eine Berufung,
nämlich die Aufgabe,
zu der das Leben uns aufruft.
Wie kann ich so hellhörig und bereitwillig antworten, dass der Beruf, den ich wähle, meiner Berufung entspricht?
Stell dir dazu drei Fragen:
1. Was freut mich? Man muss eine ganz klare Antwort darauf finden. Als ein Student Howard Thurman (1899-1981) die Frage stellte: «Was kann ich nur tun, um der Welt zu helfen»? Da antwortete dieser weise Meister: «Tu‘, was dir am meisten Freude macht. Die Welt braucht nichts dringender als Menschen, die alles, was sie tun, mit Freude tun.»
2. Was liegt mir? Wozu bin ich begabt und was kann ich lernen?
3. Welche Gelegenheiten bietet mir das Leben, meinem Ziel näher zu kommen? Gehe darauf ein. Das ist ausschlaggebend.
Das Selbst schwebt nicht.
Es ist die Wirklichkeit, die wirkt.
Wir lernen das Selbst, den immateriellen Bereich
über unsere eigenen Erfahrungen kennen.
Es ist unsere Innerlichkeit.
Nikolaus von Kues (1401-1464) sagte:
«Gottes Geheimnis ist das Zusammentreffen der Widersprüche.»
Drei Innenwelten des Gebets
Frage: Bruder David, was heißt für dich ‹beten›?
Beten heißt, sich mit Gott einlassen. Es gibt drei Formen, drei Innenwelten des Gebets im Christentum; siehe auch die Dreieinheit von SCHWEIGEN ‒ WORT ‒ VERSTEHEN.
1. Gebet der Stille: ‹Ich lasse mich in Dich hinunter› (Gerhard Tersteegen: ‹Gott ist gegenwärtig›), ins SCHWEIGEN, wie im Zazen; siehe auch Stille zulassen.
«Die meisten von uns sind an ein solches Übermaß
von Wortgeräusch gewöhnt,
dass Stille uns leicht Furcht einflößt.Sie kommt uns wie ein unendlicher leerer Rum vor.
Wir blicken in seine Weite hinab
und uns wird schwindlig.
Oder aber wir fühlen uns von ihr
auf geheimnisvolle Weise
zugleich angezogen und verblüfft.‹Ich weiß nicht, was mit mir geschehen ist›,
sagt da etwa jemand:
‹Ich habe mich immer mit meinen Gebeten wohlgefühlt,
aber seit kurzem möchte ich ganz einfach
in Gottes Gegenwart sein.
Weder möchte ich im Gebet etwas sagen,
noch etwas tun oder denken.
Und selbst die Gegenwart Gottes
kommt mir eher vor wie die völlige Abwesenheit
von allem, was ich mir vorstellen kann.
Es muss mit mir etwas nicht in Ordnung sein›!Nicht in Ordnung? Im Gegenteil!
Auch diese Stille ist Geschenk Gottes.
Und wenn wir sie als Ausdruck
unserer Offenheit für Überraschung annehmen
dann werden wir entdecken,
dass diese große Leere schon bis an den Rand
mit dem Unvorstellbaren gefüllt ist.Das muss paradox sein,
denn es bringt uns zurück
zu dem Paradox von Gottes Leben in uns:Im stillen Zentrum unseres Herzens
begegnen wir der Fülle des Lebens
als einer großen Leere.Es muss so sein. Denn diese Fülle ist größer als alles,
was das Auge gesehen und das Ohr gehört hat.Nur Dankbarkeit in Form
einer grenzenlosen Offenheit für Überraschung
kann die Fülle des Lebens in Hoffnung erahnen.»
Bruder David in seinem Buch: Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 141
- Vom Worte Gottes leben: alles, was es gibt, ist WORT Gottes. Ich horche hin auf jedes WORT und lebe davon; siehe auch Vom Worte Gottes leben ‒ die Versuchung im Garten.
- Contemplation in actione: Gemeint ist nicht, dass wir innerlich Gebete sprechen, während wir etwas tun ‒ das kann sehr gefährlich werden, wenn es etwas Heikles ist, was wir tun, und unsere Gedanken nicht voll dabei sind ‒, sondern unser Tun ist selber Gebet. Meine Mutter hat mir immer Socken gestrickt und die Liebe Gottes ist da in die Socken gegangen. Gottes Liebe in und durch unser eigenes Handeln VERSTEHEN (‹to understand›: ganz hineingehen): das ist Kontemplation i m Handeln , nicht nur w ä h r e n d des Handelns.
Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 5, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
Dankbarkeit: eine spirituelle Praxis
mit der Methode Stop ‒ Look ‒ Go,
verortet in den Schöpfungs- und Heldenmythen
und gefeiert in Anfangsritualen
und Übergangsriten,
engstens verbunden mit einem Opferritual
Tag 5: Samstagvormittag: 9. Impulsvortrag (Bruder David):
Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Orientierungshilfe im Leben, die alles zusammenfasst, was wir besprochen haben.
Dankbarkeit: eine spirituelle Praxis
Dankbarkeit als Lebenshaltung umfasst den Intellekt (danken und denken sind sehr nahe beieinander), den Willen und das Gefühl.
Dankbarkeit ist eine Haltung,
die spontan in uns aufsteigt,
wenn zweierlei zusammenkommt:
Es muss ein freies Geschenk sein
und das Geschenk muss für uns wertvoll sein.
Frei geschenkt im Unterschied von halb geschenkt: Wir müssen es nicht kaufen und es sind auch keine Erwartungen daran geknüpft.
Dankbarkeit kann gesteigert werden:
Je unverdienter und je wertvoller ein Geschenk für uns ist,
desto dankbarer werden wir.
Dankbarkeit hat den Vorzug, dass sie eine allgemeinmenschliche Begebenheit ist. Jeder Mensch, auch Kinder können sie nachvollziehen.
Dankbarkeit ist das Herzstück jeder spirituellen Praxis.
Auch im buddhistischen Kloster verneigt man sich beständig.
Dankbarkeit wird nicht nur personifiziert jemandem gegenüber ausgedrückt, sie ist auch eine Lebenshaltung und eine methodisch geübte spirituelle Praxis.
Dankbar leben ist ein Schlüssel zur Freude,
den wir in den eigenen Händen halten.
Dankbarkeit war seit Jahrhunderten die Spiritualität unserer Vorfahren, auch wenn sie das Wort Spiritualität nicht kannten.
Wir alle kennen Menschen, die alles haben, aber nicht freudig sind, weil sie nicht dankbar sind. Umgekehrt kennen wir Menschen mit vielen Problemen, die Freude ausstrahlen, weil sie dankbar sind.
Dankbarkeit ist eine spirituelle Praxis, die gleichwertig mit jeder anderen spirituellen Praxis ist, weil sie wie jede spirituelle Praxis zum Ziel hat, uns aus der Zeit ins Jetzt und von außen ins Innen zu bringen.
C. G. Jung sagt:
«Wer nach außen schaut, träumt,
wer nach innen schaut, wacht auf.»
Dankbar leben bedenkt, dass jeder Augenblick total frei geschenkt ist und von höchstem Wert ist. Jeden Augenblick kann man dies bedenken, und das gibt uns Freude.
Freude ist eine besondere Art von Glück.
Sie ist ein Glück, das unabhängig ist
von dem, was uns geschieht.Es gibt vieles, wofür wir nicht dankbar sein können.
Aber in jedem Augenblick gibt es etwas,
wofür wir dankbar sein können.
Das eigentliche Geschenk ist
die Gelegenheit jeden Augenblicks.
Wenn wir das üben, dann bemerken wir, dass 90% aller Augenblicke unseres Lebens Gelegenheiten sind zu genießen, sich zu freuen. Wir sind hier im Leben, um das Leben zu genießen. Dankbarkeit macht z.B. Teetrinken zum Genuss, wodurch dieses lebensfördernd wird.
Die anderen Gelegenheiten, in denen wir uns nicht freuen können, können Gelegenheiten sein zu lernen, an etwas zu wachsen (was nicht immer angenehm ist), zu protestieren (z.B. mit Petitionen). Das verändert die Gesellschaft. Auch im Privaten kann ich Stop sagen, ich muss mir nicht alles gefallen lassen.
Die Gelegenheit ist das größte Geschenk.
Wie sieht jetzt ganz konkret die Praxis aus? Welche Methode führt in die Dankbarkeit?
Die Methode, die sich herauskristallisiert hat, ist in drei Worten gesagt, wie es Kinder lernen beim Überqueren einer Straße:
Die Methode Stop ‒ Look ‒ Go
1. Stop ‒ Innehalten: Der erste Lernschritt ist: immer wieder innezuhalten. Das braucht weniger als eine Sekunde zu sein.
2. Look ‒ Innewerden: Sei offen mit allen Sinnen, auch mit der inneren Aufmerksamkeit! Was will die Situation von mir?
3. Go ‒ Tu etwas: Mach etwas aus der Gelegenheit! Das ist das Unerschöpfliche des Lebens, dass es immer wieder eine neue Gelegenheit gibt. Wir sind wie die Maden im Speck, umgeben von Gelegenheiten zu genießen.
Mit Dankbarkeit wach im Jetzt
Im Wort dankbar steckt das Wort denken und die Silbe -bar, in der Bedeutung von ‹gebären›, ‹hervorbringen›.
Dankbarkeit ist ein Bedenken, das etwas hervorbringt.
Dankbarkeit bringt Freude hervor
und ist ansteckend.
Jeder Moment der Dankbarkeit verändert die Gesellschaft: Dankbarkeit führt weg vom Ego zum Ich-Selbst, da sie in den Augenblick wach im Jetzt führt.
Wenn wir im Jetzt sind, sind wir im Selbst,
und wenn wir im Selbst sind, sind wir im Jetzt.
Das kann man nicht genug bedenken.Durch die Dankbarkeit sind wir im Augenblick,
man kann ja nur im Jetzt dankbar sein.
Das weckt alles auf.
Man kann sich vorstellen, wie anders die Gesellschaft aussehen würde, wenn die Dankbarkeit vorrangig wäre.
Es wäre eine Gesellschaft der Gewaltfreiheit,
der Zusammenarbeit und des Teilens.
Dankbare Menschen sind immer bereit zu teilen. Sie haben immer das Gefühl, es ist genug da.
Eichendorff dichtet: «Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.» Das Zauberwort ist: dankbar leben.
Wir brauchen nicht auf ganz besondere Gelegenheiten warten,
sondern wir können dankbar sein für die Gelegenheiten,
die immer da sind.
Zum Abschluss möchte ich die Dankbarkeit verbinden mit den großen Mythen der Menschheit:
Menschen haben immer nach Orientierung gesucht
und sie in Mythen ausgedrückt.
Mythen sind dichterische Antworten
auf die großen Fragen des menschlichen Herzens.
Im Grunde gibt es nur zwei große Fragen:
Wer bin ich? Und die Antwort der Ursprungs- / Schöpfungsmythen
Worum geht es im Leben? Und die Antwort der Heldenmythen
Auf diese Fragen antworten zwei entsprechende Mythen.
Die Frage: Wer bin ich? Woher komme ich? Warum ist etwas und nicht nichts? beantworten die Schöpfungs- oder besser gesagt: die Ursprungsmythen.
Die Frage: Worum geht es im Leben? beantworten die Heldenmythen. Der Held stellt durch seine Geschichte dar, wohin es geht.
Drei Elemente in den Schöpfungsmythen
Es gibt zwei Modelle für die Ursprungs-, bzw. Schöpfungsmythen: Die Paarung von Himmel und Erde und die Vorstellung, dass etwas da ist, weil jemand es gemacht hat.
So verschieden die Schöpfungsmythen sind, sie folgen einer inneren Logik, in denen drei Elemente zusammenspielen:
1. Der Urheber oder die Urheberin, die aus dem Nichts alles hervorbringt: das Geheimnis, das nie hinterfragt wird, ein Bild für das Uralte, das immer Seiende, die ‹Mitte des Immer› (Rilke), das Übermaterielle, in der dichterischen Sprache der Märchen etwa die Urgroßmutter, Tiere: ein Hund oder auch eine Ente.
2. Das Material, aus dem alles gemacht ist. Die Mythendichter bemühen sich, das Material so unbedeutend wie möglich zu machen, in der Schilderung des Materials so weit wie möglich an das Nichts heranzukommen. In der Bibel ist es eine Puppe aus Tonerde oder bei den Indianern in Nord- oder Südamerika sind es kleine Steinchen und Stöckchen, in Polynesien ein Traum.
3. Der eigentliche Schöpfungsakt: Das untrennbare Einswerden des Materials mit dem Schöpfer, des Nichts mit dem All-Seienden. Im biblischen Schöpfungsbericht gibt der Schöpfer dieser kleinen Puppe aus Tonerde, die aussieht wie ein Mensch, sein eigenes Leben, indem er ihr seinen Atem einhaucht.
Mythen wollen nicht nur erzählt, sondern auch rituell gefeiert werden im Alltag.
Von den Ursprungs- und Schöpfungsmythen
zu den Ursprungs- und Anfangsritualen
Die Vergegenwärtigung von Mythen in wiederholbaren Ritualen heißt in der Fachsprache ‹Entmythologisierung›, der Begriff in einer völlig anderen Bedeutung als im deutschen Sprachraum seit Rudolf Bultmann (1884-1976) üblich.
Wir müssen immer wieder ein Ritual finden,
durch das der Ursprungsmythos in unseren Alltag einfließt.
Bei den Urvölkern wurde beim ersten Fischfang des Jahres der Ursprungsmythos erzählt und dramatisch dargestellt, wie ihre Vorfahren zum ersten Fischfang ausfuhren.
Wir haben heutzutage noch das Richtfest ‒ in Österreich die Dachgleiche genannt. Seit unvordenklichen Zeiten haben die Menschen beim Bau eines Hauses, wenn der Mittelpfosten steht, die Neuschöpfung der ganzen Welt erzählt, besungen und getanzt: Der kleine Baum auf dem Dach ist der Weltbaum und das Haus ist das Welthaus.
Und dabei erwacht das Bewusstsein: Jedes Mal, wenn wir in dieses Haus eintreten, er i n n e r n wir uns wieder ‒ nicht nur äußerlich an die Zeit des Entstehens ‒, sondern vielmehr innerlich, und wir wachen auf zu der Tatsache, dass wir in einem Welthaus wohnen, nicht in einer unwirtlichen Wüste.
Wir haben keine Ursprungsrituale mehr, aber Anfangsrituale, zum Beispiel Geburtstagsfeier, wo der Anfang eines neuen Lebensjahres gefeiert wird ‒ Maturafeier, mit der ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Sehr häufig sind unsere Abschlussrituale, die wir feiern, Anfangsrituale: Das ist erledigt, jetzt geht’s weiter. Jeder Abschluss ist der Anfang von etwas Neuem.
Unsere Rituale sind sehr schwach geworden. Wir leiden an einem Hunger nach Ritualen in unserer Zeit. Es wird auch immer wieder versucht, sie neu zu beleben.
Wenn wir an die Dankbarkeit denken,
dann ist der Anfang sehr häufig ein wichtiges Ritual.
Das kann man üben.
Die Augenblicke, in denen etwas anfängt, sind ganz wichtige Augenblicke, in denen man sich besinnen und dankbar sein kann für dieses Geschenk.
Denn letztlich:
Wer bin ich?
ist ein Geschenk:
Ich bin mir geschenkt.Stop ‒ Look ‒Go: unser Anfangsritual
Vor dem Computerstart kurz die Hände auf den Computer legen und bedenken, dass alles, was ES gibt, ein Geschenk ist.
Das ist zugleich auch ein Moment,
indem das Selbst im Ich durchscheint,
die immaterielle Wirklichkeit.
durch das Materielle.
Wenn man wirklich dankbar leben will, ist es sehr hilfreich, sich so kleine Stopps einzubauen in den Tag: Jetzt ist ein neuer Tag!
Schon am Morgen, wenn man die Augen aufmacht, kann man sich zur Gewohnheit machen, zu bedenken: Ich habe Augen, ich kann die Augen aufmachen. Es gibt 42 Millionen Menschen in der Welt, die nicht sehen können. Und zum Großteil Kinder und zum Großteil, weil sie unterernährt sind durch unsere Schuld, nicht persönlich, aber trotzdem: Wir sind die Ausbeuter in unserer Kultur.
Nur einen Augenblick zu bedenken: Ich habe Augen! Und jetzt wird’s ganz anders, der Tag wird ganz anders, ein ganz anderer Anfang. Und auch praktisch: eine größere Bereitschaft zu dienen, etwas zu tun.
Wie der Ursprung in der Dreieinheit von
SCHWEIGEN ‒ WORT ‒ VERSTEHEN
in unsern Alltag einfließt
1. Stop: Wir besinnen uns auf den Ursprung, das Geheimnis als das SCHWEIGEN.
2. Look / Listen: Wir horchen auf das WORT, das aus diesem SCHWEIGEN kommt.
3. Go: Wir VERSTEHEN durch Tun, indem wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Analog dem dritten Element in den Schöpfungsmythen, dem eigentlichen Schöpfungsakt, der darin besteht, dass sich der Schöpfer mit dem Geschöpf so innig wie möglich verbindet, geschieht neu die Wiederverbindung (‹re-ligio›: wieder-verbinden) zwischen dem Selbst und dem Ich, zwischen dem Urgeheimnis und meiner kleinen Tätigkeit hier in der Zeit.
Drei Phasen im Heldenmythos
Die Heldenmythen haben 1000 verschiedene Formen und Namen.
[Siehe das Buch von Joseph Campbell: ‹Der Heros in tausend Gestalten›, Insel Verlag 2024.
Bruder David hatte Joseph Campbell am Esalen Institut in Big Sur, Kalifornien, persönlich kennengelernt und ihn gefragt, warum die Heldengestalten fast immer Männer sind. Und Campbell hat auf den Animus hingewiesen, nach C. G. Jung die männliche Seite in der Psyche einer Frau.]
Die Abenteuerfahrt des Helden folgt immer demselben Muster in drei Phasen:
1. Phase: Der Held wird ausgesondert. Der Held muss besonders sein, aber nicht so besonders, dass wir uns nicht mit ihm identifizieren können. Siehe die Kindheitsgeschichte Jesu in den Evangelien oder die Legenden über die Kindheit des Buddha.
Er wird aus der Bahn geworfen oder er verlässt freiwillig sein Umfeld. Sein innerstes Begehren treibt ihn an, aufzubrechen und allein das Wagnis einzugehen, die Abenteuerfahrt des Helden. Wir identifizieren uns mit ihm, weil auch wir immer wieder in Situationen kommen, die wir allein bestehen müssen.
2. Phase: Die Auseinandersetzung mit dem Geheimnis: In der Mitte des Heldenmythos wird der Held mit etwas konfrontiert, was er nicht begreifen kann und mit dem er doch zurande kommen muss.
Wo und wie begegnet uns im Leben etwas,
das wir nicht in den Griff bekommen können
‒ unter keinen Umständen ‒,
und mit dem wir doch zurande kommen müssen?
Wenn Liebe und Tod uns ergreift.
Deshalb haben die schmerzlichen Prüfungen des Helden meistens mit Liebe und Tod zu tun, oft ganz eng miteinander verbunden: Der Held setzt sein Leben aufs Spiel aus Liebe zur Prinzessin, die krank ist und der er das Heilmittel bringt. Oder im Motiv des Drachenkampfes: Er will die Prinzessin befreien.
Die Mythenerzähler steigern in dieser Phase die Angst wie auch den Mut, mit dem der Held die Abenteuerfahrt besteht und der Kulminationspunkt ist das Paradox:
Der Held ist so tot wie möglich
‒ nicht nur tot, sondern zerstückelt,
und siehe: Er lebt!
3. Phase: Der Held kehrt zurück zur Gemeinschaft als Lebensbringer. Ein großes Fest ‒ Hochzeitsfest ‒ wird gefeiert: «Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.»
Sehr prosaisch ausgedrückt ist die Antwort des Heldenmythos auf die Frage: Worum geht es im Leben?
Es geht im Leben darum
immer ‒ immer wieder ‒ zu sterben:
in ein größeres, volleres Leben hinein
aus der Vereinzelung in die Gemeinschaft.
Aber um wirklich in der Gemeinschaft anzukommen, muss der Held zuerst aus der Gemeinschaft hinausgehen, um nach bestandener Abenteuerfahrt Lebensbringer der Gemeinschaft zu werden.
Auch der Heldenmythos muss rituell nachvollzogen werden.
Vom Heldenmythos zu den Übergangsriten
Das Ritual, das zum Heldenmythos gehört, sind die ‹Rites de passage›, die Übergangsriten, zu denen die Initiationsriten gehören.
Die Initiationsriten, feiern die Übergänge in unserem Leben anlässlich einer Geburt, beim Eintritt ins Erwachsenenalter, ins Leben als Mönch, bei der Eheschließung, bei Krankheit, Sterben und Tod.
Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs
[Ich füge in den folgenden Abschnitten Gesichtspunkte ein, die Bruder David aus zeitlichen Gründen in diesem Vortrag nur andeuten konnte. Wegleitend dafür ist das Kapitel ‹Eine tiefe Verbeugung› in seinem Buch Die Achtsamkeit des Herzens (2021), 141-143, siehe den Text auch in Dankbarkeit und Opferritus.]
«Wenn wir uns die großen Übergangsriten ansehen, die Teil des ältesten religiösen Erbes der Menschheit sind, dann wird uns die religiöse Bedeutung der Dankbarkeit klar.» (S. 142)
Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs: Ein Übergang findet statt:
«Ein Übergang von der Vielheit zur Einheit:
Zu Anfang waren es Geber, Geschenk und Empfänger;
daraus wird die Umarmung,
die Danksagung und entgegengenommen Dank umfasst.» (S. 141)«Und diese große Geste des Übergangs eint uns.
Sie eint uns als menschliche Wesen, denn wir erkennen,
dass wir in diesem ganzen vergänglichen Universum
die Einzigen sind, die um ihre Vergänglichkeit wissen.
Darin liegt ja unsere menschliche Würde.
Darin liegt zugleich unsere menschliche Aufgabe.
Sie besteht darin, den Sinn dieses Übergangs auszuloten
Unser ganzes Leben ist ja Übergang.
Sein Sinn will durch die Geste des Dankens gefeiert sein.
Ja, Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs.» (S. 141)
Drei Phasen in den Opferriten
und in der Geste der Dankbarkeit
«Im Mittelpunkt der Übergangsriten steht immer ein Opfer, was insofern verständlich ist, als das Opfer an sich typisch für alle Übergangsriten ist.» (S. 142)
Auch die Opferriten haben drei Phasen:
1. Die Opferung (Gabenbereitung): Die Opfergabe wird ausgesondert und der Opfernde identifiziert sich mit der Gabe. In der hl. Eucharistie:
«Du schenkst das Brot, die Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit.»
«Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit.»
Natur und Kultur sind darin eingeschlossen.
2. Wandlung (Konsekration): Die Gabe wird symbolisch, rituell, dem Geheimnis übergeben: die Aufopferung, oft mit andächtigem Hinaufheben der Gabe. Wie gestern (Tag 4, Freitagmorgen) begegnen wir wieder dem Schlüsselbegriff ‹aufheben› (G. F. W. Hegel), diesmal im Zusammenhang mit den Opferriten. Das muss nicht immer die Geste noch oben sein: Bevor man in Griechenland Wein trinkt, fällt mit einer Handbewegung ein Tropfen Wein auf das Geheimnis der Erde, aus der die Trauben aufgewachsen sind. Oder die Opfergabe wird verbrannt und der Rauch steigt auf, oder das Opfertier wird getötet.
3. Kommunion: Etwas davon wird verteilt: Bruder David erwähnt Orpheus, der Sänger, der von den Mänaden verrissen wird, aber sein Haupt schwimmt noch den Fluss hinunter und singt noch, seine Leier wird zum Sternbild.
«Schließlich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt,
während dein Klang noch in Löwen und Felsen verweilte
und in den Bäumen und Vögeln. Dort singst du noch jetzt.O du verlorener Gott! Du unendliche Spur!
Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte,
sind wir die Hörenden Jetzt und ein Mund der Natur.»Rilke: Die Sonette an Orpheus Teil 1, XXVI
Ein Chenchu aus einem Stamm in Südindien wirft eine Handvoll der gefundenen Nahrung in den Busch zurück und begleitet diese Opfergeste mit einem Gebet zur Gottheit, die als Herrin des Dschungels und all seiner Früchte verehrt wird.
Das Gebet lautet:
«Unsere Mutter, durch deine Güte haben wir gefunden.
Ohne dich empfangen wir nichts.
Dafür danken wir dir.» (S. 143)
Jeder Satz des einfachen Gebets, das die Gabe begleitet, entspricht einer der drei Phasen der Dankbarkeit:
1. «Unsere Mutter, durch deine Güte haben wir gefunden»: Der Intellekt erkennt die Gabe als Gabe.
2. «Ohne dich empfangen wir nichts»: Das bringt die Abhängigkeit zum Ausdruck. Der Wille wacht auf und anerkennt das Geschenk als Geschenk. «Ein Übergang findet statt von stolzer Isolation zu demütigem Geben und Nehmen, von der Versklavung in falscher Unabhängigkeit zur Selbst-Annahme in der befreienden gegenseitigen Abhängigkeit.» (S. 141)
3. «Dafür danken wir dir»: Das Gefühl ist angesprochen und drückt den Dank aus. «Man denke nur an die Hilflosigkeit, die wir empfinden, wenn wir ein anonymes Geschenk erhalten und folglich nicht wissen, wem wir dafür danken sollen.» (S. 140)
«Das größte aller Geschenke ist das Danksagen.
Geben wir Geschenke, dann geben wir,
was wir uns leisten könnten,
danken wir aber, dann geben wir uns selbst.
Ein Mensch, der zu einem anderen ‹ich danke dir› sagt,
sagt eigentlich ‹Wir gehören zusammen›.
Das Band, das sie vereint, befreit sie von Entfremdung.»
Bruder David in seinem Buch: Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 23
Stop ‒ Look ‒ Go: unser Opferritus
Für uns sind die Opferriten nicht so zugänglich und durch dankbares Leben können wir ihren Kerngehalt selber rituell nachvollziehen mit dem Dreischritt Stop ‒ Look ‒ Go.
1. Stop ‒ innehalten und sich mit dem Geschenk identifizieren, indem wir das Geschenk als Geschenk erkennen.
Alles, was ES gibt, ist Geschenk:
Dieser eine Augenblick, diese Gelegenheit, ist Gabe.
2. Look ‒ innewerden: Ich anerkenne das Geschenk als Geschenk. Ein Geschenk kann man sich nie selber geben. Man kann sich, worum es geht, kaufen oder irgendwie aneignen, aber es ist dann nicht geschenkt.
Als Geschenk bin ich abhängig von dem, der mir das Geschenk schenkt. Ein gutes Bild ist die Mutter, der das Kind ein Blümchen schenkt. Das Kind hat alles von der Mutter, sogar die Freude des Schenkens ist ein Geschenk der Mutter an das Kind. Und doch kann sich die Mutter dieses Geschenk als Geschenk auf keine andere Weise verschaffen. Das Kind muss es schenken.
Und für uns ist das Aufgeben unserer Unabhängigkeit
absolut ein Tod,
aber zugleich ein H i n e i n sterben,
in die gegenseitige Abhängigkeit,
nicht jetzt Abhängigkeit:
sondern in das Netzwerk hineinsterben.
Das ist das volle Leben, die dritte Phase:
3. Go ‒ Danksagen und die Gegenseitigkeit feiern:
«Die Mutter beugt sich über das Kind in der Wiege und reicht ihm eine Rassel. Das Baby erkennt das Geschenk und erwidert das Lächeln der Mutter.
Die Mutter ihrerseits hochbeglückt von der kindlichen Geste der Dankbarkeit, hebt das Baby hoch und küsst es.
Das ist sie, die Spirale der Freude.
Ist nicht der Kuss ein größeres Geschenk als das Spielzeug?
Ist nicht die Freude, die darin zum Ausdruck kommt, größer als die Freude, die unsere Spirale ursprünglich in Bewegung setzte?» (S. 140)
«Zu Anfang waren es Geber, Geschenk und Empfänger;
daraus wird die Umarmung,
die Danksagung und entgegengenommenen Dank umfasst.
Wer kann im abschließenden Kuss der Dankbarkeit
noch zwischen Geber und Empfänger unterscheiden.» (S. 141)
Und wenn man das wirklich sieht und sich darauf einlässt und das nachvollzieht, dann sieht man, dass darin wirklich Orientierung im Leben liegt.
Dass im dankbaren Leben die Orientierung liegt, die Menschen schon seit unendlichen Zeiträumen, solange es uns gibt, immer wieder gesucht haben durch die Fragen: Wer bin ich? Und: Worum geht’s im Leben?
Wer bin ich?
Ich bin mir geschenkt.Worum geht‘s im Leben?
Mich dankbar zu erweisen für dieses Geschenk.
Bruder David antwortet auf Rückfragen:
Die Kindheitsgeschichte in den Evangelien von Matthäus und Lukas werden in der Form einer Heldengeschichte beschrieben. Siehe die besondere Empfängnis, besondere Schwangerschaft, besondere Geburt. Der zwölfjährige im Tempel: Das Kind ist ein Wunderkind. Und Jesus Christus stiftet wie ein Held Gemeinschaft.
Gemeinschaften haben immer gemeinsame Helden.
Rückfragen zu: ‹Warum kann ich mir nicht selber ein Geschenk machen›?
‹Wie gehe ich damit um, wenn ich mich beschämt fühle und in Verlegenheit gerate, ein wertvolleres Geschenk zu empfangen, als ich es selbst schenken könnte›?
Da berühren wir wieder den entscheidenden Punkt:
Wir sind auf ein Gegenüber angewiesen,
das Gegenteil von Unabhängigkeit
ist nicht Abhängigkeit,
sondern gegenseitige Abhängigkeit.
Die falsche Unabhängigkeit aufzugeben,
ist für uns wie ein Tod.
Der Weg zu Fülle und Nichts (1991)
Vortrag von Bruder David,
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Wenn man zu einem Vortrag kommt, der den Weg zu Fülle und Nichts im Titel hat, dann ist es schon klar, dass es hier nicht um eine vorwiegend akademische Abhandlung gehen kann, sondern, dass der Titel selbst schon dichterisch ist. Und für uns ist es nicht so leicht, aus unserem alltäglichen Leben in das Dichterische einzutreten. Manchen fällt es weniger schwer, andern mehr, aber wir alle müssen eine gewisse Bemühung machen, dorthin zu kommen.
Ich würde vorschlagen, dass wir, was ich Ihnen zu sagen habe, mit einem Gedicht verbinden. Und zwar mit einem der Sonette an Orpheus von Rilke, das mir schon lange sehr lieb ist, und das uns wirklich in diese Welt einführt.[1] Und um uns auf das Dichterische einzustimmen, würde ich vorschlagen, dass wir die ersten paar Zeilen dieses Gedichtes anhören, aber noch ohne uns über den Inhalt Gedanken zu machen. Nur reine Musik. Es ist das 13. der Sonette an Orpheus aus dem zweiten Teil: die ersten vier Zeilen gehören zum Schönsten und Musikalischsten in der deutschen Sprache. So könnten wir uns vielleicht zunächst nur die Musik anhören; ich lese sie Ihnen mal vor, aber bitte nur zuhören und nicht … wenn Sie’s können, nicht zu sehr darüber nachdenken. Nur der Klang …
Ich habe das öfters schon Leuten vorgelesen, die gar nicht Deutsch können, und schon der Eingang ist bezaubernd, im wahren Sinn des Wortes bezaubernd, denn wir wollen uns eben bezaubern lassen und durch diesen Zauber hineinführen in eine Welt, in der allein wir eine Sprache sprechen können, die dem gewachsen ist, wovon wir hier sprechen wollen.
Die dichterische Sprache ist tragkräftiger für Wahrheit als irgend eine andere Ausdrucksweise.
Die abstrakte logische Sprache wird zu gebrechlich, lange bevor wir noch das gesagt haben, was wir eigentlich wirklich sagen wollen. Die dichterische Sprache ist tragfähig. Das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung: Wenn wir wirklich von Einsicht und Lebenserfahrung und Liebe überwältigt werden, werden wir plötzlich dichterisch in unserer Ausdrucksweise. Das zeigt uns schon, dass unser gesunder Instinkt uns in diese Richtung weist.
Diese ersten vier Zeilen des Sonettes lauten:
‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
dass, überwinternd, dein Herz überhaupt übersteht.›[2]
Um noch tiefer einzudringen, schlage ich jetzt vor, wir machen es gemeinsam. Ich lese die erste Zeile, Sie sprechen sie nach. Ich lese die zweite Zeile und Sie sprechen sie nach …
(07:25) Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon auf einer Ebene, wo wir vielleicht leichter darüber sprechen können. Wir fangen hier mit Abschiednehmen an. Rilke spricht öfters darüber, dass viele der großen Dinge mit Ende beginnen und mit Anfang enden.[3]
Kein schlechter Anfangspunkt für uns, wenn wir über Fülle und Nichts sprechen wollen, mit dem Abschied zu beginnen.
Und zwar wissen wir alle, auch wenn wir uns darüber oft nicht Rechenschaft geben, nicht darauf reflektieren: Wir wissen alle, dass wir immer wieder Abschied nehmen müssen.
Zum Beispiel: Wir sind hier zusammen jetzt in diesem Raum, in dieser Gruppe von Menschen: Schon von Anfang an bietet sich eine gewisse Gemeinsamkeit. Im Laufe unseres Gespräches ‒ und ich hoffe, dass es wirklich ein Gespräch wird, wir uns Zeit lassen zu einem wirklichen Gespräch ‒,[4]
im Laufe dieses Gespräches werden wir noch mehr zusammen Gemeinschaft erleben. Aber in dieser Zusammenstellung werden wir uns nie wieder in alle Ewigkeit treffen. Wir werden nie wieder alle in einem Raum zusammen sein hier.
Und selbst mit unsern engsten Freunden und Freundinnen wissen wir, dass einmal ein Abschied sein wird, und wir werden einander nicht wieder sehen.
Und wenn wir das einmal ernstlich ins Auge fassen, dann ist es nicht so makaber oder lebensverneinend, wie es auf den ersten Blick aussieht, sondern ungeheuer lebensbejahend.
Denn der Grund, warum wir so häufig so halblebendig sind, ist, dass wir immer glauben, dass noch Zeit ist für die nächste Hälfte, obwohl wir keinerlei Garantie dafür haben.
Wenn wir das ernst nehmen, dass das vielleicht ‒ und es ist sehr leicht möglich ‒, unsere letzte Begegnung ist ‒ ich spreche jetzt über irgendeine Begegnung zwischen zwei Menschen ‒, wenn wir es wirklich ernst nehmen: das könnte jetzt unsere letzte Begegnung sein, dann wird es zu unserer ersten: So waren wir noch nie zusammen, so offen, so bereit.
Und das gilt nicht nur für die Begegnung und das Abschiednehmen zwischen Menschen, sondern mit allem: Wenn wir unsere Suppe so essen, dass wir wirklich Abschied davon nehmen und nicht so überzeugt sind, dass es morgen wieder Suppe geben wird, sondern ‒ vielleicht leben wir morgen nicht mehr ‒, dann wird das plötzlich die letzte, aber auch die erste Suppe, die wir mit solcher Begeisterung essen.
So stelle ich mir das vor und Rilke scheinbar auch, denn er spricht ausdrücklich davon, dem Abschied voran zu sein. Wir denken immer, dass der Abschied später kommt.
(11:13) Darum leben wir nicht voll. Und Spiritualität heißt ja volles Leben. Spiritus ist Lebensatem, und spirituell leben heißt, völlig lebendig sein, völlig durchatmen, wirklich lebendig. Wenn wir dem Abschied voran sind, und nicht darauf warten, dann werden wir wirklich lebendig:
Sei dem Abschied voran ‹wie der Winter, der eben geht›,
und dieses eben ist wunderschön da hineingesetzt ‒, das kann zweierlei bedeuten: Hier, jetzt im Mai ‒ es war ein langer Winter und lange kalt, wir sind eigentlich gerade an dieser Stelle und schauen die Frühlingsblumen an ‒, und wir werden aufgefordert, dem Abschied voran zu sein wie der Winter, der ‹eben geht›, der soeben, zu dieser Zeit, geht.
Aber da ist noch eine andere Bedeutung zu dem Wort eben ‒ er geht eben ‒, ‹der Winter, der eben geht›, der nicht noch herumhängt und noch wartet.
So sollen wir auch wie die Jahreszeiten kommen und wieder gehen, und uns nicht anhängen, sondern dem Abschied voran sein: der Winter ist auch dem Abschied voran.
Und warum? Weil unter Wintern einer so endlos Winter ist, dass wenn unser Herz den Winter übersteht, es überhaupt übersteht.
Und zwar müssen wir da nicht unbedingt nur an den l e t z t e n Winter denken, also an unseren leiblichen Tod ‒, das legt sich nahe:
Jeder Abschied ist eine Art von Sterben, und unser letztes Sterben ist dann dieser ‹endlos Winter›.
Ich glaube eher, dass in dem Augenblick, wo wir wirklich aufwachen und wirklich lebendig werden, weil wir eben dem Winter ‒ dem Abschied ‒ voran sind, irgendein Abschied als dieser endlose Winter erlebt werden kann, wenn überstehen heißt, dass ‹das Herz überhaupt übersteht›.
Mit anderen Worten: Wir nehmen dann eine innere Haltung ein, die es uns ermöglicht, immer zu überstehen.
Und der Winter ist ja für die Pflanzen, für die Tiere und oft auch für die Menschen, die nicht so vom Schicksal begünstigt sind wie wir, eine sehr große Gefahr: Werde ich diesen Winter noch überstehen?
(14:14) Wenn wir aber dem Abschied voran sind, dann sind wir Überstehende ‒ überstehen: ein wunderschönes Wort ‒, dann stehen wir schon darüber, dann sind wir in einen Bereich eingetreten, der über dem Zeitlichen steht, über dem nur-Zeitlichen. Dann sind wir in das Jetzt eingetreten. Dort ist unser wahres Leben: in dem Jetzt, wo wir wirklich sind.
Wir können uns ja fragen: Wo sind wir denn wirklich?
Wir sehnen uns darnach, echt zu sein, wirklich zu sein:[5]
Wo können wir wirklich sein? ‒ Nur im Jetzt.
Denn in der Vergangenheit waren wir ‒ sind wir nicht ‒, in der Zukunft werden wir sein ‒ sind wir nicht ‒, wenn wir also wirklich sein wollen, so muss das in diesem Augenblick sein.
Wo ist dieser Augenblick? Wo ist dieses Jetzt?
Tja, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, Sie werden sagen, das ist diese kurze Zeitstrecke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft.
Ja, wenn es eine kurze Zeitstrecke ist, dann hindert uns ja nichts daran, diese kurze Zeitstrecke in die Hälfte zu schneiden, und eine Hälfte ist nicht, weil sie nicht mehr ist, und die andere Hälfte ist nicht, weil sie noch nicht ist ‒ Haarspalterei ‒, aber solange es ein Haar ist, kann man es spalten, es hindert uns nichts dran.
Wo ist das Jetzt, wo das ‹Ist›, wo s i n d wir?
Wir beginnen plötzlich zu sehen, dass die Zeit, in der wir leben, nicht diese lange Eisenbahnlinie ist, wie wir es uns gewöhnlich vorstellen, sondern ein Prozess, in dem die Vergangenheit ununterbrochen die Zukunft auffrisst ‒ restlos ‒, kein Rest, kein Stückchen dazwischen.
Wo ist ‹Ist›, wo ist Jetzt? ‒ Jetzt ist nicht in der Zeit.
Darum existieren wir als Menschen. Ex-istieren heißt wörtlich heraus-stehen: Als Menschen erleben wir uns als die Geschöpfe, die aus der Zeit herausstehen. Wir ragen aus der Zeit heraus in das Jetzt.
Wir leben in der Zeit, aber wir gehören nicht ganz der Zeit an, wir kennen das Jetzt, und jedes Kind kennt das Jetzt, und das Jetzt ist in der Zeit nicht zu finden,
und das Jetzt ist Ewigkeit.
Denn die Ewigkeit ist keine lange, lange Zeit ‒ das sollten wir wissen ‒, das wäre ja nur Zeit, das wäre nicht eine andere Dimension.
Und da gibt’s so Geschichten von diesem winzigen Vogel, der zu diesem Berg geflogen kommt und einmal in tausend Jahren den Schnabel daran wetzt, und wenn der ganze Berg weggewetzt sein wird, dann wird eine Sekunde der Ewigkeit vergangen sein. Das ist eine herzige Geschichte, aber sie hat absolut nichts mit Ewigkeit zu tun. Es ist immer noch lange, lange, lange Zeit.
Ewigkeit ist das Gegenteil von Zeit, Ewigkeit ist das ‹Jetzt ‒, das nicht vergeht›, das Jetzt, einfach das Jetzt, außerhalb, überhalb der Zeit, in das wir hineinragen, das wir schon kennen. Wir kennen es alle, wir wissen alle, was Jetzt heißt, und wir finden es nicht in der Zeit.
Augustinus sagt das sehr schön, er definiert aeternitas ‒ Ewigkeit mit den im Lateinischen eleganten zwei Worten: ‹Nunc stans›: ‹das Jetzt, das steht›, oder: ‹das Jetzt, das Bestand hat›:[6]
In unsern besten, lebendigsten, Augenblicken kennen wir dieses Erlebnis, dass die Zeit stillsteht. Es ist eigentlich nur ein Bruchteil einer Sekunde, und wir haben so viel erlebt, das in Jahren keinen Platz findet. Oder es ist eine lange Zeit, wir sitzen da und schauen diesen Regenbogen an, oder sitzen dort am Meer oder sonst in irgendeiner Situation, wo wir plötzlich weg sind, und zwei Stunden sind vergangen, und es erscheint uns wie Sekunden, oder das ähnliche Phänomen: Stunden erscheinen uns wie Sekunden.
Die Zeit existiert nicht, wenn wir im Jetzt sind, und in unsern besten, lebendigsten, Augenblicken sind wir eben in diesem Jetzt.
(19:53) Und das führt uns jetzt genau zur nächsten halben Zeile der zweiten Strophe:
‹Sei immer tot in Eurydike.›
In den Sonetten an Orpheus sind immer wieder Anspielungen auf den Mythos von Orpheus und Eurydike, und Eurydike steht hier für die große Geliebte, die in der Blüte ihrer Jahre stirbt, gebissen von einer Schlange, und muss in den Hades hinunter. Und Orpheus geht ihr nach ‒ das ist auch so wunderschön ‒, er ist der große Sänger und singt vor Hades, dem Gott der Unterwelt und Persephone, seiner Braut, die Hades in die Unterwelt entführte, und beide sind so gerührt, dass Hades sogar weint ‒ eiserne Tränen ‒, der Gott der Unterwelt kann nur eiserne Tränen weinen. So gerührt sind sie, dass sie Orpheus sogar die Erlaubnis geben, Eurydike wieder heraufzubringen unter der Bedingung, dass er sich nicht umdreht und sie nicht anschaut, bevor sie beide im Licht der Sonne sind. Und das gelingt Ihnen nicht ‒ da sind verschiedene Versionen: entweder, weil er ungeduldig wird, oder, weil er schon im Licht der Sonne ist, aber sie noch nicht ‒, jedenfalls muss sie wieder zurück, aber das geht uns hier eigentlich nichts an, es gefällt mir so gut, dass ich die ganze Geschichte erzähle.[7]
‹Sei immer tot in Eurydike›: Orpheus ist ‹tot in Eurydike›, er geht ‹dem Abschied voran›, schon vor dem Ende seines Lebens geht er in die Unterwelt hinunter, um sie zurückzubringen: Das gelingt ihm nicht, er ist ‹tot in Eurydike›, er ist tot, aber nicht im Sinne von ‹nicht lebendig›:[8]
(22:34) Und jetzt kommen wir unserem Thema schon näher, denn Rilke fährt weiter:
‹Sei immer tot in Eurydike –, s i n g e n d e r steige,
p r e i s e n d e r steige zurück in den reinen Bezug.›
In den reinen Bezug. Alle unsere Beziehungen zu einander und zu der Welt und zu den Dingen und zu uns selbst und zum göttlichen Horizont aller Dinge, all diese Beziehungen werden nur reiner Bezug, wenn wir dem ‹Abschied voran› gehen. Und zwar
‹singender steige … zurück›:
Orpheus, der zurückkommt singt, er ist der große Sänger, es sind Klagelieder, aber Lieder sind immer Gesang, auch wenn sie Klagelieder sind, er singt so überwältigend, dass die Bäume sich entwurzeln und mit ihm tanzen, und die Felsen ihm zuhören, und die Löwen ihm zuhören, das gehört alles zu diesem mythischen Bild dazu:[9]
‹… singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug›,
umso preisender, weil du das Leben auf dem Hintergrund des Todes siehst ‒ und da kommen wir jetzt zu unserem Thema ‒, weil du das Sein auf dem Hintergrund des Nicht-Seins siehst.
Und nur, wenn wir das Sein auf dem Hintergrund des Nicht-Seins sehen, nur wenn wir ‒ praktisch gesprochen ‒ diese Begegnung jetzt auf dem Hintergrund des Umstandes sehen, dass wir unter Umständen uns nie wieder sehen werden, wird es wirklich lebendig und voll.
Darum:
‹… singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug›:
Wenn Orpheus aus der Unterwelt kommt, steigt er zurück, steigt in den ‹reinen Bezug›, in das Jetzt, zu dem auch wir aufsteigen.[10]
Hier ‒ und jetzt wird unsere Situation in dieser Welt wunderbar charakterisiert ‒, zuerst:
‹Hier unter Schwindenden›:
das ist unser Leben hier: Wir leben unter Schwindenden. Daher dieses ständige Abschiednehmen;
und dann ein zweites Bild: ‹Hier unter Schwindenden› ‒
‹im Reiche der Neige›:
‹Der Tag hat sich geneigt›,[11] alles neigt sich, wenn die Blumen welk werden, neigen sie sich, wir leben hier im Reich der Neige und unter Schwindenden.
Und jetzt die große Aufforderung:
‹Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.›
Das ist dieser Augenblick, das ist dieses Jetzt:
‹sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.›
Das ist der Abschied, der voraus weggenommen wird, das ist das Zerbrechen, aber es ist zugleich das Klingen:
Und auf was warten wir denn, als darauf,
dass wir endlich klingen und völlig Klang werden?
Das Glas wartet ja nur darauf, endlich wirklich Klang zu werden. Und wir schieben das immer hinaus und schieben das immer hinaus, jaja, aber noch nicht.
Augustinus hat das selber sehr gut gekannt in seinem berühmten Gebet: ‹Gott mache mich keusch, aber noch nicht›.[12]
(26:30) Also ich lese noch einmal den ersten Teil dieses Sonettes, die ersten acht Zeilen, die bei einem Sonett immer den ersten wichtigen Teil darstellen, der dann mit den nächsten sechs Zeilen ergänzt und abgerundet wird:
‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
dass, überwinternd, Dein Herz überhaupt übersteht.
Sei immer tot in Eurydike –, singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug.
Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.›
Und jetzt wird’s noch philosophischer und noch mehr auf unsere bestimmte Frage der Weg zu Fülle und Nichts wie ausdrücklich abgestimmt:
‹Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung›:
Mit anderen Worten: Wenn die alten Mönche auf ihre Sonnenuhren geschrieben haben: ‹Memento mori› ‒ ‹gedenke, dass du sterben musst›, so war das ja nicht irgend eine makabre Idee: halte den Tod vor Augen, sondern das war einfach wie die letzte Zeile eines berühmten spätlateinischen Gedichtes, das heißt ‹das tanzende Mädchen›, und die letzte Zeile heißt: ‹Lebe doch›, sagt der Tod, ‹ich komme›. ‹Der Tod zieht mich beim Ohr›, heißt‘s:
‹Der Tod zieht mich beim Ohr› und sagt: ‹Lebe doch ‒, ich komme›:
‹Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung›:
Du kannst nur sein, wenn du des Nicht-Seins Bedingung kennst. Und er nennt jetzt des Nicht-Seins Bedingung,
‹den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal.›
‹Grund› hat ja auch eine wunderbare Doppelbedeutung: Einerseits ist es der Abgrund des Nichts, der unter der Fülle des Seins liegt, und anderseits ist es der Grund im Sinne der Begründung auch:
Nur des Nicht-Seins Bedingung, nur unser Wissen um die Möglichkeit des Nichtseins, nur unser Wissen um die Tatsache, dass wir rundum vom Nichtsein umgeben sind, dass wir uns wundern müssen, warum denn überhaupt irgendetwas ist ‒
‹Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen›,[13]
heißt es wieder in einem Gedicht:
Uns das bewusst machen, macht uns völlig lebendig: Dieses Nichts gibt uns erst die Fülle des Lebens.
‹Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal.›
Dieses ‹einzige Mal› ‒ es gibt kein zweites Mal ‒, es ist nur ‹dieses einzige Mal›:[14]
Und wenn es wirklich sich noch einmal ereignen sollte, dass wir uns begegnen, oder dass wir diese Suppe essen ‒ es ist ja nicht dieselbe Suppe, aber dasselbe Rezept ‒, dann ist es wieder nicht dasselbe, niemals dasselbe, wie Heraklit es schon gewusst hat: ‹Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen›.
(30:47) ‹Den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung›:
Da gibt es ein wunderbares Gedicht, das ich Ihnen leider nur in einer selbstgemachten Übersetzung darbieten kann, und zwar ist es von John Cage ...[15]
Wir sprechen jetzt über ‹den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung›, und das Gedicht von John Cage lautet:
‹Wenn du es loslässt, dreht es sich selbst ‒
du bist überflüssig:
Jedes etwas feiert das Nichts, von dem es getragen wird.
Wenn wir die Welt abladen von unseren Schultern ‒
Siehe da: Sie trägt sich selbst:
Wo liegt unsere Verantwortung?›
‹If you let it, it supports itself.
You don’t have to.
Each something is a celebration of the nothing that supports it.
When we remove the world from our shoulders
we notice it doesn’t drop.
Where is the responsibility?›
Wo ist unsere Verantwortung, wenn alles sich selber trägt, wenn jedes Ding verstanden werden kann als die Feier des Nichts, das es trägt?
Wo ist dann unsere Verantwortung? Wir sind ja auch Ding, das getragen wird von dem Nichts:
Wo ist dann unsere Verantwortung? ‒
Darin, es zu feiern,
feiern, wie Rilke in einem andern berühmten Sonett sagt:[16]
‹Rühmen, das ist’s.›
Und das ist unsere Aufgabe im Leben: zu preisen.
‹… singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug.
Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.
Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal.›
(34.19) Wir sprechen jetzt über den Augenblick, das Jetzt, das weder der Vergangenheit noch der Zukunft angehört, mit einem neuen Bild in den letzten drei Zeilen des Sonetts:
‹Zu dem gebrauchten›,
das heißt: zu allem Vergangenen, dem Aufgebrauchten,
‹sowohl wie zum dumpfen und stummen
Vorrat der vollen Natur›:
das ist das Kommende,
‹den unsäglichen Summen
zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl.›
Die Zahl ‒ Bruder David klopft auf das Pult ‒ ist die Zeit, die Zahl ist in diesem Sinn alles, was sich messen lässt, die Zeit im Sinne von Uhrzeit, die Zeit, die mit den Uhren gemessen wird, der Chronos, nicht der Kairos:
Die Griechen haben zwei Wörter für die Zeit: eines ist Chronos, das ist die Zeit, die die Uhren anzeigen, und Rilke sagt das wunderschön:
‹Mit kleinen Schritten gehen die Uhren neben unserem eigentlichen Tag.›[17]
Und was ist unser eigentlicher Tag? Kairos-Zeit, das heißt: Zeit zur Entscheidung. Letztlich ist es Zeit, sich zu entscheiden: ent-scheiden.
Kairos ist Zeit für Entschluss. So könnte man es vielleicht am besten sagen:
Kairos ist Zeit für Ent-schluss.
Solange wir im Chronos bleiben ‒ Chronos ist in der Mythologie der Gott der Zeit, der seine Kinder auffrisst ‒, solange wir in dieser Zeit der Uhren bleiben, sind wir noch nicht ent-schlossen, sondern sind gefangen.
Wenn wir in den Kairos eintreten, wenn wir die Zeit jetzt verstehen als
Gelegenheit, völlig zu sein ‹dieses einzige Mal›,
das ist Entschluss,
und wir entschließen uns zu dieser Ent-schlosseneheit zum Ganzen.
Und darauf kommt es an, und ‒ in diesem Augenblick ‒ dieser Entschluss ist, dichterisch gesprochen, ‹der Weg zu Fülle und Nichts›, zu einer wirklichen Anerkennung des ‹unendlichen Grundes unserer innigen Schwingung› ‒ ‹des Nicht-Seins Bedingung› völlig anerkannt, und zugleich ‒: daraus entsteht die volle Lebendigkeit,
‹ein klingendes Glas› sein, ‹das sich im Klang schon zerschlug›.
Dazu müssen wir uns entschließen können. Das ist die große Aufgabe, das ist nicht leicht. Es ist ungeheuer schwierig sogar.
(37:50) Ein anderer Aspekt jetzt: Der Abschied ist eigentlich das Verlassen:
‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlich Winter,
dass, überwinternd, Dein Herz überhaupt übersteht.
Sei immer tot in Eurydike –, singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug.
Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.
Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal.
Zu dem gebrauchten sowohl, wie zum dumpfen und stummen
Vorrat der vollen Natur, den unsäglichen Summen,
zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl.›
Wir sollten uns vielleicht daran erinnern, wenn wir das nächste Mal zu der bitteren Einsicht kommen:
‹Ich kann mich auf nichts verlassen.›
Ein wunderbarer Satz! Er kommt uns auf die Zunge gerade im rechten Augenblick:
‹Ich kann mich auf Nichts verlassen.›
Wirklich: Ich kann mich verlassen ‒ auf Nichts … ‹Wir können auf Wasser gehen›. Das Nichts ist auch etwas: die Fülle des Lebens entspringt daraus.»
(40:13) Alle singen als Übergang zum Gespräch gemeinsam den Kanon von Pretorius: «Viva la musica».
Bruder David im Gespräch nach dem Vortrag:[18]
«In ausdrücklich christlicher Terminologie gesprochen: Was ist das Nichts von dem wir getragen werden? Gott. Gott ist nichts. Gott ist nicht etwas, schon gar nicht etwas anderes,[19] aber nicht ein leeres Nichts,[20] sondern das Nichts, auf das wir uns verlassen können. Und wenn wir uns auf dieses Nichts verlassen, dann sehen wir, wie verlässlich es ist.[21] Davon kann man niemanden überzeugen, aber man braucht ja auch niemanden zu überzeugen. Man kann ja nur sagen: Versuch’s einmal. Und man merkt sofort, dass man sich auf dieses Nichts verlassen kann: Es trägt.
‹Die Antennen fühlen die Antennen und die leere Ferne trägt›,[22]
sagt Rilke.
Und so, wenn wir uns auf Nichts verlassen, trägt uns das Nichts, wenn wir uns auf Gott verlassen, dann trägt uns Gott, wir erleben das einfach.»
_______________
[1] Die Beziehung von Bruder David zu Rilke und besonders zu ‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter/dir› (Die Sonette an Orpheus 2. Teil, XIII) ist einzigartig und spürbar in allen seinen Büchern und Vorträgen; siehe den v Dem Geheimnis auf der Spur (2016) ab (40:06).
Abschied, der Klang des Lebens enthält wegweisende Passagen zu diesem Sonett aus dem Credo (2015) und dem Vortrag Leben in Zeiten der Bedrängnis (2017) (siehe Anm. 3 und 6). In Ergänzend: 2.-4. sind weitere Vorträge zusammengestellt, in denen Bruder David dieses Sonett vorträgt und deutet.
[2] In Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II: 140-148, 150f., den Vorträgen im Haus St. Dorothea in Flüeli-Ranft vom 14.-18. September 2014, bildete dieses Sonett ‒ wie auch das vorhergehende (in Anm. 3) ‒ das Herzstück dieser vier intensiven Tage
[3] Rilke: ‹Wolle die Wandlung› (Die Sonette an Orpheus 2. Teil, XII); siehe auch Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 151-155, und Abschied, der Klang des Lebens: Ergänzend: 2.-3.:
«Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung;
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.»
[4] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 31
«Ein ernstes Gespräch ist kein Wortwechsel, das ist eher ein Austausch von Schweigen: Schweigen mittels Worte. Was ausgetaucht wird ist nicht ein Wortwechsel ‒ ein Schweigewechsel. Ein gemeinsames Schweigen in das man sich einlässt.»
[5] Siehe auch in Das Vaterunser (2022), 106; ebenso in Erlösende Kraft, Anm. 4; Altern, Anm. 14, und Reifen, Anm. 7:
«In dem klassischen Kinderbuch von Margery Williams ‹The Velveteen Rabbit›, erschienen 1922, das es als ‹Der Samthase› auch auf Deutsch gibt, reden bei Nacht die Puppen und Teddybären über ihren sehnlichsten Wunsch: wirklich zu werden. ‹Tut Wirklichwerden weh?›, fragen sie das alte, erfahrene Schaukelpferd. Das aber weiß: Einem, der wirklich wird, macht es nichts aus, dass das wehtut.»
[6] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 89-91; Jetzt und ewiges Leben: Anm. 8:
Der Ausdruck nunc stans findet sich erstmals bei Thomas von Aquin (1225-1274). Er hat eine lange Vorgeschichte, beginnend mit Platon (428-348 v. Chr.) und weiterführenden Beiträgen von Plotin (205-270), Augustinus (354-430), Boethius (ca. 480-524) und späteren Denkern zum Thema ‹Zeit und Ewigkeit›.
Audio Fragen, denen wir uns stellen müssen (2016)
Tag 2 ‒ Nachmittag: Im Selbst sein und im Jetzt sein ist identisch (Bruder David):
(13:57) Ganz im Jetzt sein: ‹The moment in and out of time› (T. S. Eliot) ‒ ‹Das Nirgends ohne Nicht› (Die achte Duineser Elegie) ‒ ‹Nunc stans›: Ewigkeit ‒ das Jetzt, das nicht vergeht / (18:15) Im Selbst sein und im Jetzt sein ist identisch ‒ ‹All is always now› (T. S. Eliot) ‒ Immer wieder ins Jetzt kommen: das Kernanliegen aller spirituellen Wege
[7] Siehe auch Bruder David zum Mythos von Orpheus und Eurydike in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 52-56
[8] Sinngemäße Wiedergabe mit Blick auf Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 54; Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 141f.; das Video Leben in Zeiten der Bedrängnis (2017) ab (06:16); den Text im Buch Credo (2015), 226, in Abschied, der Klang des Lebens
[9] Rilke: Die Sonette an Orpheus 1. Teil, XXVI: ‹Du aber, Göttlicher, du, bis zuletzt noch Ertöner›; siehe das Sonett in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 55f.
[10] Siehe in Rühmen, Er-innern, Aufheben: Anm. 2, den dreifachen Sinn des hegelschen Begriffs ‹aufheben›: negieren (tollere) ‒ emporheben (elevare) ‒ bewahren (conservare)
[11] ‹Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget› (der Kanon mit Bezug auf die Begegnung der Emmausjünger mit dem Auferstandenen in Lk 24,29); siehe auch Abschied, der Klang des Lebens: Ergänzend: 2.3.: das Baumnamensuffix đr[a] verrät, dass Trauer Neige und Trost die Kraft ist, sich aufzurichten
[12] Augustinus: Confessiones VIII, 7, 17
[13] ‹Media in vita morte sumus›; siehe auch Rilke: ‹Der Tod ist groß› in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 116
[14] Im Buch Credo (2015), 225, zitiert Bruder David folgende Passage aus der Neunten Duineser Elegie von Rilke:
«Aber weil Hiersein viel ist, und weil uns scheinbar
alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das
seltsam uns angeht. Uns, die Schwindensten. E i n Mal
jedes, nur e i n Mal. E i n Mal und nichtmehr. Und wir auch
e i n Mal. Nie wieder. Aber dieses
e i n Mal gewesen zu sein, wenn auch nur e i n Mal:
i r d i s c h gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar.»
[15] ‹Composer John Cage: Konzepte wider den Zwang› (Du, die Zeitschrift der Kultur, Heft Nr. 5, Mai 1991)
[16] Rilke: Die Sonette an Orpheus 1. Teil, VII; siehe das Sonett in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 132f. und Rühmen, Er-innern, Aufheben
[17] Rilke: Die Sonette an Orpheus 1. Teil, XII; siehe Jetzt und ewiges Leben: Anm. 10: Credo (2015): ‹Das ewige Leben›, 223f.; R. M. Rilke: ‹Heil dem Geist, der uns verbinden mag›, das vollständige Sonett in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II, 96f.
[18] Audio ‹Wo ist die Verantwortung?(John Cage) in Festival «Die Kraft der Visionen» (1991): 2.2: ‹Der Weg zu Fülle und Nichts› ‒ Die Themen des Gesprächs
[19] Siehe Religionen und heiles Gottesbild: Ergänzend: 3. Audios / Text zu ‹Gott ist nicht jemand Anders› ‒ ‹God isn‘t somebody else› (Thomas Merton)
[20] Siehe Religionen und heiles Gottesbild: Ergänzend: 2.2. Vortrag An welchen Gott können wir noch glauben (2008):
«Dorothee Sölle, die große protestantische Theologin, spricht von Gott als MEHR, mehr und immer mehr, könnte man sagen, und nicht nur auf derselben Ebene, sondern in immer neuen Dimensionen. Und dieses Geheimnis, das uns umgibt, ist Nichts. Es ist nicht etwas, und in diesem Sinne nichts.
Es ist aber in keiner Weise ein leeres Nichts, sondern es ist das Nichts, das der Quellgrund und Mutterschoß von allem ist, was es gibt. Und es ist ein göttlicher Abgrund, aus dem die Fülle von allem kommt. Und die Fülle selbst ist wieder unausschöpflich. Und da ist unser eigenes Selbst eingeschlossen und daher sind wir uns selbst auch unauslotbar.»
[21] ‹Sich verlassen›: Immer wieder erinnert uns Bruder David an den Doppelsinn dieses Wortes; siehe Gott ‒ ‹mein Gott›: Ergänzend: 1.2.; Mich-Verlieren ‒ Finden; im Zusammenhang mit dem Wort ‹Amen› in Ich-Selbst werden: Ergänzend: 1.
[22] Wie in Anm. 17 in Rilke: Die Sonette an Orpheus 1. Teil, XII; siehe Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II, 96f.
Einstimmung und Übersicht (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (00:00-05:02)
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
Alle singen zu Beginn den Kanon:
«Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden.»
Bruder David: «Ich danke euch allen fürs Kommen, also ich bin selber immer so dankbar, wenn ich hierher kommen darf, es ist ein Ort, auf den ich mich immer schon sehr freue. Es hat eine ganz eigene Schwingung hier; und ich bin dankbar für alle, die hier praktizieren, für alles, was hier aufgebaut wurde, und denke oft daran mit großer Dankbarkeit. Und ich freue mich auch ‒ ein unwahrscheinliches Geschenk des Lebens ‒, dass ich noch einmal hierher kommen kann, um mit euch zu teilen, und ich freue mich auch, über diesen Begriff der Würde ‒ der Menschenwürde ‒ mit euch nachdenken zu können. Das ist heutzutage etwas sehr Wichtiges, wie sich sicher auch zeigen wird.
Ich möchte in drei Schritten vorgehen heute Abend: Zuerst ‒ ein bisschen autobiographisch ‒ über die persönliche Erfahrung von Würde sprechen: Würde als Haltung. Zweitens dann, den Begriff zu klären versuchen.
Das Erste ist mehr ein bisschen emotional oder ganzheitlich, aber was mit Würde gemeint ist, auch intellektuell, begrifflich klar sehen, aus dem ergibt sich dann als dritter Schritt unsere gesellschaftliche Verantwortung.
Also Haltung und Klärung des Begriffes und gesellschaftliche Verantwortung.
Und wie immer, wenn wir hier zusammen sind, schlage ich vor, dass wir gemeinsam denken und uns nicht so zurücklegen und warten: Was wird er mir jetzt auftischen? Ich werde nichts auftischen, ich lade alle ein, gemeinsam zu denken und nicht nur mir zu folgen, sondern auch selber immer zu fragen: Stimmt das für mich? Es muss für jede und jeden einzelnen von Euch stimmen, und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir nachfragen: Haben wir aneinander vorbeigeredet? Wir müssen das jetzt wirklich gemeinsam erarbeiten.
Ich möchte Euch einladen, auch die Fragen gut vorzubereiten. Wir haben nach der Pause dann eine sehr gute Zeit für Fragen, und da kommt oft das Beste heraus.
Also jetzt ‒ wenn ich persönlich beginnen darf ‒, lade ich Euch zugleich ein, über Eure eigene Entwicklung und Euer Verständnis von Würde nachzudenken und Euch zu fragen, wie ihr selber zum Begriff der Würde gekommen seid. Mein Verständnis ist nur deshalb interessant, weil es eben ein Beispiel ist. Doch das Wichtige ist, dass ihr das Bewusstsein Eurer Würde für Euch selber findet.»
Würde im Eltern-Kind-Verhältnis (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (05:02-16:40)
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Bei mir ist mein Selbstverständnis ‒ meine Haltung von Würde ‒ aus zweierlei entstanden ‒ von Kindheit an: Es wurde mir bedingungslose Liebe erwiesen ‒ das eine ‒, und ich wurde unterstützt in meiner Eigenart.
Und wenn ich sage: bedingungslose Liebe, dann schließt das gleich ein, dass meine Eigenart nicht nur angenommen, sondern gefördert und unterstützt wurde: also nicht geliebt unter der Bedingung, dass du brav bist oder so was. Natürlich mussten wir brav sein, aber auch wenn wir zurechtgewiesen oder sogar bestraft wurden, so war das nie eine Ausschließung. Man hat immer gewusst, ich gehöre dazu, ich bin bedingungslos geliebt, ganz unabhängig davon.
Und diese beiden Erfahrungen von Kindheit an haben mein Verständnis von Würde bis jetzt geprägt. Und so werden wir sehen, dass diese beiden Aspekte von würdevoller Haltung sich überall durchziehen: die Zugehörigkeit und die Eigenständigkeit. Ich stelle es so dar, wie ich es selber erlebt habe, aber ich glaube, es hat schon einen gewissen Allgemeinheitswert.[1]
Wenn ich sage, dass ich in meiner Eigenart unterstützt wurde, hat das viel mit Vertrauen zu tun. Und das ist etwas Wichtiges für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, nämlich Vertrauen in einem doppelten Sinn:
Das Erste ist, dass die Eltern den Kindern gegenüber sich vertrauenswürdig erweisen. Sie ermöglichen dem Kind, den Eltern zu vertrauen, und das Kind lernt, den Eltern zu vertrauen. Das wird heute ziemlich klar gesehen.
Aber ein zweiter Aspekt dieses Vertrauensverhältnisses zwischen Kindern und Eltern wird heute sehr häufig übersehen, und das ist, dass die Eltern auch dem Kind Vertrauen schenken müssen.[2]
Wenn Kinder nur einseitig den Eltern vertrauen, wird das zu einer Betreuung der Kinder, ohne dass sie heranwachsen können. Beides muss zusammenkommen: Ich bin für dich da ‒ ich erweise mich vertrauenswürdig für das Kind ‒, und ich vertraue dir: du kannst es schon selber ‒ also eine Art loslassen ‒, immer wieder: du kannst es schon.[3]
Und beides wurde mir geschenkt, und das ist ein großes Geschenk, und wenn einem das in der Kindheit geschenkt wird, wächst man einfach in das Bewusstsein der Würde hinein ohne große Schwierigkeiten. Wenn einem das nicht geschenkt ist, muss man es natürlich später nachholen und darüber werden wir noch sprechen: Die Zugehörigkeit zu den Eltern, zur Familie, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr verfügbar, da muss man in andere, größere Zugehörigkeit hineinwachsen.[4]
Jetzt noch ein bisschen autobiographisch, wie meine Eigenart unterstützt wurde. Ich schäme mich ja fast schon dessen, aber im Sport war ich entsetzlich. Ich bin sehr gerne geschwommen, gewandert, auf Bäume gekraxelt, aber der Schulsport, Ballspiele ‒ ich habe immer befürchtet, dass mich der Ball trifft ‒, waren mir unsympathisch. Aber meine Mutter wollte, dass ich mich doch auch sportlich irgendwie betätige und da ist mir eingefallen, ich möchte fechten lernen ‒ Florettfechten, mein Sport. Meine Mutter hat eigens Nachhilfestunden gegeben, um das Geld zu verdienen für die Fechtschule. So habe ich jahrelang fechten gelernt und es hat mir großen Spass gemacht. Das ist so ein Beispiel.
Wieder zweierlei kommt da zusammen: Du hast Würde und du musst dich der Würde gemäß benehmen. Wieder zwei Teile, sehr nahe an: du bist bedingungslos geliebt und du wirst unterstützt in deiner Eigenart: Du hast Würde, das wurde uns selbstverständlich ‒ ohne dass jemand je das Wort Würde verwendet hätte ‒, beigebracht, sehr traditionell in meinem Fall: du bist ein Gotteskind ‒ das war ganz klar. Was für eine höhere Würde kann man haben, als ein Gotteskind zu sein?
Aber ‒ und jetzt kommt die andere Hälfte ‒, alle andern Menschen sind auch Gotteskinder. Also musst du dich den andern gegenüber auch würdig erweisen. Diese beiden Dinge kommen da zusammen: Noblesse oblige.
Wir haben das sehr, ohne dass es uns eingedrillt wurde, gefühlt, immer gefühlt. Den Benachteiligten gegenüber war ich immer sehr sensibel, und meine Brüder auch, und noch mehr wie ich. Mein mittlerer Bruder Hans, der kürzlich gestorben ist, ist einmal ohne Schuhe nach Hause gekommen, weil er einem Kind, das keine Schuhe gehabt hat, seine Schuhe gegeben hat. Also, das war nicht eingedrillt, das haben wir irgendwie eingesogen.
Einmal ‒ erinnere ich mich ‒, ist mein Vater sehr zornig geworden wegen mir, weil ich mich einem Bettler gegenüber nicht respektvoll benommen habe. Am Weg zur Kirche sind immer die Bettler gesessen ‒ für mich waren die nicht weniger wert als andere Menschen ‒, da waren so Klettenbüsche, das sind so Kugeln, die auf den Sträuchern wachsen und die so Hackerl (Häkchen) haben, und wir haben so Kletten auf diesen Bettler geworfen, der dort gesessen ist: da ist mein Vater sehr ärgerlich geworden, sehr zornig. Wir haben viele Angestellte gehabt, damals hatte man noch zu Hause Angestellte gehabt in der Familie, und wir hatten ein großes Kaffeehaus mit vielen Angestellten: wir mussten sie mit größtem Respekt behandeln.
Und ich erinnere mich, dass ich diese Haltung auch mir zu eigen gemacht habe. Und ich habe diesen Respekt in Situationen, wo andere ihn nicht gezeigt haben, selber gezeigt. Zum Beispiel: In Wien gibt’s den Prater, das ist so ein ständiger Jahrmarkt zur Belustigung, und eine von den Belustigungen war eine Liliput-Stadt ‒ so hat sie geheißen ‒, da waren so Zwerge, die haben dort in kleinen Häusern gewohnt zur Besichtigung, eigentlich zur Belustigung. Und meinen Brüdern Hans und Max, die jünger waren als ich, hat das irgendwie gefallen, aber mich hat das sehr beleidigt, ich wollte absolut nichts davon wissen. Mir war ziemlich klar: das geht nicht. Ich habe mich mit ihnen identifiziert.
Ein anderes Beispiel: Bei uns hatte es fahrende Werkleute gegeben, die herumgezogen sind und verschiedenes repariert haben. Und da hat es auch jemanden gegeben ‒ ausserordentlich kunstvoll sehe ich das jetzt im Nachhinein ‒, der zerbrochene Schüsseln mit Draht geflickt hat, ein Fastelbinder, wie es damals hieß: wenn eine Porzellanschüssel gebrochen ist, hat man sie nicht weggeworfen, sondern aufgehoben, und der hat dann so ein Netz gemacht aus Draht und hat sie wieder zusammengefügt und so repariert. Das war ein ganz armer Mann ‒ er hat immer im Stall geschlafen ‒, und einmal hat er mir die Hand geküsst … irgendwie auch beschämend … aus Ehrerweisung … ich wollte nicht über ihm stehen … sehr schmerzlich.»
_______________
[1] Im Frühling 2018 erschien vom Neurobiologen Gerald Hüther das Buch Würde, und im ersten Kamingespräch vom 11. Juli 2018 in Gespräche im Lehrgang «Geistliche Begleitung» (2018) bezieht sich Bruder David auf dieses Buch. Auffällig ist, wie beide Autoren die begriffliche, bzw. wissenschaftliche Seite von Würde engstens mit ihrer persönlichen, vom Gefühl geleiteten Erfahrung verbinden. Der biographische Rückblick ist für beide ebenso wichtig wie die allgemein verbindlichen Aussagen. Das kommt auch deutlich zum Ausdruck im Gespräch von Helmut von Loebell mit Bruder David im SN-Saal in Salzburg am 23. November 2018. Dieses Gespräch ist aufgezeichnet im YouTube Video Würde ‒ was wären wir ohne sie? Im Zusammenhang von Würde, Rückgrat, Scham spricht Bruder David immer auch vom Verlust von Würde ‒ Ehrfurcht ‒ Scham in der heutigen Gesellschaft.
[2] Ich bin durch dich so ich (2016), 18:
«Dieses Vertrauen wurde mir auf zweierlei Weise geschenkt. Einerseits, indem sich all mir Nahestehenden als vertrauenswürdig erwiesen haben. … Und das Zweite, was ebenso wichtig war, ist, dass man mir Vertrauen geschenkt hat. Das ist etwas ganz anderes. Ich war manchmal sogar erstaunt, was ich alles tun durfte, ohne überwacht und kontrolliert zu werden.
Zum Beispiel beim Spielen. Meine Brüder und ich durften schon als ziemlich kleine Kinder stundenlang alleine in den Wald gehen, den Bach hinauf wandern und Entdeckungsreisen machen. Ich glaube, dass meine Mutter damals mehr oder weniger gewusst hat, wo wir sind und dass wir nicht in Gefahr waren. Wir haben uns einerseits geborgen gefühlt, weil wir doch irgendwie wussten: Sie kümmert sich. Aber anderseits hat sie uns das Vertrauen geschenkt, so dass wir ziemlich frei waren. Vor allem später waren wir wochenlang unterwegs, und sie hatte keine Ahnung, wo wir waren, weil es damals noch nicht die Möglichkeit gab, einfach anzurufen und Bescheid zu geben. Sie hat uns jedoch dieses Vertrauen geschenkt, dass wir schon gegenseitig aufeinander aufpassen, also dass wir uns als vertrauensvoll erweisen und Vertrauen schenken. Für diese beiden Aspekte bin ich am meisten dankbar.»
[3] Dazu ergänzend in Sterben lernen (2005):
«Umsomehr gilt dies für persönliche Beziehungen. Sind wir aufrichtig mit jemandem befreundet, müssen wir diesen Freund immer wieder lassen, um ihm Freiheit zu geben, wie eine Mutter, die ihr Kind unablässig freigibt.
Gibt die Mutter das Kind nicht frei, kann es schon gar nicht geboren werden; es stirbt im Mutterleib. Aber auch nach der physischen Geburt, muss das Kind immer wieder freigegeben und losgelassen werden.
Viele Schwierigkeiten, die wir mit unseren Müttern haben, und die unsere Mütter mit uns haben, kommen daher, dass sie uns nicht gehen lassen können; und offensichtlich ist es viel schwieriger für eine Mutter, einem Teenager das Leben zu schenken als einem Baby.
Doch ist dieses Auf-Geben nicht auf Mütter beschränkt; wir müssen uns alle gegenseitig bemuttern, egal ob wir Männer oder Frauen sind. Ich denke, Bemuttern ist in dieser Hinsicht wie Sterben; es ist etwas, das wir unser ganzes Leben hindurch tun müssen. Und immer, wenn wir einen Menschen oder einen Gegenstand oder einen Standpunkt aufgeben, wahrhaft aufgeben, dann sterben wir - ja, aber wir sterben hinein in eine größere Lebendigkeit. Wir sterben hinein in die Einheit mit dem Leben. Nicht zu sterben, nicht aufzugeben heißt, dass wir uns von diesem freien Lebensstrom ausschließen.»
[4] Ein eindrückliches und berührendes Beispiel für den Mangel an Liebe und Geborgenheit in der Kindheit ist Helmut Loebell, der seine Kindheit in schonungsloser Offenheit in seinem Buch Der Stehaufmann (2016) beschreibt und im Video Würde ‒ was wären wir ohne sie? (2018); siehe auch Auszüge aus dem Buch und Übersicht über die Themen des Gesprächs
Würde in der Gesellschaft (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (16:40-22:27)
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Und im Allgemeinen bin ich noch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Mann sich seiner Würde bewusst war. Und ich sage ausdrücklich Mann ‒ Frau war ein ganz anderes Kapitel ‒, und Tiere erst recht. Aber man konnte noch fraglos an Würde appellieren: ‹Das ist doch nicht menschenwürdig› war das Schlimmste, was man sagen konnte.
Im Allgemeinen ‒ es hat sicher viele Ausnahmen gegeben ‒, hat die Gesellschaft ein Bewusstsein gehabt: So verhält man sich andern gegenüber und das gehört zur eigenen Würde. Das hat es gegeben, das gibt es heute nicht mehr.[1]
Man konnte, wenn man eine Reparatur gebraucht hat, sicher sein, dass der Mann, der repariert hat, sein Bestes tut, nicht immer erfolgreich, aber jedenfalls, dass er sich wirklich bemüht. Und heutzutage leider nicht, sondern sehr häufig kann man nur sicher sein, dass er sehr viel dafür verlangt, aber so schnell wie möglich etwas hingepfuscht hat.[2]
Und in dieser Gesellschaft hat jeder ‒ da kommen wir wieder zu diesem ursprünglichen Doppelaspekt ‒, gewusst: Ich habe meine Stellung ‒ das war eine pyramidale, ganz klar strukturierte Gesellschaft ‒, das ist meine Aufgabe im Leben, und ich gehöre dazu, denn diese Aufgabe ist mir aufgetragen, und ich mache sie so gut, wie ich kann. Und das hat Menschen Menschenwürde gegeben, die vom heutigen Standpunkt aus gar nicht in menschenwürdigen Verhältnissen gelebt haben.
Ein Onkel von mir hat in Kärnten einen großen Bauernhof gehabt und da waren viele Knechte und Mägde, und die waren eigentlich, was man heute Sklaven nennen würde: Sie haben das aber ganz anders erlebt. Sie mussten zum Beispiel fragen, ob sie heiraten dürfen. Und es war keine Selbstverständlichkeit, dass sie auch die Bewilligung bekommen ‒ also menschenunwürdig vom heutigen Standpunkt aus ‒, sie haben aber mit viel mehr Würde gelebt als die meisten Menschen heute leben, weil sie gewusst haben ‒ das war ihr Bewusstsein ‒, das ist meine Aufgabe im Leben, und ich erfülle sie gut und bin stolz darauf.
Also man kann sich kaum mehr hineindenken in diese Situation. Ich bin unersetzlich für das Ganze, das war das Bewusstsein jedes anständigen Menschen damals. Und ich gebe mein Bestes. Das gibt’s heute auch noch. Ich habe kürzlich in den Salzburger Nachrichten einen kleinen Aufsatz gefunden über eine Toilettenfrau, die einen jungen Mann einführt in ihre Arbeit. Vielleicht stand die Nachricht in der Zeitung, weil ausnahmsweise ein Mann diesen Beruf ausübt. Aber wie sie ihn eingeführt hat: eine solche Würdigkeit, wie diese Frau gezeigt hat, wie sie dem jungen Mann gesagt hat, was er alles tun kann für die Leute, mit völliger Selbstsicherheit: Ich weiß meinen Platz, das ist mein Beruf und den will ich so gut wie möglich ausüben. Also man hat wirkliche Ehrfurcht vor dieser Frau, wenn man diesen Beitrag gelesen hat.[3]
Oder ich habe auch von einem Baggerfahrer gehört, der sich so bemüht, der beste Baggerfahrer zu sein, dass er mit der Schaufel des Baggers ein Feuerzeug anzünden kann. Dieser Stolz! Er fährt viel und weiß, wie er auf den Millimeter genau diese Schaufel senken kann. Das gibt es heute noch: Menschen, die ihren Beruf gefunden haben und stolz sind: Das ist mein Beitrag für die Gesellschaft. Und darum geht’s.
______________
[1] Bruder David zu Beginn im Video Der Sinn des Lebens und die Dankbarkeit (2024) und die Mitschrift im Interview:
«Bruder David, Du wirst im Juli 2024 98 Jahre alt. Wenn Du auf die Entwicklung der Welt während deines Lebens zurückschaust: Was hat sich da geändert?»
«Das Wesentlichste, was sich verändert hat ist, dass die Ehrfurcht verloren gegangen ist. Ehrfurcht bedeutet, dass man vor dem Leben Achtung hat. In meiner Kindheit war diese Haltung fraglos, es war das Wasser, in dem wir als Fische geschwommen sind. Man hat damals auch wie selbstverständlich von ‹Gott› gesprochen und damit das gemeint, was uns als Menschen verbindet und wovor man Ehrfurcht hat. Ich bin nicht dafür, von Gott zu sprechen, das führt nur zu Missverständnissen.»
«Du bist 1926 in Wien geboren, wurdest im Zweiten Weltkrieg eingezogen, hast acht Monate gedient, bist dann untergetaucht – und sagst trotzdem: ‹In meiner Zeit gab es mehr Ehrfurcht vor dem Leben.› Ausgerechnet in der Zeit des Zweiten Weltkrieges?»
«Zusammengebrochen ist das erst im Laufe meines Lebens, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Hitler hat in jeder seiner Reden Gott erwähnt. Wir haben uns darüber geärgert, weil wir ihm gegenüber kritisch eingestellt waren, aber den Massen ist nicht aufgefallen, dass er das als Mittel verwendet. Wenn heute jemand in einer politischen Rede Gott erwähnte, würden sich die Leute nur wundern: Wovon redet der eigentlich?»
[2] Siehe auch Gespräche im Lehrgang «Geistliche Begleitung» (2018): Erstes Kamin-Gespräch mit Bruder David; transkribiert in Übersicht über das Gespräch mit Kurzvortrag von Bruder David und die Zusammenstellung von Texten, Videos und Audios zum Thema Würde in Würde, Rückgrat, Scham
[3] Siehe auch das Interview: Was gibt einer Toilettenfrau ihre Würde?
Würde lebt von Verbundenheit (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (22:27-37:25)
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Daraus ergeben sich jetzt Fragen für uns alle: Wie habe ich Zugang gefunden zu meinem Bewusstsein von Würde, wie habe ich es gelernt, was waren die Hindernisse, es zu lernen, was hat mir gefehlt, was hat es erleichtert, was hat es erschwert? Und das ist schon wichtig, dass jede und jeder von euch sich das überlegt: Was bedeutet mir Würde ganz persönlich? Wie erlebe ich sie?
Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, zur begrifflichen Klärung, die auch notwendig ist, und da ist wieder die Zugehörigkeit und der unbedingte Eigenwert. Beides kommt zusammen, also nicht bloss Zugehörigkeit oder Zugehörigkeit unter der Bedingung, dass man sich anpasst.
Nachdem diese beiden Dinge zusammengehören, müssen wir nachdenken über unsere eigene Zugehörigkeit und unsere eigene Eigenart. Denn ich habe bemerkt, dass ich selber, und offensichtlich sehr viele Menschen, gar nicht gründlich über diese beiden Dinge nachdenken. Es ist uns wirklich kaum bewusst, wie eng vernetzt wir sind.
Unsere Zugehörigkeit ‒‒ da ist so viel, was man lernen und worüber man nachdenken muss ‒, zum Beispiel: Wie stark die Familie, der wir angehören, eine Einheit ist, ohne dass wir es wollen, auch wenn sich alle zerstritten haben, und zwar nicht die Familie, die lebt, sondern auch, wie eng wir mit unsern Vorfahren verbunden sind: Wir sind einfach unsere Vorfahren um diese Zeit der Geschichte. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man das ein bisschen durchfühlt, alte Fotografien anschaut, dann wird einem das mehr bewusst.
Ich habe einmal eine Cousine von mir nicht erkannt, als ich in der Straßenbahn fuhr. Ich war damals sechszehn Jahre alt und sie hatte mich zuletzt gesehen im Alter von sechs Jahren. Ich schaute auf die Uhr und im Augenblick hat sie gewusst, wer ich bin: So hat nur mein Vater auf die Uhr geschaut.
Es ist unglaublich, wie eingebettet wir sind, und das geht weiter zurück bis zu unseren vormenschlichen Vorfahren. Die Wissenschaft sagt, dass wir alle nur von fünf oder sechs Urmüttern abstammen: Wir sind alle verwandt. Dieser Verbundenheit, der kann man mal schon nachfühlen.
Dann unsere Verbundenheit zur Erde. Das darf nicht so nur da oben im Gehirn bleiben, das muss erlebt werden: Wir essen Erde ‒ nur Erde, in verschiedenen Formen, aber es ist immer Erde; wenn es Rindsbraten ist, das ist Erde: zuerst einmal Klee, und der Klee wurde vom Rindvieh gefressen und verarbeitet und wir fressen das Rindvieh: Wir essen Erde und werden zu Erde. Wir sind Erde ‒ Wasser hauptsächlich ‒ und werden wieder zu Erde. Auch was wir täglich essen, ist Erde. Wir sollten uns einmal wirklich vor den Teller setzen vor dem Tisch und sagen: Erde. Manches ist direkt Erde, wie das Salz, anderes ist ein bisschen weiter entfernt, aber wir sind völlig in diesem Kreislauf drin.
Alles wäre anders, undenkbar anders, wenn ein kleines Stückchen der Geschichte anders gekommen wäre. Wenn die Römer nicht in die Schweiz gekommen wären, wie würde die Schweiz jetzt ausschauen? Wie würden Schweizer sich jetzt benehmen? Wir sind mit allem verbunden, was sich in der Geschichte je ereignet hat, dadurch, dass es uns beeinflusst. Wir schauen auf alte Gebäude: die haben Menschen gebaut und bewohnt, die uns beeinflussen, sonst wären wir nicht, wer wir sind.
Und wir sind auch physisch verbunden mit allen Menschen, die je gelebt haben. 1% der Luft, die wir atmen, ist Argon. Das ist ein Edelgas, das heißt, es geht keine Verbindungen ein. Der Prozentsatz bleibt mehr oder weniger gleich durch Jahrtausende. 1% der Luft ist ziemlich viel, eine unvorstellbare Menge von Argon Atomen, die wir mit jedem Atemzug einnehmen. So viele, dass statistisch gesprochen, du von jedem Menschen in der Geschichte ‒ Cicero und Cäsar, Wilhelm Tell, wenn er gelebt hat ‒ in jedem Atemzug mindestens ein Argon Atom einatmest, das auch Wilhelm Tell eingeatmet hat. Schon rein physisch sind wir verbunden mit der ganzen Geschichte. Wir gehören dazu, aber das muss man sich eben bewusst machen.[1]
Oder wir können uns jetzt anschauen, was wir an uns tragen an Kleidung. Wo kommt sie her? Wie viele tausende und abertausende Menschen haben daran gearbeitet, diese Baumwolle zu pflanzen, zu ernten, zu spinnen, zu transportieren, zu designen: Was da alles hineinkommt für jedes kleinste Kleidungsstück, das wir tragen. Durch jedes Kleidungsstück sind wir verbunden mit abertausenden von Menschen, deren Namen wir nie kennen werden, aber wir sind verbunden.
Mir fällt gerade ein, es gibt ein Kurzvideo auf YouTube,[2] wo Arbeiter, die Kakaobohnen ernten, zum ersten Mal mit Schokolade in Kontakt kommen. Diese Arbeiter haben keine Ahnung, was mit den Kakaobohnen, die sie ernten, geschieht. Zum ersten Mal bringt ihnen jemand ein Stück Schokolade und sagt ihnen, was aus ihren Kakaobohnen gemacht wird. Ganz berührend. Schon der Gesichtsausdruck: das sind arme Menschen, die schuften den ganzen Tag, und sie schmecken die Schokolade ‒ die haben uns ja die Schokolade gebracht ‒, wo kommt sie denn her? Wie oft denken wir daran, wenn wir Schokolade essen? Und so ist es mit jeder Speise. [3]
Und all die verborgenen Dienstleistungen: Kennen wir die Leute, die den Müll abführen? Nur wenn er nicht abgeführt wird, wird uns bewusst, dass da normalerweise jemand ist, der den Müll abführt, der die Strassen reinigt ‒ jetzt vom Schnee ‒, wieder tausende und hunderttausende Menschen, von denen wir abhängen. Die ganze Nacht muss jemand im Elektrizitätswerk arbeiten, damit der Strom normal fließt. Wir drehen das Licht auf: Wer denkt da schon, dass da noch jemand dahintersteht, und zwar wieder tausende und abertausende.
Also, wenn wir uns diese Zusammenhänge auch gefühlsmäßig vergegenwärtigen, dann wird uns unsere Vernetzung und Zugehörigkeit noch viel mehr bewusst, und das ist eben einer der beiden ganz wichtigen Bestandteile der Würde.
Und da kommt dann herein, dass wenn jemand ‒ auch in der Familie ‒ sagt, mir wurde nie bedingungslose Liebe erwiesen ‒ ich wurde immer geliebt, wenn ich gute Zeugnisse gebracht habe, das kann ich niemals nachholen ‒, das kann man nicht nachholen. Aber man kann das Bewusstsein der bedingungslosen Zugehörigkeit, das ja das Entscheidende ist, im Jetzt erleben, wenn man sich bewusst macht, wie wir alle vernetzt sind.
Die wichtigste Vernetzung ist die Ermunterung, die wir durch andere Menschen erfahren. Und wenn jemand sagt: Ermunterung? Ich erlebe nie eine Ermunterung ‒, da müsste man sich vorstellen, wie mein Leben ausschauen würde, wenn mich andere Leute nicht ermuntern würden. Nur schon ein Lächeln ermuntert die andern. Und eine Berührung.
Da hat man eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht ‒ sehr überzeugend ‒, in der die Studenten mit einer Karte in der Mensa bedient wurden. Und manche Studenten hat die Frau, die sie austeilte, ganz leicht berührt. Und andere hat sie nicht berührt. Statistisch relevant in der Befragung später konnten sich alle, die sie nicht berührt hat, kaum mehr an sie erinnern. Und jene, die sie berührt hat, erinnerten sich genau: ‹Das war eine sehr nette Frau›.
So können auch wir so viel beitragen zu dieser Vernetzung, wenn wir nur unser unbenütztes Lächeln auspacken, und uns am Abend fragen, wieviel unbenütztes Lächeln habe ich noch übrig: Wir sind auch vernetzt dadurch, dass Menschen sich gegenseitig ermuntern.[4]
Wenn wir diese Vernetzung wirklich erleben, dann wird uns auch unsere Beziehung zu den Tieren und zu den Pflanzen viel mehr bewusst. Erstens sind wir Tiere ‒ menschliche Tiere, da gibt’s einen wichtigen Unterschied, aber trotzdem, wir sind Tiere in jeder Hinsicht ‒, wie es die lateinische Definition ausdrückt: Der Mensch ist ein ‹animal rationale›, ‹ein vernunftbegabtes Tier›.
Also zur Würde gehört auch unsere Beziehung zu den Tieren und die Würde der Tiere: dass die Tiere auch zu dem Ganzen gehören und ganz eigenartig sind: jedes Tier ist eigenartig. An den Haustieren merkt man das, den andern ist man nicht nahe genug, um das zu bemerken. Aber was für Menschen gilt ‒ unsere Einzigartigkeit und Zugehörigkeit ‒, gilt auch für Tiere, mutatis mutandis, aber es gilt.»
______________
[1] Unsere Zukunft: das Reich des Kindes (1987): ‹Wo stehen wir?›:
«Und tatsächlich sagt uns die Wissenschaft, dass wir mit jedem Atemzug ganz kleine Spuren von Edelgas einatmen. Zum Beispiel macht das Argon 1% unserer Atemluft aus. Da es keine Verbindung eingeht, ist es von allem Anfang an in der Luft gewesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach atmen wir daher mit jedem Atemzug Argonatome ein, die Buddha eingeatmet hat, und Jesus und Moses. Auch in diesem Augenblick hat jeder von uns Atome in sich, die jeder große Mann und jede große Frau der Geschichte, an die Sie denken mögen, nach wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit einmal ebenfalls in sich hatten. So sind wir bereits physisch mit der ganzen Geschichte von Anfang bis Ende und mit jedem Ort der Erde verbunden.
Wir wissen darüberhinaus, dass unser Körper aus Sternenstaub gemacht ist, aus demselben Stoff also wie die Himmelskörper, die wir nur mit den stärksten Teleskopen überhaupt sehen können, die Sterne, die Millionen von Lichtjahren entfernt von uns sind. ‒ Die Materie war ursprünglich eins. Und so hängen wir schon über Raum und Zeit mit allem zusammen.»
[2] First taste of chocolate in Ivory Coast (2014) und Diese Kakao-Bauern essen zum ersten Mal in ihrem Leben Schokolade (2014)
[3] Dem Welthaushalt freudig dienen ‒ Spiritualität 2011
Spiritualität und Ökonomie: Pater Johannes und Bruder David im Dialog; siehe auch Achtsamkeit:
(46:09) Die Natur wieder achten lernen: Jede Pflanze hat ihren eigenen Engel ‒ Buddhistisches Tischgebet:
Bruder David: «Ein Wort, das du gerne verwendest, ist Sensibilität. Und diese Sensibilität zu steigern, das ist auch etwas, was zu der Spiritualität sehr dazugehört. Dass wir sensibel werden für das, was hinter den Dingen steht, dass man sieht: Woher kommen diese Dinge. Die Buddhisten haben so ein Tischgebet. Das beginnt mit den Worten: ‹Unzählige Arbeiten haben uns diese Speise gebracht: Wir sollten wissen, wie sie zu uns kommt. Unzählige Arbeiten waren notwendig, um uns diese Speise hier auf den Tisch zu stellen: Wir sollten wissen, wie sie zu uns kommt›. Das ist etwas, was mit dieser Sensibilität zu tun hat.»
[4] Dankbarkeit ‒ alles ist Gelegenheit (2013): Interview von Rudolf Walter mit Bruder David:
«Dankbarkeit ist ansteckend, das ist das Wunder: Ein dankbarer Mensch, der sich schon am frühen Morgen freut, einen neuen Tag vor sich zu haben, auch wenn das Wetter nicht gerade wünschenswert ist, wird freundlich in den Tag hineingehen, und wir wissen wie ansteckend Freundlichkeit ist. Ganz fremde Menschen, die einen anlächeln, können den ganzen Tag verändern. Wir können die Welt ändern dadurch, dass wir freudig ins Leben gehen. Freude macht uns lebendiger, kräftiger, verbindet uns mit den anderen.»
Würde und unsere Einzigartigkeit (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (37:25-45:52),
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Und deshalb muss unser Bewusstsein der Vernetztheit einschließlich, all-einschließlich sein. Und um diese Einschließlichkeit beizubehalten, müssen wir uns vor Gruppendruck hüten. Der Gruppendruck ist überall sehr stark, besonders, wenn wir ihn nicht bemerken, und drängt auf Ausschließlichkeit hin. Ich erinnere mich noch an das Plakat von Christoph Blocher vor einigen Jahren mit den weißen Schafen und einem schwarzen Schaf.[1] Ich erinnere mich noch, wie jemand bei einem Plakat über das Haxerl (Bein) des schwarzen Schafes ein Herzerl malte: Jemand, der auf seinen eigenen Füßen gestanden ist.
Und das gehört eben ganz wichtig zur Würde dazu: Wer Würde erlebt und Würde hat, ist unbestechlich, ist unverführbar. Zur Würde gehört: Ich weiß, was ich tue, ganz gleich, ob das andere tun oder nicht. Und da wirkt von Kindheit an der Gruppendruck sehr stark in die gegenteilige Richtung.[2]
Um es nochmals zusammenzufassen: Ich gehöre dazu zu dem Ganzen. Die Evolution hat mir ein Heim bereitet.[3] … Es ist etwas ganz Außergewöhnliches, dass unser Planet wie ein Heim vorbereitet ist, um uns zu empfangen. Und das Leben erhält mich am Leben.
Das Leben, diese geheimnisvolle Wirklichkeit: Wir sprechen so leicht über das Leben: ich habe mein Leben, ich nehme mir das Leben, ich kann mir das Leben nehmen.
Hast du wirklich das Leben, oder hat das Leben dich? Vielmehr: das Leben hat mich! Ich könnte keinen Augenblick überleben, wenn nicht das Leben mich am Leben erhielte.
Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt mein Herz klopfen lassen kann. 92 Jahre hat dieser Muskel sich immer wieder zusammengezogen. Gewöhnlich genügen 15 Minuten, wenn man einen Muskel anspannt, bis man völlig erschöpft ist. Und das Herz hat immer geschlagen.
Die Verdauung: Bitte verdauen sie jetzt ihr Frühstück. Nicht einmal die Biologen kennen alle die Namen von den tausenden Enzymen, die notwendig sind, um unsere Verdauung zu regeln. ‒ Das Leben erhält uns am Leben: also wir gehören zum Ganzen.[4]
Jetzt haben wir über die Zugehörigkeit nachgedacht, über die Eigenart könnten wir auch nachdenken: Nicht zwei Menschen, nicht einmal Zwillinge haben den gleichen Fingerabdruck. Das heißt aber auch, dass niemand einen Strauß Tulpen so gesehen hat ‒ vorher oder nachher in der Geschichte ‒, wie jede und jeder jetzt diese Tulpen sieht. Denn was wir da sehen, ist ja nicht nur Licht, das unsere Augen trifft: Sehen heißt, es erleben. Und erleben hängt davon ab, wer wir sind. Wir sind so verschieden voneinander, dass nicht zwei Menschen das gleiche erleben können. Das ist auch unser Beitrag zur Menschheitsgeschichte, dass wir das wirklich erleben.
Rilke sagt: ‹Wir sind die Bienen des Unsichtbaren, und wir heimsen den Nektar des Sichtbaren in die große goldene Honigwabe des Unsichtbaren›.[5] Das ist unsere Aufgabe im Leben. Und das mit allen Sinnen zu machen. Und jede und jeder von uns kann das nur ganz anders machen wie alle andern. Wir unterscheiden uns so voneinander.
Dann unsere einzigartigen Begabungen: Wir können uns fragen: Was mache ich gerne, was mache ich gut? Und das ein bisschen unterstreichen: das ist wichtig! Uns immer wieder fragen: Was mache ich gerne ‒, was mache ich ein bisschen besser? Wie kann ich mich selber übertreffen darin?
Und auch unsere Behinderungen, unsere Fehler: Unsere Behinderungen sind auch etwas, was zu unserer Einzigartigkeit beiträgt, und zwar positiv! Helen Keller (1880-1968): blind, taub, stumm, ist eine der großen Erzieherinnen der Menschheit geworden. Wenn sie nicht ganz früh taub und stumm geworden wäre, wäre sie wahrscheinlich auch eine große Frau geworden, aber es war durch ihre Behinderungen, dass sie diesen Beitrag zur Welt geleistet hat.[6]
Also zusammenfassend: Ich bin in das Geheimnis des Lebens eingebettet, engstens verschlungen, verwoben: wir können gar keinen genügend starken Ausdruck finden, wie eng wir in das Leben eingebunden sind.[7]
Und offensichtlich will das Leben mich so, als mich entfaltend in meiner Eigenart, weil: dieses so ist nicht statisch, es will mich so in meiner Eigenart, die bis zum letzten Augenblick noch nicht völlig entfaltet ist.
Rumi sagt: ‹Niemand wird meinen wirklichen Namen kennen› ‒ das heißt, niemand wird wissen, wer ich wirklich bin ‒, ‹bevor mein letzter Atemzug ausgegangen ist›, weil ich es selber nicht weiß; und alles das gilt auch von allen anderen Lebewesen.»
________________
[1] Sicherheit schaffen ‒ SVP-Plakat 2007
[2] Siehe auch Gespräche im Lehrgang «Geistliche Begleitung» (2018): Erstes Kamin-Gespräch mit Bruder David und die Übersicht über das Gespräch mit Kurzvortrag von Bruder David: Anm. 7, mit Zitaten aus dem Buch Würde (2018) von Gerald Hüther.
[3] Siehe den Video Wir sind daheim in dieser Welt (1975)
[4] Dankbarkeit ‒ alles ist Gelegenheit (2013): Interview von Rudolf Walter mit Bruder David:
«‹Das Selbst› ‒ das bin ich letztlich wirklich. Um das zu verstehen, ist ein Ansatzpunkt, zu fragen: Du lebst ‒ was heißt das? Unzählige Lebensprozesse gehen in deinem Körper vor sich. Wer kontrolliert die denn? Bist d u das? Kannst d u jetzt dein Frühstück verdauen? Versuch's einmal. Das musst du etwas anderem überlassen, eben dieser Kraft in dir, die du selbst bist und die du mit allen anderen teilst. Und die sich nicht trennen lässt von der Kraft, die Bäume wachsen lässt und den Regen sendet und die Erde um die Sonne kreisen lässt und die Sonne in ihrer Bahn führt: Das alles ist eine Kraft, die auch in dir wirkt.»
[5] Das Zitat von Rilke in Rühmen, Er-innern, Aufheben
[7] Auf dem Weg der Stille (2016), 72; siehe ausführlicher in Zugehörigkeit: Ergänzend: 2.:
«Aber das eine, was du nicht unterlassen solltest, ist, dass du dich fragst: ‹Wo ist mir schon einmal für den Bruchteil einer Sekunde aufgegangen, dass ich dazugehörte, und ich das bis in meine Knochen hinein empfand, und dass ich mit allem eins war und alles mit mir eins war›?
Das ist das Wesentliche, und das ist eine Art des Erkennens, und zwar die größtmögliche Art des Erkennens, die nicht auf Gedanken beschränkt ist, nicht auf Gefühle und nicht auf irgendeine andere Art des Erkennens. Und das ist Gemeinsam-Sinn (common sense) in der tiefsten Bedeutung dieses Wortes.
Es ist ein Wissen, das so tief geht, dass es in unseren Sinnen verkörpert ist und keine Grenzen seines Gemeinsam-Seins hat.
Darin ist alles beschlossen: Mittels deiner eigenen Glückseligkeit kennst du die Glückseligkeit von allem und jedem, was es in der Welt gibt, denn in diesem Augenblick der Glückseligkeit hast du sozusagen ans Herz der Welt ‒ die spirituelle Erkenntnis ‒ gerührt, an das Wissen, dass alles ‹zusammen sinnt› (commonsense knowledge).»
Die Würde des Menschen (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,[1]
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (45:52-56:16),
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Und da kommen wir zu einer Definition von Würde, da könnte man sagen: Würde ist der unbedingte Wert jedes einzelnen Menschen als Repräsentant des großen Geheimnisses; so stellt sich das große Geheimnis dar.
Und was meine ich mit Geheimnis? Das ist gar kein so geheimnisvoller Begriff, das lässt sich ganz klar sagen: Unter Geheimnis verstehen wir eine Wirklichkeit, die wir nicht begrifflich erfassen können, wohl aber durch ihre Wirkkraft auf uns verstehen können. Das große Geheimnis können wir verstehen, wenn es u n s ergreift.[2]
Bernhard von Clairvaux sagt: ‹Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.›[3] Und wir wissen alle zum Beispiel, dass man Musik nicht analytisch begreifen kann, aber man kann sie verstehen, wenn sie einen ergreift. Und das ist ein Beispiel vom großen Geheimnis, das uns ergreift und unsere Beziehung zu diesem großen Geheimnis.
Und wir sind Repräsentanten dieses großen Geheimnisses, denn wir sind uns selber ja Geheimnis. Wir können uns selber nicht ausloten: du kannst dich verstehen, aber nicht begreifen. Also bist du dir selber Geheimnis und die ganze Umwelt und die ganze Mitwelt.
Und vor diesem großen Geheimnis des Lebens tragen wir Verantwortung. Das gehört unbedingt zur Würde dazu. Wir haben unbedingten Wert, weil wir Repräsentanten dieses großen Geheimnisses sind, und haben davor Verantwortung. Da kommen alle andern Menschen, alle andern Bereiche dazu; diese Verantwortung lässt sich nicht trennen von der Würde. Wer Würde hat, der hat Verantwortung, ist sich verantwortungsbewusst.
Verantwortung bedeutet, dass wir so leben, dass wir jeden Augenblick ‒ idealerweise ‒ den Anruf des Lebens hören. Denn das Leben gibt uns jeden Augenblick etwas Neues, das kann man als einen Anruf verstehen, weil es auch etwas von uns will. Meistens ist es sehr angenehm: es will nur, dass wir uns daran freuen ‒ meistens ‒, hie und da auch sehr schwierige Dinge, und wir müssen antworten. Und das ist Verantwortung im letzten Sinn.
Der große russische Philosoph Ende des 19. Jh., Wladimir Solowjow,[4] spricht von drei Haltungen, die uns wirklich zu Menschen machen, und das hat sehr mit der Würde zu tun.[5]
Das Erste ist: Die Ehrfurcht vor dem großen Geheimnis. Wir erleben das meistens in unseren besten und lebendigsten Augenblicken, in unseren Gipfelerlebnissen, zugleich mit Furcht und Begeisterung. Wir sind zugleich angezogen und erschrocken in diesem Doppelereignis, wenn wir in einem großen Gewitter sind oder in den Bergen.[6] Diese Ehrfurcht ist nicht Furcht.[7]
Das Zweite, was uns zu Menschen macht ‒ gegenüber der Umwelt und Mitwelt ‒, ist Mitgefühl: ‹Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu›.[8]
Und das Dritte ‒ uns selbst gegenüber ‒, sagt Solowjow, ist Scham. Das ist ein erstaunliches Wort, das er hier verwendet: es schützt unsern Intimbereich. Es hat mit unserer Würde zu tun, indem ich mich schäme, mich unwürdig zu benehmen. Die Scham behütet meine Einzigartigkeit, während das Mitgefühl meine Zugehörigkeit betont. Und die Ehrfurcht ist die Grundlage für Mitgefühl und Scham.
In unserer Gesellschaft ist das Bewusstsein der Würde weitgehend verlorengegangen. Das sagen alle, die sich mit diesem Begriff der Würde beschäftigen, und warum? Es gibt sicher viele Gründe; einer, der mir in die Augen sticht, ist unsere Vereinzelung. Die Vereinzelung ist das Gegenteil vom Bewusstsein der Zugehörigkeit. Viele Menschen erleben das als Einsamkeit, man kann es aber in diesem Zusammenhang als etwas sehr Positives sehen: Wir haben unsere Eigenständigkeit gefunden: das war ungeheuer schwierig, dafür haben Generationen unserer Vorfahren viel bezahlt an Energie und Leid, dass wir nicht einfach Teile der Gesellschaft sind, sondern eigenständige Wesen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Aber wir haben das soweit getrieben, dass unsere Verbundenheit zu den andern verlorengegangen ist.
Und jetzt stehen wir vor dem nächsten Schritt, dass wir alles das Positive, das durch unsere Eigenständigkeit erworben wurde, mitnehmen und die Verbundenheit wieder erleben und diese Verbundenheit l e b e n. Das ist die große Aufgabe.
Das Ziel ist eine Gesellschaft, in der jeder Mensch gewürdigt wird, und zwar als Person, nicht als Nummer oder Fall.[9] Und Person ‒ das Wort kommt vom lateinischen Wort ‹persona›, der Maske, die die Schauspieler in Athen und Rom getragen haben, und heißt eigentlich ‹das Durchtönende›: ‹per-sonare› heißt durch-tönen.[10] Wir sind Person, weil durch uns das große Geheimnis sich ausdrückt und wir aufeinander horchen und das Geheimnis durchtönt durch uns.
Und C. F. Lewis schreibt einmal: Wenn wir wirklich einen andern Menschen sehen könnten mit offenen und gesunden Augen, wären wir so hingerissen, dass wir niederfallen würden und anbeten ‒ irgendeinen Menschen. Weil eben das große Geheimnis durch j e d e n Menschen durchtönt. Und das ist letztlich Grund unserer Würde.»
Am Schluss des Vortrags ermutigt Bruder David alle, die zuhörten, einen Entschluss und Vorsatz zu fassen, und «der Entschluss kann nicht kräftig genug sein, und der Vorsatz kann nicht spezifisch genug sein: d a s werde ich tun ‒, etwas ganz Kleines, zum Beispiel: Ich werde die andern anders anschauen und sie anlächeln.»
_______________
[1] Siehe diese Mitschrift auch in Würde, Rückgrat, Scham im Abschnitt: Ehrfurcht und Scham
[2] Siehe in Orientierung finden (2021): Geheimnis ‒ wenn uns die Wirklichkeit ‹ergreift›, 42
[3] Siehe auch Andreas Salcher im Gespräch mit Bruder David (2018), Anm. 6
[4] Wladimir Sergejewitsch Solowjow (1853-1900); ältere Schreibweise: Wladimir Sergejewitsch Solowjew
[5] Siehe Jean-Claude Wolf: Humanismus oder warum wir keine Tiere sind: Überlegungen im Ausgang von Wladimir Solowjew
[6] Orientierung finden (2021), 63; siehe auch Religiosität ‒ Staunen und Ehrfurcht:
«Rudolf Otto (1869-1937) hat die Begegnung mit dem Geheimnis unter dem Aspekt des ‹Heiligen› gründlich untersucht. Er beschreibt die beiden Gefühle, die das Heilige in uns auslöst, als «tremendum» ‒ das heißt, es lässt uns ehrfürchtig erschaudern ‒ und ‹fascinans› ‒ das heißt, es löst begeistertes Entzücken aus.»
[7] EHRFURCHT in: Das ABC der Schlüsselworte, im Buch: Orientierung finden (2021), 133:
«Nach allem, was wir über Furcht und Angst geschrieben haben, verlangt der zweite Teil dieses Wortes nach einer Erklärung. Die Ehrfurcht weigert sich ‒ denn Weigerung ist die Haltung der Furcht ‒, Ehre anzutasten. Ehrfurcht ist ein Erkennungsmerkmal eines spirituell wachen Menschen. Dieses Wachsein ist verlangt, um die Gegenwart des Geheimnisses zu spüren. Da das Geheimnis in allem, was uns begegnet, gegenwärtig ist, ist Ehrfurcht eine Lebenshaltung spiritueller Menschen. Diese Ehrfurcht zeigt sich in der Begegnung mit allen Lebewesen als Anerkennung der Würde, die ihnen zukommt. Von größter Bedeutung ist heute Ehrfurcht vor der Menschenwürde.»
[8] Diese Haltung ist auch als Goldene Regel bekannt, siehe Gespräche im Lehrgang «Geistliche Begleitung» (2018): Zweites Kamin-Gespräch mit Bruder David
(30:26) Wann ist Ethik ethisch? und Liebe ‒ die Antwort auf die Krisen unserer Zeit (2017)
[9] Ich bin durch Dich so ich (2016): ‹9 Doppelbereich ‒ 9. Dialog›, 188; siehe auch Sterben und Angst
«Wir wissen, dass es um den Tod herum sehr häufig Krankheiten, Leiden und Schmerzen gibt. Das allein genügt, mir Angst zu machen, wenn ich es mir ausmale. Hinzu kommt, dass man heutzutage früher oder später nur mehr ein Fall oder eine Nummer wird in einem Krankenhaus. Diese Entpersönlichung macht mir ebenfalls Angst. Aber das Leben macht uns, abgesehen von Alter und Sterben, immer wieder auf die eine oder andere Weise Angst. Wir brauchen Mut.»
[10] Die Rolle ist das Ich, der Schauspieler ist das Selbst (2011)
Zum Video: Das Ich als Maske und das Selbst ‒ kurzer Ausschnitt aus ‹Ich und Selbst› im Zentrum Buddhas Weg im Odenwald (DE); siehe auch Ich-Selbst: Ergänzend: 1.2.
Andreas Salcher im Gespräch mit Bruder David (2021)
Übersicht über die Themen des Gesprächs
zusammengestellt von Hans Businger
(02:17) Nach einleitenden Worten von Andreas Salcher[1] hören wir von Bruder David, dass die 80er Jahre die glücklichste Zeit in seinem Leben waren und er allen, die auch in dieses Alter kommen, Mut machen will für dieses Jahrzehnt. In den 90er Jahren spürt er das Altern Tag für Tag:
(03:56) Ich kann jedem Menschen nur empfehlen, sich an dem zu freuen, was es noch gibt und das ist immer noch sehr viel, wofür man dankbar sein kann. Und ich denke halt nicht an alt werden ‒ das ist für mich nicht ein angenehmer Begriff, ich denke an den Heimweg. Dieses Bild gefällt mir und spricht mich an: «Jede Traurigkeit des Menschen ist eigentlich Heimweh nach dem Himmel» (Léon Bloy); und was man sich dabei vorstellen kann ‒ man stellt sich besser nichts vor, weil wir eben nichts wissen ‒, aber die Idee von heimgehen ‒ man hört ja immer wieder dieses Wort ‹heimgegangen› ‒, ‹heimgehen›: was immer das bedeutet für einen, das gefällt mir. Das fühlt sich auch richtig an und positiv.
(05:24) Andreas Salcher fragt Bruder David, welche Aufgabe er in Argentinien wahrgenommen hat, und Bruder David teilt mit, wie seine Gastgeber Lizzie und Alberto Rizzo mit www.viviragradecidos.org die spanische Dankbar-leben-Webseite aufbauten mit der Intention, das Bewusstsein in der Gesellschaft zu verändern.
Die Gesellschaft in Argentinien ist total korrupt, das geben sie selber zu, und das einzige Mittel gegen Korruption ist das Bewusstsein der Menschenwürde. Wer das Bewusstsein der eigenen Würde hat, sagt: «Auch wenn es alle anderen machen, ich mache nicht mit.» Das brauchen wir.
Und das Bewusstsein der eigenen Würde wächst in einem Kind heran, wenn es bedingungslos angenommen ist in seiner Einzigartigkeit.
(08:49) Lizzie und Alberto Rizzo entwickelten im Anschluss an die Webseite das Ausbildungsprojekt Programa Presencia mit dem Ziel, die Lehrer glücklich zu machen, denn glückliche Lehrer werden glückliche Eltern und Kinder heranziehen. Hunderttausende von Studenten sind bereits ausgebildet von zehntausenden von Lehrern, die diese Ausbildung gemacht haben; das Projekt wächst in diesem riesigen Land weiter. Bruder David begleitet die Verantwortlichen täglich.[2]
(11:04) Andreas Salcher: Wie bringt man die Themen Herzensbildung[3], Achtsamkeit, Dankbarkeit[4] in ein Schulsystem hinein?
Bruder David: Mit gegenseitiger Dankbarkeit der Schüler und gegenseitigem Respekt aller gegenüber allen, wie es in Schule im Aufbruch in Deutschland bereits praktiziert wird; eine gründliche Ausbildung der Lehrer gehört dazu.
(12:57) Immer wieder innehalten, immer wieder schauen: was verlangt das Leben jetzt von mir? Was für eine Gelegenheit gibt mir jetzt das Leben? Und dann: tu’s! David ist tief berührt, wenn er auf Skype eine indigene Lehrerin trifft, die in einem ganz kleinen Winkel in den Anden mit Kindern den Dreischritt Stop ‒ Look ‒ Go übt.[5]
(13:51) Andreas Salcher stellt sein Projekt vor: Aufbruch zu einer LERNENDEN NATION für Österreich auf der Basis der 21st Century Skills, erweitert zu LERNENDE GEMEINDE.
(17:30) Bruder David: Was mir sehr gut gefällt an der Idee ist die Einschließlichkeit. Lernende Gemeinde sind wir alle, alle sind eingeladen. Ein Beispiel ist Findhorn, ein Kloster idealerweise.
(21:03) Es gilt in Analogie zu Klöstern das Ziel klar vor Augen haben, dass Strukturen und Vorgaben dem Freiraum dienen und nicht Selbstzweck sind.
(22:52) Lernen ist ein Wiedererinnern (Plato): Lernen bedeutet, aus sich heraus die eigenen Einsichten entfalten. Ein Lernen, das eintrichtert, ist kein Lernen. Lernen ist Selbstentfaltung, mit großer Betonung darauf, dass die einzelnen Talente und Schwächen, die auch zum Lernen dazugehören, sehr fruchtbar werden können. Um wirklich zu lernen, muss man einen Lehrer haben, der die Stärken und Schwächen eines Schülers kennt und ihnen gestattet, sich von innen her zu entfalten. Das kann natürlich nur in einem verhältnismäßig intimen Rahmen geschehen
(25:35) Andreas Salcher spricht von der Würde, die jeder Lehrende jedem Lernenden zuerst zusprechen muss, der Resonanzbeziehung (Hartmut Rose) zwischen ihnen und der Ignoranz der einfachen Wirklichkeit der Körper der Schüler: Ein ganz wichtiges Anliegen von Andreas Salcher ist, den Körper der Schüler einzubeziehen und nicht nur den Kopf. Bruder David erinnert sich an die lauten Schreie, wenn der Schulwart jeweils das Tor öffnete und an ein ganz anderes Erlebnis in Australien, an das gemeinsame Singen, und er erwähnt die Montessori Schulen und später auch die Waldorf Schulen.
(33:17) Die persönliche Beziehung zur Lehrperson ist grundlegend für das Lernen von Schülern. Das Gespräch geht auf die Hindernisse ein, dieses Ideal im Schulalltag zu verwirklichen.
(37:41) Wir hören, wie Bruder David seine Schulzeit erlebte und später mit Freude seinen Begabungen und Interessen ‒ seiner Berufung ‒ folgte.
(42:02) Bruder David: Da war ich selbständig, war auch von Haus aus dazu angeregt, selbständig zu sein ‒ auch das ist ein großes Geschenk ‒, und es ist uns geschenkt worden: meine Brüder und ich sind zu Hause bedingungslos geliebt worden, und es war uns erlaubt, unsere Eigenständigkeit zu entfalten. Wir durften ganz verschieden sein. Die Direktorin der Neulandschule hat einmal zu meiner Mutter gesagt, sie hätte noch nie drei Kinder von derselbe Familie gesehen, die so verschieden waren wie wir.
Bruder David erzählt, wie er die Treppen hoch in die Albertina ging und in die Nationalbibliothek. Er hat dort den Hohelied-Kommentar von Bernhard von Clairvaux (1090-1153) ausgeliehen, auf den ihn Pater Walter Schücker (1913-1977), ein Zisterzienser aus der Abtei Heiligenkreuz im Wienerwald aufmerksam gemacht hat, mit dem bedeutungsvollen Satz:
«Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.»[6]
Weisheit ist, wenn man das Leben nicht in den Griff bekommen will, sondern sich dem Leben stellt und mitspielt im Leben. Das kann jeder tun: jeden Augenblick einfach die Gewohnheit pflegen, hinzuhorchen: was will jetzt das Leben von mir? Und meistens ist es einfach, dass wir uns freuen. Wenn man sich zu Tisch setzt ‒ im Tischgebet sich erinnern, jetzt innezuhalten und bewusst zu tun, was das Leben von mir will: es will, dass ich mich an der Suppe freue.
(45:15) Andreas Salcher spricht von Menschen, die dieses Erfahrungslernen nicht kennen, die in ihrer Komfortzone gefangen sind und sich nicht auf Neues einlassen.
Bruder David: Wir brauchen Anregung, Kostproben ‒ Pater Walter hat uns zuerst Kostproben gegeben aus dem Kommentar zum Hohelied ‒, Ermutigung. Mich begeistert bis heute, wieviel in Büchern und im Internet zu finden ist zu Themen, die mich interessieren. Begeisterung bringt uns über unsere Komfortzone hinaus.
(47:34) Andreas Salcher: Ein Fünftel der Menschen können auch am Ende der Schule nicht sinnerfassend lesen oder sie können einfachste mathematische Operationen nicht durchführen.
Bruder David: Diese Schüler haben vielleicht ganz große Begabungen auf ganz anderen Gebieten.
Andreas Salcher macht sich große Sorgen, was man für Menschen tun kann, die dann keinen Job, keine Erfüllung, kein selbstbestimmtes Leben führen können.
(48:58) Bruder David teilt seine Sorgen: Man kann davon ausgehen, dass die meisten Elternhäuser nicht günstig sind für die Entwicklung der Schüler. Um so wichtiger ist es, dass die Lehrer das dann nachholen.
Und wenn jemand schon über die Schule hinaus ist, dann ist die schwierige Frage: Wo bekommt man noch dieses Selbstbewusstsein und dieses Bewusstsein der eigenen Würde?[7]
Wahrscheinlich ist es nur möglich, wenn ein Freund oder eine Freundin dieses Bewusstsein in dir weckt und dieses Zugehörigkeitsgefühl schenkt und zugleich die Freiheit, du selber zu sein, aber letztlich ist es das Leben, das uns dieses Bewusstsein immer wieder schenkt. Wir gehören zum Leben dazu, ob wir wollen oder nicht. Und uns bewusst zu machen, dass das Leben Ja zu uns sagt, obwohl wir ganz verschieden sind von allen andern.
(50:50) Andreas Salcher nennt ein weiteres Thema: Der Einfluss der Politik und die Trägheit der Schulsysteme; es gelingt bis heute nicht, die gültigen pädagogischen Erkenntnisse im Alltag umzusetzen. Bruder David ist mit ihm einig, dass Parteipolitik in der Führung von Schulen keinen Platz haben darf.
(56:34) Bruder David: Was ich gerne von Kindern immer wieder lernen möchte: einfach da zu sein, einfach gegenwärtig zu sein, einfach zu leben. Das können die Kinder. «Werdet wie die Kinder» verstehe ich auch so. Auch Lebensvertrauen können wir von den Kindern lernen ‒ ohne dass sie das Wort je gebrauchen würden.
Was ich den Kindern gerne weitergebe, und wofür sie auch sehr empfänglich sind, ist dieser Dreischritt Stop ‒ Look ‒ Go, ursprünglich der Merksatz für Kinder, die die Straße überqueren. Diesen Merksatz kann man auf alles anwenden: Innehalten, wenn man an Blumen, Bäumen und den Käfern vorbeigeht ‒, stehen bleiben und sich Zeit nehmen, diesen Käfer anzuschauen, dieses Blatt ‒, und sich daran freuen: das Go ist ja meistens die Freude dran.
Bruder David wünscht Andreas Salcher und seinen Mitarbeitern alles Gute für die anstehende Etappe, die Ziele ihres Projektes in die Praxis umzusetzen.
__________________
[1] Andreas Salcher: Die grosse Erschöpfung und die Quellen der Kraft (2022): «Meine persönliche Beziehung zu Bruder David», siehe Kapitel 11 + 12, 15:
«Im November 2021 durfte ich Bruder David wieder im Kloster Gut Aich treffen, um mir seinen Rat für mein Projekt ‹Österreichs Aufbruch zu einer lernenden Nation› zu holen. Er war mittlerweile 95 Jahre alt geworden, trotzdem geistig hellwach und rüstig genug, um mich und meinen Begleiter, den Kulturmanager Guido Reimitz, an der Klosterpforte zu empfangen. Gleich am Anfang erzählte er uns, dass die Achtziger die besten Jahre in seinem Leben waren. Seit den Neunzigern spüre er das Alter dann doch sehr, er versuche aber trotzdem noch, neugierig und dankbar zu sein. Ich weiß nicht, wie Bruder David es macht, aber nach unseren persönlichen Begegnungen empfinde ich einfach immer den Wunsch, ein etwas besserer Mensch zu werden.»
[2] Ebd. 15: «Während der Pandemie unterstützte er das Bildungsprojekt Presencia in Argentinien. Dessen Ziel bestand darin, glückliche Lehrer für das Schulsystem zu schaffen, weil glückliche Lehrerinnen und Lehrer in der Folge glückliche Kinder und Eltern bedeuten. Dieses Konzept hat so gut gegriffen, dass mittlerweile bereits Zehntausende argentinische Lehrpersonen entsprechend ausgebildet wurden und diese Geisteshaltung an ihren Schulen etablieren.»
[3] Ebd. 10: «Das Gegenteil von Dankbarkeit ist, alles als selbstverständlich zu betrachten»:
«Für den Theologen und Psychotherapeuten Arnold Mettnitzer verbindet ein einzigartiges anatomisches Phänomen den Kehlkopf, der unsere Stimme ertönen lässt, mit unserem Herz. Gewöhnlich nehmen alle vom Gehirn ausgehenden, sogenannten ‹effektiven› Nervenbahnen den kürzesten Weg hin zu jenen Muskelregionen, die eine bestimmte Bewegung ausführen sollen. Bei jenen Nerven jedoch, die die Bewegungen der Kehlkopfmuskulatur und damit den Klang der Stimme formen, gibt es einen Strang, der sonderbarerweise zunächst bis zum Herz verläuft und dann erst weiter zum Kehlkopf. Mettnitzer erkennt darin eine fantastische Chiffre der Natur: ohne Herz keine Stimme, kein Klang. In jedem durch den ausströmenden Luftzug erklingenden Ton, in jedem Klang der Stimme schwingt und wirkt unser Herz auf wundersame Weise mit.»
[4] Ebd. 3f.: «Die Weisheit des Benediktinermönchs David Steindl-Rast ‒ wie können wir für den aktuellen Zustand der Welt dankbar sein?»:
«Bruder David schlägt fünf kleine Gesten vor, die er selbst erprobt hat. Sie sind klein, aber gerade deshalb wirkungsvoll und sie können einen Welleneffekt auslösen, um der Gewalt entgegenzuwirken.
Alle Dankbarkeit drückt Vertrauen aus. Misstrauen wird ein Geschenk nicht einmal als Geschenk erkennen. Wer kann beweisen, dass es nicht ein Köder, eine Bestechung oder Falle ist? Dankbarkeit hat den Mut, zu vertrauen, und damit wird die Angst überwunden. Die ganze Luft wurde dieser Tage durch Ängstlichkeit aufgeladen, eine durch Politiker und Medien geförderte Ängstlichkeit. Hier liegt unsere größte Gefahr: Angst erhält Gewalt aufrecht. Biete allen Mut deines Herzens auf: Sag heute einem ängstlichen Menschen ein Wort, das ihm Mut gibt.»
[5] Ebd. 10f.: «Mit dem Dreischritt ‹Stop. Look. Go› unsere Sinne schärfen»:
«Innehalten, dann schauen, welche Gelegenheiten das Leben anbietet, und es dann wirklich tun, schlägt Bruder David vor. Es ist so leicht, sich unverzüglich mitten in irgendwas hineinzustürzen, das man sich vorgenommen hat, ohne bewusst damit zu beginnen. Jeder bewusste Anfang beginnt mit einem Innehalten, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist. Tun wir das nicht, werden wir einfach mitgerissen. Statt achtlos und eilig an Blumen oder Bäumen vorbeizugehen, sollten wir stehen bleiben, uns Zeit nehmen und uns daran erfreuen.
Der zweite Schritt ist das Hinschauen. Wenn wir nicht hinschauen, dann nützt uns auch das Anhalten nichts. Es heißt, der Narr macht immer wieder denselben Fehler, ein Weiser hingegen jedes Mal einen neuen. Wir können Fehler nicht gänzlich verhindern, aber wir können diejenigen vermeiden, die wir schon einmal begangen haben. Dummerweise neigen wir dazu, genau das zu übersehen, was wir nicht sehen wollen. Ehrliches Hinschauen kann gelernt werden.
Drittens müssen wir weitergehen. Es hilft uns nichts, anzuhalten, wenn wir nicht hinschauen, und es nützt nichts, hinzuschauen, wenn wir dann nicht auch gehen. Das ‹Go› ist die Freude daran. Und schlussendlich müssen wir handeln.
Dieser Dreischritt aus ‹Stop. Look. Go.› erlaubt uns, vertrauensvoll aufs Leben zuzugehen, mit dem Leben zusammenzuarbeiten, statt uns dagegen aufzulehnen»
[6] «Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise», ist Leit- und zugleich Schlüsselwort, auf das Bruder David immer wieder zurückkommt in seinen Vorträgen und Büchern; siehe Orientierung finden (2021), 42:
«Nur durch Ergriffenheit verstehen wir Musik, und auch das Geheimnis verstehen wir nur in Augenblicken von Ergriffenheit. Beides wird uns geschenkt: Wir müssen uns nur willig ergreifen lassen.
‹Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise›,
sagt der große mittelalterliche Mystiker Bernhard von Clairvaux (1090-1153). Weisheit ist das Ziel unsrer Bemühungen um Orientierung. Dabei wird es also letztlich um unsre Beziehung zum Geheimnis gehen.»
ERGRIFFENHEIT, in: Das ABC der Schlüsselworte, im Buch: Orientierung finden (2021), 135:
«Ergriffenheit ist zunächst ein Zustand, den wir fühlen.
Das schließt aber nicht aus, dass sie auch eine höchst wichtige intellektuelle Komponente hat.
Begreifen und ergriffen werden sind einander entgegengesetzte Bewegungen.
Wie Begriffe zum Begreifen führen, so führt Ergriffenheit zum Verstehen.
‹Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise›, schreibt Bernhard von Clairvaux (1090-1153) in seinem Kommentar zum Hohen Lied.
Ergriffenheit geht über das Begreifliche hinaus, indem sie auch das Unbegreifliche versteht.
Darin besteht Weisheit.
Ergriffenheit und Begreifen dürfen keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden.
Sie ergänzen einander, so wie Emotionen und Intellekt nur gemeinsam unsrer Welterfahrung gerecht werden.
Wo eine anti-intellektuelle Atmosphäre vorherrscht, besteht immer die Gefahr, klares Denken durch sentimentale Schwärmerei ersetzen zu wollen.
Ergriffenheit aber ist, auch wenn sie bis zum Gefühlssturm ansteigen kann, klar und nüchtern.»
[7] WÜRDE, in: Das ABC der Schlüsselworte, im Buch: Orientierung finden (2021), 164f.:
«‹Würde› ist mit dem Wort ‹Wert› wurzelverwandt. Dingen, die nur vereinzelt vorkommen, messen wir Seltenheitswert bei. Wer erkennt, dass jedes Ding, jedes Lebewesen, jedes Ereignis nicht nur selten, sondern einzigartig ist, wird sich der Würde bewusst, die allem, was es gibt, zukommt und wird ehrfürchtig durch das Leben gehen. Auch jedem Menschen steht diese Grundwürde zu. Wer dies erst einmal entdeckt, wird sich seiner eigenen Würde bewusst und weiß, dass sie nicht von der Anerkennung anderer abhängt. Ein solcher Mensch hat Rückgrat, geht aufrecht und weiß, was unter seiner Würde ist.»
Credo (2010)
Vortrag Wien von Bruder David,
zusammengestellt von Hans Businger
Herzlichen Dank für Ihre liebe Begrüssung … wir sollten einen Augenblick lang gute Energie all denen zuschicken, die gerne gekommen wären, und nicht kommen konnten. Der Abend soll der Vorstellung meines Buches dienen, meines neuen Buches ‹Credo, ein Glaube, der alle verbindet›, und das Buch ist die Frucht meines interreligiösen Dialoges, an dem ich seit mehreren Jahrzehnten teilnehmen darf. Bei dem Dialog ist mir aufgefallen, dass wir auf beiden Seiten immer wieder nur die zahmsten Texte unserer Tradition vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man auch einen Kerntext unserer Tradition, in dem sie sich ganz einmalig ausdrückt, den anderen so vorstellen können, dass man sich darüber versteht und darin versteht. Das wollte ich eben mit dem ‹Credo› tun [Leseprobe S. 16f.], das ja wirklich ein Herzstück der christlichen Tradition ist.
Da ist mir noch entgegengekommen, dass ich noch vor zwei oder drei Jahren im Kloster Melk mit S. H. dem Dalai Lama ein paar Tage gemeinsam verbringen durfte. Er hat da mit den Mönchen im Refektorium gegessen und er hat am Chorgebet der Mönche sogar teilgenommen, bei der Gelegenheit hat er zu mir gesagt ‒ ganz traurig eigentlich: Wir haben so viel gemeinsam, rein menschlich und als Mönche, aber was unsern Glauben betrifft, da sind wir so ganz verschieden. Da war ich schon vorbereitet und konnte ihm so schnell wie möglich und so kurz und prägnant wie möglich einiges darüber sagen, das hat ihm sehr gut gefallen, und da hat er gesagt: ‹Ja, aber da sollten Sie doch darüber schreiben›, worauf ich gesagt habe: ‹Das tue ich gerne, wenn Ihre Heiligkeit das Vorwort schreiben.› Und dazu hat er sich dann verpflichtet und so ist ein Dokument zustande gekommen, das in dieser Hinsicht einmalig ist, weil es einen christlichen Text aus christlicher Sicht behandelt und zugleich vom Oberhaupt oder einem der Oberhäupter einer ganz anderen Tradition das Vorwort enthält. Und darüber freue ich mich, und das ist ein gewisser Schritt vorwärts im interreligiösen Dialog.
Ich möchte das Buch aber so vorstellen, dass ich nicht Ihnen erzähle, was jetzt in dem Buch ist, sondern vielmehr das Verständnis dieses einen Glaubens, der alle verbindet, mit Ihnen durchbespreche und so Sie auf die Fragen vorbereite, die in diesem Buch besprochen werden, oder Sie darauf vorbereite, das Credo aus eigenen Stücken wieder durchzudenken und neu zu verstehen.
(03:38) Die Betonung liegt auf e i n Glaube, der alle verbindet ‒
nicht so, als ob die christliche Ausformung dieses Glaubens
der e i n e Glaube wäre, der alle verbindet ‒,
sondern es gibt einen rein menschlichen Urglauben,
der uns als Menschen alle verbindet:
alle verschiedenen religiösen Traditionen
u n d auch Menschen, die sich als Agnostiker
oder sogar als Atheisten bekennen:
Wir sind alle als Menschen durch einen tiefen Glauben verbunden,
und um diesen e i n e n Glauben geht es hier,
und den wollen wir hier gemeinsam durchdenken.[1]
Wir brauchen also nur unser Thema unter drei Gesichtspunkten in Angriff zu nehmen:
Also e i n Glaube, der a l l e verbindet:
Was heißt Glaube?
Wer sind a l l e?
Und wie können wir diese Verbundenheit erfahren, pflegen und vertiefen?
Das sind unsere drei Aufgaben an diesem Abend. Und ich bitte Sie, nicht nur mitzudenken, sondern nachzudenken: Es muss ein gemeinsames Unternehmen sein heute Abend, ich verlasse mich da auf Sie, nicht nur mitzudenken, sondern nachzudenken, und zwar einerseits ‹der Sprache nachdenken› ‒ das ist ein wunderschöner Ausdruck von Martin Heidegger (1889-1976),[2] er spricht davon: ‹der Sprache nachzudenken›: die Sprache legt uns geradezu einen Weg nahe, dem wir nachdenken können, dem wir nachgehen können, so werden wir immer wieder der Sprache nachgehen ‒, und das zweite ist Ihre eigene Erfahrung:
Ich muss mich immer wieder an Ihre Erfahrung wenden, Sie müssen Ihrer Erfahrung nachdenken, das ist nicht etwas, was da von außen an Sie herangebracht wird ‒ entweder es gefällt mir, oder es gefällt mir nicht ‒, sondern es ist ein Appell an Ihre Erfahrung, um die es hier geht.
(05:46) Also beginnen wir mit der ersten Frage:
Was heißt Glauben?
Natürlich müssen wir zunächst einmal Glauben von Für-wahr-halten unterscheiden: Wenn man sagt: Ich glaube, es wird morgen regnen, dann kann man das für wahr halten oder nicht, man kann sagen, wir werden einmal sehen, vielleicht regnet es, vielleicht regnet es nicht: da handelt sich um eine ganz andere Sprechweise, um eine ganz andere Wirklichkeit, als wenn man im Gottesdienst Credo sagt.
Credo, das lateinische Wort kommt von zwei Wurzeln her, das eine ist Cor, das ‹Herz›, und das andere ist ‹do›, ‹dare›: ‹ich gebe›, ‹ich schenke mein Herz›.
Wer also Credo sagt, der sagt nicht, ich glaube an etwas, was man glauben kann oder nicht glauben kann, es heißt: Ich drücke mein tiefstes Vertrauen aus, ich setze mein Herz auf das, was ich jetzt da aussprechen werde, ich verlasse mich vollkommen darauf, ich verlasse mich: das ist auch so ein wunderschöner Ausdruck in der deutschen Sprache, auf den wir dann später noch zurückkommen werden:
Ich verlasse mich darauf.
Und so können wir also, wenn wir unserer eigenen Erfahrung nachdenken wollen, damit beginnen uns zu fragen:
Worauf kann ich mich denn wirklich letztlich verlassen?
Das ist die Grundfrage, wenn es um den Glauben geht: Worauf kann ich mich letztlich verlassen? Worauf verlassen Sie sich?
(07:33) Da würde ich Ihnen eine Tatsache, eine Wirklichkeit vorschlagen, auf die wir uns wahrscheinlich einigen können, und wieder auf Ihre persönliche Erfahrung bezogen:
‹Es gibt mich.›
Das ist wahrscheinlich unleugbar für jeden von uns: ‹Es gibt mich›. Und wenn wir das nur durchdenken ‒ und darum geht es heute Abend ‒, wir werden immer wieder auf dieses ‹Es gibt mich› zurückkommen, auf diese drei Wörter: ‹Es› ‹gibt› ‹mich›: Wenn wir das wirklich tief durchdenken, dann haben wir schon den Zugang zu dem, was dieser Urglaube ist, um den es hier geht, dieser tiefste menschliche Glaube:
‹ES› ‒ was ist dieses ES, das m i c h gibt?
Das ES gibt alles: ES schneit, ES regnet, ES wächst, ES stirbt rund um mich:
Was ist dieses ES, das alles gibt?
Was ES nicht alles gibt?
Das ist schon der erste Ansatzpunkt: Wenn ich sage: ‹Es gibt mich›, dann habe ich damit schon ein Vertrauen ausgedrückt, ein tiefes Vertrauen auf diesen unergründlichen Urgrund, auf den wir hinweisen, wenn wir ES sagen.
Wir dürfen ihn einen göttlichen Urgrund nennen ‒ wenn wir dieses Wort verwenden wollen ‒, denn er ist eben unergründlich und es gibt davon mehr-und-immer-mehr[3] in allen Dimensionen, er ist unerschöpflich, unergründlich, dieser Urgrund.
(09:35) Das zweite im ‹Es gibt mich› ist das m i c h:
ich bin Teil einer unübersehbaren Vielfalt von Dingen:
alles, was es gibt.
Das ES weist auf das unmanifeste Göttliche hin, wie es im Hinduismus heißt, auf das Nichts, aus dem alles hervorkommt, aber nicht ein leeres Nichts, sondern ein mütterlicher Schoss, ein fruchtbarer Schoss des Nicht-etwas, aus dem alles, was etwas ist, hervorgeht.
Das können wir in Stille ‒ wenn wir wirklich in uns gehen ‒, nachfühlen und darauf können wir immer wieder von verschiedenen Seiten zurückkommen.
Aber da haben wir einerseits das ES, diesen unergründlichen Urgrund, da haben wir das m i c h, das Teil von allem ist, unabgrenzbar: Wir können uns unterscheiden, aber wir können uns nicht trennen von allem, was es gibt. Wir gehören allem an; darauf kommen wir dann noch bei der zweiten Frage zurück.
(10:52) Das dritte ist das Geben: Wir finden uns umgeben von einer unausschöpflichen Lebendigkeit ‒ und die lebt auch in uns ‒, die ebenso unergründlich ist wie das ES, das alles gibt, wie die Vielfalt, die uns umgibt,
das ist jetzt die dynamische Wirklichkeit:
diese Lebendigkeit,
die in uns ist.
Wir brauchen uns ja nur zu fragen: Habe ich das Leben ‒ so wie wir meistens denken: ich verliere mein Leben, ich bewahre mein Leben ‒, oder hat das Leben uns?
Und wenn wir uns darauf einlassen und die Frage wirklich zutiefst stellen, dann finden wir, dass es viel richtiger ist zu sagen, dass das Leben uns hat, denn rein physisch gehen so viele Lebensprozesse in uns vor, über die wir überhaupt keine Kontrolle haben. Wenn Sie ihr Abendessen schon gegessen haben, dann verdauen Sie es jetzt! Und wenn Ihnen jemand die Aufgabe stellen würde: Also verdau jetzt einmal dein Abendessen, dann wären wir völlig verloren. Wie machen wir das? ES tut es, unser Körper tut es. Wir haben keine Ahnung. Unzählige chemische Vorgänge müssen da vorgehen, das Leben weiß genau, wie es das tut, aber wir kennen nicht einmal die wenigsten Namen von all diesen Vorgängen, die sich da in uns ereignen. Und so ist es mit allem, nicht nur mit dem physischen: Das Leben hat uns mindestens ebenso sehr, wie wir das Leben haben:
diese unerschöpfliche Lebendigkeit.
(12:46) Unter diesen drei Gesichtspunkten: ‹ES gibt mich›: der unergründliche Urgrund, die unüberschaubare Vielfalt, die unerschöpfliche Lebendigkeit: unter diesen drei Gesichtspunkten können wir jetzt sagen, was wir mit Glauben meinen: Einerseits sich auf die Verlässlichkeit verlassen.
Wenn wir sagen
‹ES gibt mich›,
und es wirklich ernst meinen,
dann verlassen wir uns auf dieses ES,
das uns jeden Augenblick gibt.
Und wir vertrauen ja darauf,
dass es mich nicht nur jetzt gibt,
sondern auch im nächsten Augenblick geben wird.
Aber im nächsten Augenblick
gibt es mich sozusagen wieder.
Es gibt mich nicht ein für alle Male: In jedem Augenblick wird uns die Wirklichkeit neu geschenkt. Und darauf verlassen wir uns, wenn wir sagen: ‹Es gibt mich›. Darauf verlassen wir uns im Leben. Das ist schon ein Aspekt dieses Urglaubens, den wir mit allen Menschen gemeinsam haben.
(13:58) Wenn wir von der unzähligen Vielfalt von allem, was es gibt, sprechen, dann ist der Glaube die ehrfürchtige Beziehung zu allem, was es gibt.
Die ehrfürchtige Beziehung, denn
‹ES gibt m i c h›
und ES gibt auch alles andere,
da sind wir also alle irgendwie verwandt.
Und die Beziehung wird dadurch ehrfürchtig zu allen anderen.
Der Glaube, dieses Vertrauen, äußert sich in einer ehrfürchtigen Beziehung zu allem anderen, und nicht nur zu allem anderen, was ES mit uns gibt, sondern auch einer ehrfürchtigen, liebenden Beziehung zu dem ES, das mich gibt. Und das ist ungeheuer wichtig.
Ich bin ein Teil von allem, was ES gibt, aber ich bin der Teil, der darüber nachdenken kann, dass ES mich gibt, und der daher zu dem ES, das alles gibt, eine persönliche Beziehung haben kann.[4]
Wenn ich Ich sage, so setzt das ein Du voraus. Ferdinand Ebner (1882-1931), der hier in Wien gelebt hat, zur Zeit von Martin Buber (1878-1965), und ein bisschen früher über dieselben Dinge geschrieben hat, und Martin Buber, dessen Bücher viel mehr bekannt sind, die haben beide diese Beziehung zwischen dem Ich und Du tief durchgedacht und haben das ausgedrückt, was der englische Dichter E. E. Cummings mit dem wunderschönen Satz sagt:
‹Ich bin durch Dich so ich.›[5]
Nicht: ich bin durch Dich so schön, ich bin durch Dich so liebend, ich bin durch Dich, was immer es sein möge, sondern: ‹ich bin durch Dich so ich›.[6]
Nur weil ES Dich gibt, gibt es mich. Und das sagt er zunächst in einem Liebesgedicht, aber hinter den Liebenden steht ja immer noch das ES, das den Liebenden gibt, denn es gibt nicht nur mich, es gibt auch den Liebenden.
Und so ist dieses ‹Ich bin durch Dich so ich›,
das wir zu unserem Geliebten sagen, zugleich
‒ in letzter Hinsicht ‒, auf das ES, das alles gibt, gerichtet.
So können wir also im Glauben eine ehrfürchtige, liebende Beziehung zu diesem Urgrund haben, aus dem alles hervorkommt.
(16:42) Und schliesslich
in Bezug auf die unerschöpfliche Lebendigkeit,
ist der Glaube dankbares Leben.
Das heißt einfach, mit dem Gegebenen, mit allem, was uns geschenkt ist, etwas tun. So zeigt sich ja die Dankbarkeit: Wenn Sie eine Familie von Freunden besuchen, die Kinder haben, Sie den Kindern Spielzeug mitbringen, und die Kinder sagen: Danke, und legen es hin und spielen mit etwas anderem, dann werden Sie vielleicht sagen: Die sind wirklich wohl erzogen, aber Sie werden nicht sagen: Die waren sehr dankbar. Aber wenn die Kinder überhaupt nicht Danke sagen, sondern nur das Spielzeug nehmen und den ganzen Nachmittag damit spielen, dann werden Sie nachher sagen: Die waren aber wirklich dankbar für dieses Geschenk.
Uns so erweisen auch wir uns dankbar, nicht nur, und nicht in erster Linie, indem wir Danke sagen für alles, was uns geschenkt ist, sondern indem wir etwas tun mit allem, was uns gegeben ist.
In jeder Situation, die eine gegebene Situation ist,
wie alle Situationen in einer gegebenen Welt,
in einer gegebenen Zeit, unter gegebenen Umständen,
ist die einzig passende Antwort Dankbarkeit.
Denn alles ist gegeben. Und die Dankbarkeit zeigt sich dadurch, dass wir mit dem Gegebenen etwas machen, etwas aus uns selber machen, denn wir sind uns ja geschenkt. Wir haben uns nicht erkauft, wir haben uns nicht verdient, manchmal wollen wir uns auch gar nicht: Ob wir es wollen oder nicht, wir sind uns geschenkt, wir sind uns gegeben, und aus uns selber können wir etwas machen. Das ist die große Möglichkeit.
So ist also Glaube
unter diesen drei Gesichtspunkten ‹ES› ‒ ‹gibt› ‒ ‹mich›:
das Sich-verlassen auf die Verlässlichkeit,
die ehrfürchtige Beziehung zu den anderen und zu dem Urgrund,
und dankbares Leben: mit dem Gegebenen etwas tun.
Das ist vorläufig unsere Antwort auf die Frage: Was meinen wir mit diesem Glauben, diesem Urglauben? Und den teilen wir mit allen Menschen.
(19:03) Und jetzt fragen wir uns eben, das ist die zweite Frage:
Wer sind a l l e?
Und die Antwort darauf ist:
Alle, die ES gibt.
Das sind nicht nur alle Menschen, denn ES gibt Tiere, ES gibt Pflanzen, ES gibt Mineralien und ES gibt das ganze Universum, das sind alle. Und die teilen auch unseren Glauben in gewisser Hinsicht schon deshalb, weil wir uns eben nicht von ihnen trennen können. Alles hängt mit allem zusammen und wir sind untrennlich mit dem ganzen Universum verbunden. Aber nicht nur mit dem physischen Universum, sondern mit allen Denkrichtungen ‒ die gibt ES ja auch ‒, mit allen Werten ‒ die gibt es ja auch ‒, und mit allen Religionen, die ES gibt.
ES gibt diese vielen Religionen:
Wenn ES diese vielen Religionen gibt, dann gehören die auch zu dem, was im Glauben mitschwingt, was im Glauben mitempfangen wird, oder worauf wir uns im Glauben verlassen.
‹ES gibt mich, ES gibt alles›,
und das ist der Glaube, der alle verbindet.
Und das macht diesen Glauben, diese innere Geste des sich Verlassens, richtig religiös. Religiös in dem Sinne von ‹religio›, von dem lateinischen Wort ‹religio›, da denken wir wieder der Sprache nach: ‹re-ligare› heißt ‹wieder-verbinden›: etwas, was zerrissen oder zerbrochen oder getrennt war, wiederverbinden. Und dieser Glaube verbindet uns wieder mit uns selbst ‒ mit unserem tiefsten Selbst ‒, er verbindet uns mit allen anderen, und er verbindet uns mit diesem Urgrund, mit dem ES, diesem Geheimnis, aus dem alles hervorgeht und zu dem alles zurückgeht.
Allen bin ich durch diesen Urglauben verbunden,
allen und allem, was es gibt.
(21:18) Und jetzt können wir uns der dritten Frage ‒ und der wichtigsten Frage in unserem Abend ‒, zuwenden, und das ist die Frage:
Wie können wir diese Verbundenheit erfahren, pflegen und vertiefen?
Da würde ich Ihnen einige Schritte vorschlagen, und der erste Schritt ist:
Die furchtlose Begegnung mit anderen.
Immer wieder begegne ich Menschen, die dieses interreligiöse Gespräch völlig ablehnen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich mit anderen noch nie im Kontakt waren, sie sind sehr abgeschlossen. Und dann begegne ich Menschen, die entweder im interreligiösen Gespräch schon tief drinnen stehen, die verstehen, dass der Glaube alle verbindet, oder die es auch verstehen ohne drinnen zu stehen, das sind immer wieder Menschen, die sich furchtlos anderen öffnen und auch mit anderen Kontakt haben.
Je mehr Kontakt wir mit anderen haben, um so offener sind wir für das Verständnis, dass wir mit allen verbunden sind. Nur die Furcht hält uns davon ab. Daher auch zum Beispiel in der Bibel:
Das Gebot, das am häufigsten wiederholt wird, ist ja nicht, wie man meint, ‹Liebe deinen Nächsten›, das kommt nur ein-, zwei Mal vor, sondern:
Jeder Engel, der erscheint in der Bibel sagt zunächst einmal: ‹Fürchte dich nicht›. Das heißt nicht: ‹Fürchte dich nicht›, ich bin ja nur ein Engel. Wenn uns ein Engel erscheint, müsste man uns auch sagen: ‹Fürchte dich nicht›, aber es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, dass Engel Boten sind, Angelus heißt ja der Bote. Und der Bote sagt immer das Wichtigste zuerst. Und so sagt der Bote immer: ‹Fürchte dich nicht›: dann ist schon alles, das Wichtigste ist damit schon gesagt. Immer wieder kommt dieses Wort. Wenn wir uns nicht fürchten, dann sind wir offen für diese furchtlose Begegnung mit anderen.
(23:32) Das Gegenteil von Glauben, der Gegenpol zum Glauben ist ja nicht Ungläubigkeit oder Häresie, das Gegenstück ist Furcht: Angst,[7] Furchtsamkeit, das ist das Gegenteil von Glauben.
Glauben ist das tapfere Vertrauen, die tapfere innere Geste des Sich-verlassens.
Also Furchtlosigkeit in der Begegnung mit anderen, das ist der erste Schritt, die Voraussetzung könnte man sagen, für das Erfahren unserer Verbundenheit mit allem.
(24:13) Einen zweiten Punkt würde ich auch noch vorschlagen, und das ist Stille. Das ist sehr schwer zu finden. Ich war sehr erfreut zu hören, dass es hier im Kardinal König Haus einen Bereich gibt, der heißt: ‹Stille in Wien›.
Da kann man
Stille finden
inmitten dieser Großstadt. Aber es geht ja nicht nur um den Lärm, den die Stadt macht, es geht weit mehr um den Lärm, den wir selber innerlich ständig erzeugen; um unsere innere Unruhe und die zu überwinden.
Hie und da im Laufe des Tages wenigstens einmal irgendwo einen Augenblick der Stille einzufügen, das wäre schon ein großer Schritt auf dieses Erlebnis der Verbundenheit hin, Verbundenheit mit allem. Denn die Stille erlaubt uns, in die Tiefe zu gehen und dort unsere Verbundenheit wirklich zu erleben. An der Oberfläche erleben wir die nicht. Stille wäre etwas Wichtiges.
(25:22) Und ein drittes:
ein Verständnis für dichterische Sprache pflegen.
Das wird Sie vielleicht überraschen, dass ich das hier hereinbringe, aber das ist ganz ungeheuer wichtig.
Ein Haupthindernis für das Verständnis unter den Religionen ist, dass dichterische Sprache wörtlich genommen wird. Und alle religiösen Traditionen haben so Gewichtiges zu sagen, dass sie es nur in dichterischer Sprache ausdrücken können.
Wenn wir selber ganz Gewichtiges zu sagen haben, was uns wirklich am Herzen liegt, dann werden wir selber dichterisch und sagen: ‹Ich schenke dir mein Herz›, zum Beispiel. Aber kein Mensch wird das wörtlich nehmen und an Herzchirurgie denken. Es handelt sich um eine viel größere Wahrheit, um eine viel tiefere Wahrheit, wie jemand sehr treffend gesagt hat über die Bibel, aber man könnte das über alle heiligen Bücher der Welt sagen:
‹Ich habe die Wahl, die Bibel ernst zu nehmen oder wörtlich.
Und ich habe mich dafür entschieden, sie ernst zu nehmen.›[8]
Wörtlich kann man Dichtung nicht nehmen.
Und so trägt zum Glauben, der uns alle verbindet, zum tieferen Verständnis der anderen, zu einer Auslotung und Pflege dieser Verbundenheit mit anderen, das Verständnis für Dichtung sehr viel bei.
Ich würde zum Beispiel, um Ihnen ein Beispiel zu geben, sagen:
‹ES gibt mich› ‒
da kommen wir wieder auf dieses ‹ES gibt mich› zurück ‒, das ist ja auch letztlich dichterisch, ganz anders als zu sagen: ‹Ich bin da› ‒ in ‹ES gibt mich› ist viel mehr drinnen:
‹Es gibt mich› ist schon ein Ansatz für die Schöpfungsgeschichte, eine Schöpfungsgeschichte liegt schon da drinnen, noch gar nicht in Bilder ausgeformt, aber wunderschön, ansatzweise wunderschön da.
(27:54) Wenn wir darauf hinhorchen können, wenn wir auf solche Bilder eingestellt sind, dann können wir auch die Bildersprache der verschiedenen Traditionen verstehen.
Zum Beispiel über das ES, das es gibt, ein Rilke Gedicht. Viele von Ihnen kennen es vielleicht, aber es ist der Mühe wert, es uns noch einmal anzuhören. Es ist aus dem Stunden-Buch von Rilke, und es ist ein Gebet durch das er sich an Gott wendet, wie so viele der Gedichte im Stunden-Buch.[9]
‹Du Dunkelheit, aus der ich stamme›: das ist das ES, die Dunkelheit, aus der ich stamme:
‹DU Dunkelheit, aus der ich stamme,
ich liebe dich mehr als die Flamme,
welche die Welt begrenzt,
indem sie glänzt
für irgend einen Kreis,
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß.
Aber die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Tiere und mich,
wie sie's errafft,
Menschen und Mächte ‒
Und es kann sein: eine große Kraft
rührt sich in meiner Nachbarschaft.
Ich glaube an Nächte.›
‹Ich glaube an Nächte›: das ist der Glaube an das ES, und das ist dichterisch ganz neu und ganz anders ausgedrückt, aber: ‹Ich glaube an Nächte›, ich glaube an die Dunkelheit, die alles zusammenhält, an die Einheit:
‹Ich glaube an Nächte.›
(29:46) Tersteegen in seinem berühmten Lied ‹Gott ist gegenwärtig›, hat diese wunderschönen Zeilen,[10] er nennt Gott
‹Aller Dinge Grund und Leben,
Meer ohn Grund und Ende,
Wunder aller Wunder:
Ich senk mich in dich hinunter.›
Da ist wieder die Stille, das Geheimnis: ‹Ich senk mich in dich hinunter›, das ist das: ich verlasse mich auf Dich auf diese Weise.
Und aus diesem Grund, aus diesem Schoss des Nichts, aus diesem ES, kommt a l l e s hervor: all die Vielfalt, die ganze Vielfalt kommt aus dieser Einheit hervor, quillt hervor.
(30:54) Ich habe das folgende Gedicht nur in einer Übersetzung aus dem Englischen gefunden, die natürlich dem Original nicht gerecht wird: Es wurde ja sogar Dichtung definiert als das, was verloren geht, wenn man sie übersetzt, aber doch, es ist ein so schönes Gedicht von Gerald Manley Hopkins, einem großen englischen Dichter, einem Jesuiten aus dem 19. Jh.. Die Übersetzung gibt schon ein bisschen noch etwas davon wieder, genug um sie Ihnen vorzulesen. Das Gedicht sagt: ‹Ehre sei Gott für gesprenkelte Dinge› ‒
‹Gescheckte Schönheit› [Piet Beauty]
heißt das Gedicht:[11]
‹Ehre sei Gott für gesprenkelte Dinge›, und dann zählt er alle diese hunderttausend Dinge, versucht sie zu aufzuzählen und ein Gefühl dafür zu geben:
‹Ehre sei Gott für gesprenkelte Dinge –
für Himmel, zwiefaltig wie eine gefleckte Kuh;
für rosige Male hingetupft auf schwimmende Forellen;
Kastanienfall wie frische Feuerkohlen; Finkenflügel;
Flur, gestückt und in Flicken ‒ Feldrain, Brache und Acker;
und alles Gewerbe mit ihrem Gewand und Geschirr und Gerät.
Alle Dinge, verquer, ureigen, selten, wunderlich;
was immer veränderlich ist, scheckig (wer weiß, wie?);
mit schnell, langsam; süß, sauer; blitzend, trüb;
zeugt Er hervor, dessen Schönheit sich niemals wandelt:
Preis ihn.›
Alles das zeugt dieses ES hervor, weil ‹ES alles gibt›:
‹Alle Dinge, verquer, ureigen, selten, wunderlich;
was immer veränderlich ist, scheckig (wer weiß, wie?);
zeugt er hervor, dessen Schönheit wandellos ist.›
Für die unter Ihnen, die sich für theologische Feinheiten interessieren, ist es ganz wunderbar, dass Gerard Manley Hopkins, der auch ein großer Theologe war, hier sagt:
‹Er zeugt es hervor›, im Englischen: ‹his fathers forth›, denn Thomas von Aquin sagt, dass der Akt, in dem Gott das ewige Wort spricht: das eine, den Logos, derselbe Akt ist, in dem Gott die Welt erschafft.[12]
Gott ist zu einfach, um zwei Akte zu haben: In e i n e m Schwung kommt aus dem Nichts, dem trächtigen Nichts, dem schwangeren Nichts des göttlichen ES, alles hervor. Das ist der Logos und die ganze Schöpfung in einem Schwung.
So drückt also Dichtung, wenn wir uns darauf einstellen, vieles aus, was wir sonst ja gar nicht ausdrücken können.
(34:15) Jetzt haben wir über die Dunkelheit gesprochen, wir haben über die Vielfalt gesprochen ‒ vielleicht noch ‒, erinnern wir uns an ein sehr berühmtes Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer: ‹Der römische Brunnen›: da ist diese Dynamik drinnen:[13]
‹Auf steigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.›
Sicher steht das Bild der Dreifaltigkeit dahinter. Es steht ja auch in ‹ES› ‒ ‹gibt› ‒ ‹mich› dahinter.
(35:08) Und nach: ‹Furchtlose Begegnung mit anderen›, ‹Stille›, ‹Verständnis für dichterische Sprache›, würde ich hier auch noch vorschlagen:
dankbares Leben.
Und zwar ist das ganz wichtig, denn dankbares Leben verbindet uns mit allem.
Mein Cousin zeigt mir immer, wie offen wir alle sind für die Verschiedenheit von der Kochkunst. Wir wissen die französische Kochkunst zu schätzen und die italienische und die chinesische und die japanische. Wir brauchen sie ja nur aufzuzählen: Jedes Volk hat seine eigene Kochkunst, wir wissen sie alle zu schätzen ‒ und die Völker: da schließen wir uns plötzlich ab. Wir sollten in Dankbarkeit, so wie wir dankbar sind für die verschiedenen Errungenschaften der Kochkunst, so sollten wir dankbar sein für alle anderen Errungenschaften der Völker, und das schließt ihre religiösen Erfahrungen ein, die unsere ergänzen.
Keine Tradition kann alles haben.
Jede Tradition drückt diesen Glauben auf ganz andere Art aus ‒
diesen tiefsten menschlichen Urglauben ‒,
aber jede auf eine andere Art.
Und da können wir dankbar sein für alle anderen.
Aber dankbares Leben ist auch deshalb so ungeheuer wichtig, weil es uns, wenn wir es wirklich üben ‒ wie jede spirituelle Übung ‒ in das Jetzt versetzt. Und im Jetzt zu sein, heißt sein Selbst zu finden: Selbst im Gegensatz zum Ich:
Nicht, als ob das Ich schlecht wäre, aber das Ich bin nicht Ich selber. Wir können in uns gehen und wir können uns betrachten, und dieser innere Beobachter, der kommt unserem Selbst schon näher. Das Ich ist da draußen, das Ich ist die Maske, das Ich ist die Rolle, die wir spielen. Aber der Beobachter ist innen. Wir können zurücktreten auf den Beobachter, und dann werden wir sagen: Wer beobachtet den Beobachter? Wenn dann noch ein Beobachter da ist, der den Beobachter beobachtet, dann gehen Sie noch weiter zurück, bis Sie zu dem Beobachter kommen, den niemand mehr beobachtet.
(37:43) Das ist dann unser innerstes Selbst, und das ist e i n e s für uns alle. Es gibt nicht eine Mehrzahl von Selbsten. Es gibt nur e i n Selbst, das uns allen eigen ist, das ist unser gemeinsames Selbst, und wir spielen so viele verschiedene Rollen und das ist wunderbar:
Beides ist großartig,
dass es nur e i n Selbst gibt,
und dass es so viele Ausdrucksweisen gibt.
Und unsere Aufgabe ist es, zugleich unser Selbst zu finden, das uns mit allem verbindet, und unsere Rolle gut zu spielen.
Denn nur wir können diese Rolle spielen. Niemand hat all die Voraussetzungen, die jede und jeder von uns hat: Niemand hat dieselben Vorfahren, niemand hat dieselbe kulturelle Einbettung, niemand hat denselben Fingerabdruck. Wir sind einzigartig, und diese Einzigartigkeit ist etwas ungeheuer Wichtiges für uns, wir können einander dankbar sein für diese Einzigartigkeit. Wir können sie aneinander erleben, aber zugleich uns verbunden fühlen in diesem Selbst.
Darum heißt ja auch das Gebot:
‹Liebe deinen Nächsten a l s dich selbst.›
Sehr häufig wird das falsch übersetzt und wir hören: ‹Liebe deinen Nächsten w i e dich selbst›. Dann wird es sehr kompliziert. Dann muss man zunächst sich selbst lieben, wie wenn man jemand anderer wäre, und dann jemand anderen, wie wenn man sich selbst lieben würde, wenn man jemand anderer wäre, und das führt nur zu Komplikationen. Es ist viel einfacher: ‹Liebe deinen Nächsten a l s dich selbst›.
Das Selbst lieben wir,
denn lieben heißt:
‹Ja sagen zur Zugehörigkeit.›
Und dem Selbst gehören wir zu, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir also den Nächsten a l s unser Selbst verstehen, wir wissen, das ist derselbe Schauspieler, der nur eine andere Rolle spielt.
Aber unser Problem ist, dass wir uns mit der Rolle identifizieren.
Unsere Identität ist das Selbst, nicht die Rolle.
Die Rolle ist nur unsere Identifikation, das, was man auf einem Ausweis sieht und vorzeigen muss bei der Passkontrolle.
Aber unsere Identität ist dieselbe für uns alle.
Eine Schauspielerin oder ein Schauspieler spielt die Rolle dann gut, wenn sie wirklich überzeugend ganz eintreten in die Rolle, aber sich nicht identifizieren mit der Rolle. Wenn die Schauspielerin plötzlich glaubt, sie sei Ophelia, dann ist sie verrückt geworden. Wir sind alle verrückt, weil wir uns alle mit unserer Rolle identifizieren. Hie und da gelingt es uns, Gott sei Dank, wenigstens einen Augenblick lang zu wissen, wer wir wirklich sind. Und darin besteht jede spirituelle Übung, das Gewicht zu verlegen vom Ich auf das Selbst. Nicht, dass dann das Ich schlecht ist, aber erst dann können wir die Rolle gut spielen, erst dann können wir das Ich wirklich zu seiner Blüte bringen, wenn das Selbst dahinter steht, wenn das Selbst agiert und Schauspieler ist.
(41:09) Darum ist das so wichtig, denn dann ist durch diese Dankbarkeit, die uns immer wieder in das Jetzt führt, und dadurch zu dem Selbst führt, diese Verbundenheit gegeben.
Wir pflegen sie, wir vertiefen sie jedes Mal, wenn wir dankbar sind.
Denn dankbar kann man nur im Jetzt sein.
Wir können für die Vergangenheit dankbar sein, wir können für die Zukunft dankbar sein, aber wir können nur jetzt dankbar sein, nur in der Gegenwart.
Und da wartet uns schon etwas entgegen, das ist wieder dieses ES, das uns entgegenwartet,[14] das alles gibt.
Uns immer wieder in die Gegenwart zu bringen, heißt unser Gewicht auf das Selbst verlegen, das Selbst finden. Nur in der Gegenwart finden wir das Selbst, denn das Ich ist immer in der Zeit verstrickt. Und darum ist dankbares Leben als eine Übung ungeheuer wichtig.
(42:35) Jetzt möchte ich aber noch einen letzten Punkt anführen: Wie können wir diese Verbundenheit, um die es uns geht im Glauben, der alle verbindet, wie können wir die erfahren, pflegen und vertiefen? Durch
ein neues Durchdenken unserer eigenen Religion.
Viele von Ihnen kommen aus einem christlichen Milieu, christlichen Verständnis, und haben wahrscheinlich schon klar gesehen, dass das ES das ist, wovon der christliche Glaube als dem Vater spricht. Heute würden wir wahrscheinlich lieber Mutter sagen, es drückt das für unser Gehör und für unser Gespür besser aus, aber was die Dreifaltigkeitslehre den Vater nennt, das ist dieser Urgrund, dieser unerschöpfliche Urgrund, dieses ES.
Die unbegreifliche Vielfalt ist der kosmische Christus. Und die unerschöpfliche Lebendigkeit, die Dynamis ist der Hl. Geist. Das liegt schon in dem
‹ES gibt mich›
drinnen als Kern. Wir dürfen nicht sagen: Ja, das ist das innerste Geheimnis der Offenbarung in der christlichen Religion: Ja, es ist das innerste Geheimnis, aber
die christliche Religion, wie jede andere,
ist eine Ausformung dieses menschlichen Urglaubens.
Wir brauchen uns ja nur zu fragen: Wie konnten die Kirchenväter sich jemals einigen auf die Lehre der Trinität? Wenn man liest, was da in den Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts vorgegangen ist: da ist so viel Politik, da ist so viel philosophisches Missverständnis, da ist so viel Streit, dass es nur erklärlich ist, wie die sich überhaupt einigen konnten, dass sie auf diesen tiefsten menschlichen Urglauben zurückgekommen sind.
Diesen Urglauben findet man auch ausgedrückt in anderen Traditionen, im Buddhismus ganz klar, in anderen Traditionen auf ganz andere Weise, aber im Gespräch kann man verstehen: denen geht’s um dasselbe.
Es geht immer um das ‹ES gibt mich›:
um diesen Abgrund, der alles gibt,
um die Fülle der Wirklichkeit, der ich angehöre,
und um die Dynamik, durch die alles hervorkommt,
und durch die alles zurückgegeben wird.
(45:19) Und da kommt wieder die Dankbarkeit herein, denn so erleben wir es. Heutzutage finden viele Menschen es sehr schwierig, das traditionelle Gottesbild, die traditionelle Gottesvorstellung noch nachzuvollziehen. Denn es fühlt sich zu sehr an als ein Gott, der von uns getrennt ist.
Wir wissen, dass alles mit allem zusammenhängt, und wir erleben uns auch als selbst unauslotbar, das heißt im Innersten göttlich.
Das heißt nicht, ich bin einfach Gott, aber es heißt, das innerste Wesen von mir ist göttlich.[15] Und das ist der Logos, das ist völlig in der christlichen Tradition gegeben, und so hilft es uns, uns zu orientieren in der Welt durch Dankbarkeit, durch die Vorstellung ‒ die der Wirklichkeit entspricht ‒, dass alles hervorkommt aus einer unergründlichen Quelle: dem Geber aller Gaben, wenn wir das persönlich sagen wollen, und wir haben alles Recht, das persönlich zu sagen:
Aus der Quelle, dem Geber aller Gaben, kommt alles hervor, alles ist Gabe, alles ist gegeben, alles feiert sein Dasein: der Logos, der kosmische Christus in uns und um uns und im ganzen Kosmos, und
in Dankbarkeit geben wir uns jetzt zurück an diesen Ursprung,
einfach dadurch, dass wir tun, was uns zu tun aufgeben ist:
Jede Gabe ist zugleich Aufgabe.
Die Vögel erweisen sich dankbar dadurch, dass sie singen, die Fische dadurch, dass sie schwimmen, die Mütter dadurch, dass sie Mütter sind, und die Wissenschaftler dadurch, dass sie Wissenschaft betreiben, und so jeder von uns dadurch, dass wir das tun, was uns aufgegeben ist vom ES, das uns gibt.
(47:27) Und jetzt kommt noch ein Bereich dazu, noch ein Kreis der Zugehörigkeit: Wenn wir das wirklich durchdenken ‒ jetzt vom christlichen Standpunkt her,
denn es geht darum, unseren eigenen Glauben
durchzudenken, von der Mitte her,
von der Trinitätslehre her ‒,[16]
dann sehen wir, dass für uns hier im Westen, also für Juden, Christen und Muslime, das Wort völlig im Mittelpunkt steht, das Geschenkte, die Gabe, völlig im Mittelpunkt steht.
Für Buddhisten das Schweigen, aus dem das Wort kommt, für Hindus das Verstehen des Wortes.
Für uns ‒ ich nenne die drei Traditionen [Judentum, Christentum und den Islam] gerne die Amen-Traditionen, denn sie haben das Wort Amen gemeinsam, und das ist ja kein Zufall, denn Amen ‒ und da denken wir wieder der Sprache nach ‒, Amen ist die Antwort auf die Amunah Gottes, und die Amunah ist die Verlässlichkeit Gottes. Wir verlassen uns auf die Verlässlichkeit Gottes:
In diesem einen Wort A m e n liegt schon der ganze Glaube drinnen:
Ich verlasse mich auf die Verlässlichkeit Gottes.
Und darum steht für uns das Wort so im Mittelpunkt, oder die gegebenen Dinge: die Gabe, steht für uns so im Mittelpunkt.
Für Buddhisten ‒ und das ist für uns schwer nachzuvollziehen ‒, steht das Schweigen ebenso im Mittelpunkt wie für uns das Wort.
Ich erinnere mich noch, wenn ich während meines Studiums des Buddhismus gedacht habe, also das habe ich jetzt doch richtig verstanden und wollte es noch ausprobieren mit meinem Lehrer und habe gesagt: ‹Also habe ich das jetzt richtig verstanden›, und habe es ganz genau formuliert, hat er nur gelacht und gesagt: ‹Ausgezeichnet, ganz genau, aber wie schade, dass du das in Worte fassen musst›. Und dann ist er selber in unserem Gespräch sehr beredt geworden und hat angefangen über den Buddhismus sehr beredt zu sprechen, und plötzlich hat er mitten in einem Satz abgebrochen und gelacht und gesagt: ‹Ich rede schon wieder zu viel, ich bin schon ein halber Christ›. Er hat vollkommen diese Beziehung zwischen Wort und Schweigen, Nichts und der Fülle verstanden.
Im Hinduismus steht ebenso das Verstehen im Vordergrund:
So wie bei uns im Westen das Wort,
und im Buddhismus das Schweigen,
so ist im Hinduismus das Verstehen zentral.
Swami Venkatesananda, ein ganz großer Lehrer, sagt: ‹Yoga› ‒ und das ist die Spiritualität des Hinduismus schlechthin ‒, ‹Yoga i s t Verstehen›.
Und Yoga kommt von derselben Sprachwurzel wie Joch, ein Joch für Ochsen, und jocht zusammen, verbindet das Wort und das Schweigen ‒ wenn wir das Wort und das Schweigen verbinden ‒, dann erst verstehen wir.
Wir verstehen ‒ und da appelliere ich wieder an ihr Verständnis, an Ihre eigene Erfahrung ‒, wir verstehen etwas zutiefst, wenn wir so tief darauf hinhorchen, dass es uns dorthin führt, woher es kommt, und das wahre Wort kommt immer aus dem Schweigen und führt uns in das Schweigen. So verbindet sich Wort und Schweigen im Verstehen.
(51:12) Das könnte man natürlich noch viel weiter ausführen, aber wichtig ist für mich hier im Zusammenhang mit dem Glauben, der alle verbindet, dass
was für uns Christen diese trinitarische Gottesschau ‒
dieses Gottesverständnis ‒ beinhaltet,
so tief und so allumfassend ist,
dass eine Tradition sie gar nicht ausschöpfen kann.
Unsere Christliche betont hauptsächlich das Wort. Darum sprechen wir auch von Theo-logie, da ist schon das Wort drinnen.
Was die Theologie des Vaters wäre, das lotet der Buddhismus aus, das ist das Schweigen, das ist nicht mehr das Wort. Was die Theologie des Hl. Geistes wäre, des Geistes des Verstehens ‒ auch die Gabe des Geistes: Verstand, die Liebe ‒, das lotet der Hinduismus aus, versucht es auszuloten.
Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir auch die Verbundenheit zwischen allem, und mein liebstes Bild für diese Verbundenheit ist der Reigentanz dieser Traditionen: Wenn man sie gut verstehen lernt, sieht man, dass die wie Kinder sind, die einander an den Händen halten und rundherum tanzen in einem Reigentanz.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dieser Reigentanz geht hier vor, und Sie stehen außerhalb dieses Reigentanzes wie die Religionswissenschaftler, und wollen das also von außen betrachten, dann sehen Sie immer, dass die Ihnen am nächsten in einer Richtung gehen, und die Ihnen am fernsten in genau der entgegengesetzten Richtung gehen. Wo immer Sie außerhalb des Kreises stehen, ist genau das richtige Bild, lässt sich nicht bestreiten:
Die einen gehen in einer Richtung, die anderen, die entfernteren, gehen in der entgegengesetzten Richtung. Im Augenblick, wo Sie nicht mehr das von außen sehen wollen, sondern die Hände halten und selber in den Kreis eintreten ‒ und dazu sind wir aufgefordert durch unsere Gläubigkeit ‒, auf einmal sehen wir, dass alle in einer Richtung gehen.
Und wenn unser Gespräch heute Abend, jetzt meine Einführung und dann unser gemeinsames Gespräch, ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir nicht mehr von außen schauen ‒ furchtsam ‒, sondern eintreten, die Hände halten und sehen, dass wir alle in e i n e r Richtung gehen, dann bin ich sehr dankbar.»
______________
«Es gibt viele Glaubensüberzeugungen, aber nur einen Glauben. Wir müssen lernen, unsere Überzeugungen weniger wichtig zu nehmen als die Urgebärde gläubigen Vertrauens. Glaubensüberzeugungen haben die Kraft, uns zu entzweien, Glaube aber hat die noch größere Kraft, uns zu einen.»
[2] Martin Heidegger: ‹Unterwegs zur Sprache›, Stuttgart, Klett-Cotta 2022; siehe auch die Transkription des Vortrags Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog (2014), 5, wie auch die Einleitung in allen drei Vorträgen zum Credo ‒ ein Glaube, der alle verbindet (2010)
Worum sich letztlich alles dreht (2021): Interview geführt vom Tyrolia-Verlag mit Bruder David; siehe auch Dichtung, Bilder Sprache: Ergänzend: 2.:
«Sie benennen in Ihrem Buch Orientierung finden (2021) fast 100 Schlüsselworte für Ihr Leben – gibt es auch ein besonderes Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselbegegnung für Sie?»
«Martin Heidegger hat mir so ein Schlüsselerlebnis geschenkt, für das ich zutiefst dankbar bin. Er spricht davon, dass wir ‹der Sprache nachdenken› können, wie man etwa einem Feldweg nachgeht. Das hat mich zutiefst berührt, als ich es zum ersten Mal las. Es hat mir bewusst gemacht, dass das Denken unserer Vorfahren unsere Sprache geformt hat und dass wir uns unbewusst in diesen Denkbahnen bewegen – dass wir dies aber auch mit großem Gewinn bewusst tun können.
Heidegger hat mir durch diese Einsicht einen Schlüssel in die Hand gegeben, der mir in unserer Muttersprache Tür um Tür aufgeschlossen und immer neue Einsichten geschenkt hat. Auch an anderen Sprachen durfte ich dies erfahren, besonders im Englischen, wo ich mich ja ebenso zuhause fühle wie im Deutschen. ‹Der Sprache nachdenken› wurde zur Grundhaltung meines Denkens und hat auch mein neues Buch Orientierung finden, entscheidend beeinflusst.»
[3] Orientierung finden (2021): Gott ‒ das geheimnisvolle ‹Mehr-und-immer-Mehr›, 58; siehe ausführlicher in Religionen und heiles Gottesbild: Ergänzend: 2.1. und 2.2.:
«Hinter allem, was uns im Leben begeistert, steckt stets mehr: das ‹Mehr›, das wir Geheimnis nennen. Deshalb kann die große Theologin Dorothee Sölle (1929-2003) Gott ‹das Mehr› nennen ‒ das ‹Mehr-und-immer-mehr›, könnten wir sagen.»
[4] Film Der Sinn des Lebens und die Dankbarkeit (2024), siehe auch die Mitschrift Sinnvoll leben, dankbar leben:
(08:12) «Auf das Leben hinhorchen, Augenblick für Augenblick, und dem Leben antworten! Das hängt gar nicht von den konkreten Lebensumständen ab. Zum Beispiel: Wenn du in der Früh aufwachst und Deinen Tagesplan anschaust – in der Haltung: ‹Das schenkt mir das Leben, das verlangt es von mir› – dann hast du ein Gegenüber: das Leben.
ES lebt dich!
Wir haben nicht das Leben, das Leben hat uns. Trotzdem können wir uns ihm gegenüberstellen. Das ist sehr geheimnisvoll, und sehr tief:
Wir sind Leben, das Leben lebt uns, und wir sind mit ihm im Dialog: hörend, achtsam auf das, was das Leben von mir will. Und zugleich achtsam darauf: Was schenkt es mir? Natürlich können wir auch taub und schlafwandelnd sein.»
«Du sprichst vom Leben so, als wäre es ein Subjekt.
Was ist das: das Leben,
das etwas von mir will?»
«Es ist unser großes Du, und es ist das ES, das alles gibt. ES gibt sogar m i c h!
Was ist dieses ES?
Es ist das geheimnisvolle Herzstück,
die Mitte des Lebens.
Wir stehen ständig im Dialog damit.
Wenn du über dein Leben nachdenkst, dann ist dieses Leben ja nicht eine Aneinanderreihung von unzusammenhängenden Episoden, sondern du hast eine Geschichte. Eine Geschichte: Das setzt voraus, dass du sie jemandem erzählst.»
«Auch sich selber?»
«Ja, aber auch jemand anderem: dem großen Du, dem du gegenüberstehst, und das ich ‹das Leben› nenne: Man kann es auch – sehr vorsichtig – ‹Gott› nennen.»
[5] i am so glad and very
merely my fourth will cure
the laziest self of weary
the hugest sea of shore
so far your nearness reaches
a lucky fifth of you
turns people into eachs
and cowards into grow
our can'ts were born to happen
our mosts have died in more
our twentieth will open
wide a wide open door
we are so both and oneful
night cannot be so sky
sky cannot be so sunful
i am through you so i
e. e. cummings
[6] So auch der Titel des Buches Ich bin durch Dich so ich: Lebenswege. David Steindl-Rast im Gespräch mit Johannes Kaup, Münsterschwarzach, Vier-Türme-Verlag (2016). Ebenso die englische Übersetzung: ‹i am through you so i›, New York, Paulist Press [2017]
[7] Umgangssprachlich werden Furcht und Angst synonym gebraucht. Bruder David differenziert zwischen Angst, die unvermeidlich ist, und Furcht , die sich gegen die Angst sträubt und dem Ego verfällt.
[8]Im Buch: Orientierung finden (2021), 67; siehe auch Religionen ‒ drei Ausdrucksformen: Ergänzend: 3.1.:
«Wenn wir vergessen, dass alle Texte, die über das Geheimnis sprechen, symbolisch zu verstehen sind, also nicht wörtlich, dann sind wir schon auf dem Holzweg.
So hat zum Beispiel der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide (1922-1997) treffend gesagt:
‹Man kann die Bibel ernst nehmen oder wörtlich, beides zusammen ist nicht möglich.›
Ähnlich gilt das von den heiligen Schriften aller Religionen.»
[9] ‹Du Dunkelheit, aus der ich stamme› (Rilke, Das Stunden-Buch), siehe Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 14-19
[11] Piet Beauty
Glory be to God for dappled things –
For skies of couple-colour as a brinded cow;
For rose-moles all in stipple upon trout that swim;
Fresh-firecoal chestnut-falls; finches’ wings;
Landscape plotted and pieced – fold, fallow, and plough;
And áll trádes, their gear and tackle and trim.
All things counter, original, spare, strange;
Whatever is fickle, freckled (who knows how?)
With swift, slow; sweet, sour; adazzle, dim;
He fathers-forth whose beauty is past change:
Praise him.
Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
[12] Thomas von Aquin: Das Wort: Kommentar zum Prolog des Johannes-Evangeliums (lat.-dt.) (= Einführende Schriften, Bd. 1), übersetzt von Josef Pieper; hrsg. von Hanns-Gregor Nissing und Berthold Wald, München, Pneuma-Verlag [2017], 9:
«Wir nämlich sind unvermögend, alle unsere Erfahrungen in einem einzigen Worte auszusprechen; so müssen wir viele unvollkommene Worte bilden, durch die wir getrennt alles das aussprechen, was in unserem Wissen ist. In Gott aber ist es nicht so: weil er sich selbst und alles, was er durch seine Wesenheit erkennt, in einem einzigen Akt erkennt, darum spricht das einzige göttliche WORT alles aus, was in Gott ist, nicht nur die göttlichen Personen, sondern auch die Schöpfung; sonst wäre es unvollkommen. So sagt Augustinus: ‹Würde das WORT irgend weniger umfassen, als in dem Wissen dessen ist, der es spricht, so wäre das WORT unvollkommen. Nun aber ist gewiss, dass es auf die höchste Weise vollkommen ist; also ist es nur eines.› Und im Buche Hiob heißt es: ‹E i n Mal spricht Gott.› (Hiob 33,14).»
[13] Fragen in Wendezeiten (2010)
Vortrag
(57:23) Stillhalten im Vertrauen (Glaube) ‒ Offenheit für Überraschung (Hoffnung) ‒ Empfangen und Weiterschenken (Liebe) / (58:38) Der römische Brunnen (C.F. Meyer)
[14] Sinne und Kind werden: Anm. 7; Berufung: Anm. 5:
Das Wort ‹entgegenwarten› stammt von Rilke: ‹Nach aller Kunst wieder einmal Natur. Nach dem vielen das eine, nach dem Suchen diesen einen großen und unerschöpflichen Fund, in welchem tief innen noch unberührte Künste einer leisen Erlösung entgegenwarten.› (R. M. Rilke, Das Florenzer Tagebuch)
[15] Auf der Suche nach einem heilen und heilenden Gottesverständnis, in: MYSTIK ‒ Spiritulität der Zukunft: Erfahrung des Ewigen (2005), 83; siehe auch Religionen und heiles Gottesbild:
«Die frühchristliche Tradition drückte diese mystische Erfahrung aus, indem sie Gottes Einheit als Vater, Sohn und Heiligen Geist bekannte. Dies ist ein panentheistisches Gottesverständnis, das sich vom Pantheismus (alles ist Gott) durch die Silbe e n (= i n) unterscheidet.
Gott ist in allem und alles ist in Gott ‒ in dem M e h r, das immer noch mehr ist als alles.
Die theistische Vorstellung von Gott als dem absolut Anderen war aber so tief eingegraben in der westlichen Mentalität (und so vorteilhaft für die Machthaber), dass diese wilde wundervolle Gottesanschauung gezähmt werden musste.
Christliche Theologen vergegenständlichten die mystische Erfahrung von Gott als dreieinig und projizierten sie auf den theistischen ‹Gott da draußen›. Die Zeit war noch nicht reif.»
[16] Jesus als Wort Gottes (1972), abgedruckt im Buch Die Frage nach Jesus (1973), 65; siehe auch ‹Es gibt mich›: Ergänzend: 1.2.:
«Unser Glaube sieht all dies im Lichte der Dreifaltigkeit. Für uns Christen sind die Wege des Menschen auf der Suche nach dem tiefsten Sinn nur im Lichte des trinitarischen Geheimnisses verständlich.»
Erstes Kamingespräch (2018)
Übersicht über das Gespräch mit Kurzvortrag von Bruder David
zusammengestellt von Hans Businger
Bruder David weist hin auf das Buch des Neurobiologen Gerald Hüther: Würde, der im ersten Teil aufzeigt, wie das Bewusstsein von Würde im Gehirn verankert ist.[1]
(02:12) Psychologisch gesehen entsteht in einem Kind das Gefühl der Würde, wenn zwei Dinge zusammenkommen:
Erstens: Fraglose Zugehörigkeit ‒ ein Bewusstsein, ein Gefühl fragloser Zugehörigkeit ‒ also nicht unter der Bedingung, dass du das und das tust, sondern fraglos.
Das heißt nicht, dass du alles tun kannst, da werden dir Grenzen gesetzt, aber das betrifft nicht dein Dazugehören zur Familie, zur Schulgemeinschaft, zu deinem Freundeskreis.
Der zweite Bestandteil ist: Freiheit, sich zu entfalten, mehr noch: Unterstützung der eigenen Interessen, der eigenen Kreativität: Ich gehöre dazu ‒ fraglos ‒ und ich werde unterstützt in meiner ganz eigenständigen Entfaltung.
Beides muss zusammenkommen, sonst entsteht so etwas wie ein Bienenschwarm oder ein Ameisenhaufen, in dem die Eigenständigkeit fehlt.
Unsere Individualität haben wir ja sehr schwer und mit großen Opfern über die Jahrtausende und Jahrhunderte erkämpft. Dass wir heute in unserer Kultur so eigenständig sein dürfen, ist ein ganz großes Geschenk. Ich habe noch andere Kulturen kennengelernt, wo das einfach nicht gegeben ist, wo persönliche Entscheidungen unhinterfragt nur mit Einwilligung der Familie möglich sind.
Wir haben unsere Eigenständigkeit sehr teuer erkauft, wenn ich an die Jahrtausende mit Unterdrückung und Ausbeutung denke. Jetzt aber sind wir am andern Extrem angelangt, wo wir vereinzelt sind, in Einsamkeit gefangen.
Und darum ist es heutzutage sehr wichtig, sich in einer Gemeinschaft einzubinden, die das Beste, was die Eigenständigkeit beinhaltet, einschließt.
[Siehe auch Bruder David im Gespräch mit Egbert Amann-Ölz: Vom Ich zum Wir: Wege aus einer gespaltenen Gesellschaft (2021), 2f.]
(06:26) Gerald Hüter weist mit drastischen Beispielen auf den Verlust der Würde in unserer Zivilisation.[2] Schon dass das Wort Würde bei uns sehr selten verwendet wird, ist ja auch schon sehr kennzeichnend.
Vor hundert Jahren war Würde ein Wort, das jeder ständig im Mund gehabt hat. Und damit hängt zusammen: Scham. Also «unwürdig» und «unverschämt» gehören da zusammen. Und wir haben das Gefühl der Scham völlig verloren.
Ein erster Hinweis auf den Verlust der Würde fand Bruder David schon vor über 30 Jahren in einem kurzen Artikel ‒ er vermutet im Time Magazine ‒ mit dem Titel: «Whatever happened to shame?»:
Wenn man früher ein Auto in die Reparatur gegeben hat, war man sicher, dass man es repariert zurückbekommt, oder der Automechaniker sagt einem, ich konnte es nicht reparieren, aber er hätte sich geschämt, irgendetwas anderes zu tun. Heute schämt sich keiner mehr, der Mann verlangt Geld und hat überhaupt nichts gemacht.
Und nicht nur das: Menschen, die schamlos handeln und sich schamlos bereichern auf Kosten der Armen, sind für die jungen Leute Vorbilder.[3]
Wladimir Solowjow, der große russische Denker des späten 19. Jahrhunderts, schrieb: Was uns als Menschen charakterisiert, was uns vom Tier unterscheidet, ist Ehrfurcht vor dem großen Geheimnis, Mitgefühl ‒ mit allen Menschen, Tieren, Pflanzen, mit dem ganzen Universum ‒, und Scham. Scham, unsere Würde nicht zu verletzen.[4]
Mitgefühl ist in aller Munde und Ehrfurcht ist spirituellen Menschen recht verständlich, aber Scham muss heute wieder sehr unterstrichen werden: davon möchte ich von euch etwas hören. Unsere eigene Würde verlangt sehr viel von uns: zum Beispiel, sich für geistliche Begleitung auszubilden, und offensichtlich: die Würde des andern immer im Auge zu behalten in der Haltung: wir gehören zusammen, aber du bist frei.
Die Themen im Gruppengespräch
(10:20) Aussperrung von Flüchtlingen: für Bruder David der offensichtlichste Verstoß gegen die Menschenwürde und zunächst gegen unsere eigene Würde:
Bruder David: Wenn jemand in seinem Haus sitzt und das Haus wohlbestellt ist, und jemand der völlig unbemittelt ist, ans Tor klopft, kann man sich ja kaum vorstellen, dass jemand so unverschämt handelt, dass er einfach die Tür zumacht und fest zuriegelt. Aber dass ein ganzer Erdteil, der wohlbestellt ist, einfach die Türe zuriegelt ‒ unverschämt ‒, und niemand sagt, das ist doch gegen u n s e- r e Würde.[5]
Bruder David erwähnt die zahmen Fürbittgebete im Gottesdienst zum Thema Europa, die Proteste des Papstes gegen die Flüchtlingspolitik und den Hungerstreik eines italienischen Bischofs und spricht vom offensichtlichsten Verstoß gegen die Menschenwürde. Und zunächst einmal gegen unsere eigene.
(12:54) Etwas vom Allerwichtigsten im Schulunterricht ist, den Kindern vom Kindergarten an ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde zu vermitteln.
Gerald Hüter sagt, das ganze Schulsystem ist so eingerichtet, dass es gegen die Würde der Kinder verstößt. Die Kinder werden als Gegenstände betrachtet, aus denen man jetzt etwas machen muss.[6]
Also man müsste schon einmal bei den Lehrern anfangen und ihnen wieder ein Bewusstsein der Würde geben. Dann geht es auch zu den Kindern. Vor hundert Jahren waren die Lehrer arm und nicht so gebildet wie heute, aber sehr geachtet als Lehrer.
Andreas Salcher hat Schulen und Erziehungssysteme der ganzen Welt untersucht, um herauszufinden, was ein gutes Schulsystem auszeichnet, und was fehlt, wenn es schlecht ist. Er kommt zum Schluss, dass es notwendig ist, die Würde der Lehrer zu heben durch eine strenge Auswahl, eine sehr gute Ausbildung und eine gute Bezahlung.
[Siehe auch Andreas Salcher im Gespräch mit Bruder David (2021) und die Übersicht über die Themen des Gesprächs]
(14:41) Weitere Themen: Das Spannungsfeld, das die Lehrer zermürbt. / Bei sich selber anfangen und nicht auf Systemänderungen warten. / Der Zerfall von Gemeinschaft und unsere Vereinzelung.
Bruder David vergleicht unsere Situation mit den Familienbanden in Argentinien und erwähnt eine Studie in Bhutan mit der Rundfrage: Wenn sie in eine Notsituation kommen, auf wie viele Menschen können sie zählen?
In Bhutan haben die meisten Leute gesagt: Unzählige, ich kann auf jeden zählen. Und ähnlich in Argentinien: Die Familien versuchen nicht weit auseinander zu wohnen, sie treffen sich jeden Sonntag zum gemeinsamen Essen; manchmal kommen alle, manchmal nur ein Teil der erwachsenen Kinder und deren Kinder. Mein Cousin trifft sich jeden Donnerstag mit seiner Volksschulklasse und ist fast so alt wie ich.
Ist der Zerfall von Gemeinschaften eine Folge des Wohlstands?
Bruder David: Ich glaube, da ist etwas anderes dahinter: einfach ein stärkeres Gemeinschaftsbewusstsein, andere Werte. In manchen Gesellschaften wird dieses Gemeinschaftsleben als sehr hohen Wert angesehen und bei uns weniger. Wenn man fragt: Was ist dir im Leben wichtig, werden sicher viele Leute auch sagen: Gemeinschaft oder Familie. Aber viele werden sagen: Im Beruf vorankommen …
Eltern haben Angst um die Zukunft ihrer Kinder und sind dankbar für jedes Angebot, das in den Schulen und auch in den Kindergärten gemacht wird, um die Kinder möglichst schnell erfolgreich zu machen, und da werden die Kinder auch verzweckt.
Bruder David: Was heißt schon erfolgreich? Wir müssen uns fragen, was heißt Erfolg? Was ist ein erfolgreiches Leben?
(21:45) Bruder David im Gespräch mit der Gruppe: Wie fühlt sich das an, wenn man sich seiner Würde bewusst ist?
Wenn ich mir meiner Würde bewusst bin, dann lasse ich nicht alles mit mir machen und mache nicht alles mit.[7]
Bruder David: Und woher nehme ich den Maßstab, was ich mitmache und was ich nicht mitmache?
Das ist eine Frage des Gewissens.
Bruder David: Beim Thema Würde kommt sehr viel das Gewissen herein. Aber das ist halt auch ein sehr vager Begriff geworden.
Eine Teilnehmerin spricht von einem Gefühl, das uns sagt, was für uns stimmig ist: Was ist für mich das Richtige? ‒ was fühle ich? Und dann, was ich spüre, nicht anzweifle, mich nicht beeinflussen lasse, vielleicht von dem Gewissen, das anerzogen worden ist, sondern wirklich auf mein Inneres höre und versuche, zu mir zu stehen.[8]
Iwan Hofer: Wir verzwecken alles.
[Dazu ergänzend in Muße:
«Gar zu leicht neigen wir zu der Vorstellung, dass Gott diese Welt aus einem bestimmten Zweck erschuf. Wir sind dermaßen im Zweckdenken verfangen, dass wir uns sogar Gott als zweckgebunden vorstellen. Gott aber spielt. Die Vögel eines einzigen Baumes sind Beweis genug, dass Gott sich nicht mit einer göttlichen No-Nonsense-Haltung daran machte, eine Kreatur zu schaffen, die auf perfekte Weise den Zweck eines Vogels erfüllt. Was könnte dieser Zweck auch sein, frage ich mich. Es gibt Kohlmeisen, Schneefinken und Amseln, Spechte, Rotkehlchen, Stare und Krähen. Der einzige Vogel, den Gott nie geschaffen hat, ist der No-Nonsense-Vogel.»]
Iwan weist auf übertriebene Vorsicht und unnötige Verbote in seiner Schule hin.
(25:02) Bruder David: Wir sind von Furcht beherrscht ‒ die Eltern sind heutzutage so furchtsam ‒, das schadet der Würde, und das andere: Die Kinder sind ja so verschieden, und unsere Verschiedenheit, unsere Einzigartigkeit zu erkennen, das gehört auch, glaube ich, zu unserer Würde dazu.
Und ich glaube, es gehört auch dazu zu wissen, dass man einen Beitrag leistet. Aus heutiger Sicht wurden Hausangestellte und Knechte und Mägde in einem Dorf regelrecht ausgebeutet, aber sehr häufig haben sie eine echte Würde gelebt aus dem Bewusstsein heraus: ich leiste meinen Teil. Es war ganz klar, was man als Herr oder als Frau So und So macht, und das war eine Lebensaufgabe, und die zu erkennen und freudig anzunehmen gehört zur Würde dazu, und das hängt nicht davon ab, ob ‒ objektiv betrachtet ‒, man gewürdigt wird. Darum sagt Gerald Hüter auch richtig: Wer Würde hat, das kann einem niemand nehmen.[9]
(27:18) Teilnehmerin: Für mich gehört zur Würde, dass wir auf einer Ebene sind in dem, was wir gut können ‒ unabhängig von unserer Stellung in der Gesellschaft ‒, dass nicht einer darüber steht.
Bruder David: Wichtig ist, einen Maßstab zu haben für das, was man macht: es muss gut sein. Ich weiß, dass ich’s auch schlampig machen könnte, Schlamperei ist würdelos. Auf Augenhöhe zu sein miteinander, das gehört eigentlich dazu. Der andere macht’s auf andere Weise gut; ob der jetzt ein Arzt ist und ich ein Straßenkehrer: wenn ich Würde habe, bin ich auf Augenhöhe, weil wir eben beide nur versuchen, unser Leben gut zu gestalten.
Iwan: Die Würde darf nicht davon abhängen, was einer kann. Würde muss einen unverfügbaren Grund haben und der verschwindet in unserer Gesellschaft.
Bruder David: Da kommt die Menschenwürde herein: einfach Mensch zu sein, das gibt uns die Würde.[10]
(28:56) Eine Teilnehmerin sieht in den Stufen der Demut in RB 7 einen Weg, die eigene Würde zu entdecken, die unabhängig ist von Leistung und Ansehen und uns von Furcht befreit.
[Siehe dazu Dem Welthaushalt freudig dienen ‒ Spiritualität 2011, das Audio Vertiefungsseminar mit den 12 Stufen (1-12) der Demut in der Regel des hl. Benedikt (RB 7) ab (34:17).]
Freiheit liegt nicht nur darin, dass wir unsere Talente entfalten können, sondern, dass wir uns auch befreien von unseren eigenen Begrenzungen.
Ein Teilnehmer mit Blick auf das Biophilie-Konzept von Erich Fromm: Würde will leben mehren im Gegensatz zu unserer Gesellschaft, die den Tod verdrängt.
Gerald Hüther sagt: Wir alle wollen mit Würde sterben. Sollten wir nicht vielleicht versuchen, zunächst einmal mit Würde zu leben?[11]
(31:26) Bruder David fasst zusammen: Die Würde darf nicht abhängen davon, ob ich etwas kann oder nicht. Sondern nur davon, ob ich das, was ich kann, wirklich so gut mache, wie ich kann.
Sich dessen bewusst sein, wieviel mir geschenkt ist: da hängt dankbar leben mit Würde zusammen. Und das heißt nicht, dass dies nur denen leichtfällt, denen alles geschenkt wird: jedem Menschen, auch dem Ärmsten und Verstossensten wird immer noch so viel geschenkt, wenn man es von innen her betrachtet, und das kann die Würde ausmachen, auch wenn man sehr vernachlässigt ist.
Iwan spricht vom Raum für Kreativität (Beispiel Waldkindergärten) und föderalen Strukturen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips.
[Ergänzend in Dankbarkeit ist ein Erfolgsprinzip (2018): Interview von Antje Luz mit Bruder David:
«Was besagt das Prinzip der Subsidiarität?
Jede Entscheidung soll auf der niedrigsten Ebene getroffen werden, die dazu fähig ist. Also eine Strukturierung der Organisation von unten nach oben. Das erlaubt Selbstbestimmung und war wirklich ein ganz wichtiger Impuls, den Papst Leo XIII. da gesetzt hat. Die Tragik ist, dass es weder in der Kirche noch in der Gesellschaft richtig aufgegriffen wurde. Also wenn die Kirche das seit 1891, seit über hundert Jahren, verwirklicht hätte, dann wären wir in der Entwicklung weit voraus.»]
(35:56) Wir hören Beispiele zu Verantwortung und Freiheit / in Würde Sterben / Verlust der Würde aus Mangel an Bewusstsein, wieso ich lebe und arbeite.
Bruder David: Ein gutes Beispiel geben: Vielleicht ist es, was Würde betrifft überhaupt das einzige, das man machen kann: Seine eigene Würde leben, den anderen würdigen, und das kann sich verbreiten.
(41:14) Josef beendet das Gespräch mit Worten von Bruder Thomas:
«Unsere Hände zu einer Schale formen und uns bewusst machen, dass wir eine Aufgabe haben, dass vieles Hingabe ist, dass alles geschenkt ist und alles der Vergänglichkeit unterworfen ist.»
_________________________
[1] Gerald Hüther nennt Würde in seinem Buch Würde einen inneren Kompass, etwas, das in uns wach wird und von innen heraus kräftiger und verhaltensbestimmender wirkt als die von außen auf uns einstürmenden Verlockungen, Angebote und scheinbaren Notwendigkeiten:
«Aus neurobiologischer Sicht handelt es sich dabei um ein inneres Bild, also um ein in dieser Situation aktiv werdendes neuronales Verschaltungsmuster, das sehr eng an die Vorstellungen der eigenen Identität gekoppelt und damit zwangsläufig auch sehr stark mit emotionalen Netzwerken verknüpft ist. Es geht dabei um eine innere Vorstellung davon, was für ein Mensch jemand sein will. Für diese Orientierung bietende, vor jeder Art von Durcheinander im Hirn schützende und deshalb den Energieverbrauch dauerhaft reduzierende Vorstellung gibt es im Deutschen einen wunderbaren, wenngleich fast schon vergessenen Namen: Würde.» (19f.)
«… Und dabei bin ich auf diesen inneren Kompass gestoßen, der uns dabei hilft, nicht nur so zu handeln, dass andere dadurch nicht verletzt werden, sondern wir uns dabei nicht selbst verletzten: unsere Würde.» (44)
«Wer die Vorstellung von einem würdevollen Leben in sein Bewusstsein gehoben hat, kann nicht mehr anders als würdevoll leben.» (45)
«In unserer eigenen Beschaffenheit, oder präziser: in der inneren Organisation muss es also eine Besonderheit geben, die es nicht nur möglich, sondern irgendwann sogar zwingend erforderlich macht, dass wir als Menschen eine Vorstellung unserer eigenen Würde entwickeln … Sie hat etwas mit der enormen Offenheit und der sich daraus ergebenden lebenslangen Formbarkeit des menschlichen Gehirns zu tun.» (68)
[2] Ebd. ausführlich im zweiten Kapitel des Buches: ‹Geht es noch würdeloser?› (23-45)
[3] «In unserer heutigen globalisierten und digitalisierten Welt kann jeder, der sich lautstark genug bemerkbar macht und eine clevere Idee hat, um andere auszutricksen und über den Tisch zu ziehen, zu Ansehen, Macht und Einfluss gelangen. Und diejenigen, die damit besonders erfolgreich sind, werden dafür auch noch bewundert und erlangen eine unwürdige Vorbildfunktion, insbesondere für Heranwachsende, die noch gar keine Gelegenheit hatten, ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde herauszubilden.» (159f.)
[4] Siehe Jean-Claude Wolf: Humanismus oder warum wir keine Tiere sind: Überlegungen im Ausgang von Wladimir Solowjew
[5] Siehe das Leitwort in Gerald Hüthers Buch Würde, 5:
«Verletzt nicht jeder, der die Würde eines anderen Menschen verletzt, in Wirklichkeit seine eigene Würde?»
[6] Ebd.: «Aber auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts müssen wir feststellen: Viel zu viele Schulen sind noch immer militärisch organisiert. Sie sind Dressurstätten und dienen der Selektion. Schüler haben sich zu fügen, haben zu gehorchen, es geht hier nicht um ihren Willen. Andere über ihnen haben beschlossen, was sie wann zu lernen haben und in welcher Reihenfolge. Aus einem der schönsten Wörter der deutschen Sprache ist eine Pflicht geworden: Lernen.
Das, was jeder Mensch aus sich heraus gerne tut, sich und die Welt zu begreifen, Fragen zu stellen und wirklich nach einer Antwort zu suchen, hat hier wenig Bedeutung.» (41)
«Vielleicht beginnen Sie jetzt zu ahnen, was mich beim Anschauen der beiden Dokumentarfilme [des österreichischen Filmemacher Erwin Wagenhofer: ‹Lets make money› und ‹We feed the world›] so betroffen gemacht hat. Mir wurde damals schlagartig klar, dass unser Bildungssystem gar nicht darauf ausgerichtet ist, Heranwachsenden dabei zu helfen, ihr Empfinden für das zu stärken, was ihre Würde ausmacht, geschweige denn eine eigene Vorstellung oder gar ein Bewusstsein ihrer Würde zu entwickeln. Noch weitaus irritierender war für mich die sich daraus zwangsläufig ergebende Frage, ob es die für Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen Verantwortlichen überhaupt wichtig finden, Heranwachsenden dabei zu helfen, sich ihrer Würde bewusst zu werden. War das jemals ihr Anliegen? Hat das ihre Herzen bewegt? Weshalb haben sie sich dann nicht auch darum gekümmert? Das hieße ja, dass sie selbst sich ihrer eigenen Würde noch gar nicht bewusst geworden sind. Sonst hätten sie andere Vorschriften erlassen, andere Lehrpläne entwickelt und andere Bedingungen in den Bildungseinrichtungen geschaffen.» (154)
«Noch etwas zynischer formuliert: Heranwachsende können unter diesen Bedingungen nur genauso würdelos werden wie diejenigen, die maßgeblich für das sind, was in diesen Bildungseinrichtungen geschieht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie später, als Erwachsene, den so entstandenen Mangel eines Bewusstseins ihrer Würde in ihrem Denken und Handeln zum Ausdruck bringen, auch dann, wenn sie ihre Ausbildung mit Bestnoten abgeschlossen haben und in Führungspositionen gelandet sind.» (156)
[7] Ebd.: «Die Kernthese dieses Buches lautet: Wer sich seiner eigenen Würde bewusst wird, ist nicht mehr verführbar.» (21)
«Ein Mensch, der sich seiner Würde bewusst geworden ist, braucht weder den Erfolg beim Kampf um begrenzte Ressourcen noch irgendwelche Ersatzbefriedigungen, die ihm von Werbestrategen angeboten werden. Eine solche Person leidet nicht an einem Mangel an Bedeutsamkeit. Sie ist sich ihrer Bedeutung bewusst. Deshalb ist sie nicht mehr verführbar. Weder hat sie einen Gewinn davon noch ein Interesse daran, andere Personen zu Objekten ihrer Absichten und Erwartungen, ihrer Ziele und Maßnahmen oder gar ihrer Verführungskünste und Versprechungen zu machen.
Weil sie sich ihrer eigenen Würde bewusst ist, kann sie die Würde anderer Menschen nicht verletzen. Das wäre unter ihrer Würde.» (130)
«Beispielsweise sind Menschen, die sich ihrer Würde bewusst werden, nicht mehr verführbar. Sie verfügen dann ja über einen inneren Kompass, der ihr Denken und Handeln leitet, und sie passen auf, dass er ihnen nicht abhandenkommt. Solche Personen lassen sich von niemandem einreden, dass sie dies oder das noch brauchen, um glücklich zu sein. Plakate, Werbespots, Ratgeber und Angebote für ein besseres Leben empfinden sie als unwürdige Versuche, sie so zu behandeln, als könnten sie nicht selbst denken und eigene Entscheidungen treffen.» (174)
[8] Ebd. der Schluss des zweiten Kapitels: ‹Geht es noch würdeloser?›:
«Was also müsste einem Menschen widerfahren, der dabei ist, die Vielfalt des Lebens auf dieser Erde zu zerstören oder das im Lebendigen, also auch in jedem Menschen angelegte Entwicklungspotential zu unterdrücken? Er müsste Gelegenheit bekommen, sich zu fragen, ob das, was er tut und wie er lebt, dem entspricht, was er als seine Würde betrachtet. Nicht auf der Ebene ihres Denkens und Handelns müsste sich eine solche Person in Frage gestellt sehen, sondern auf der Ebene ihres Fühlens. Wenn das eigene Handeln in einen Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis gerät, kommt es zu einer inneren Berührung. Nur so kann ihr die Würdelosigkeit ihres Handelns bewusst werden. Wer die Vorstellung von einem würdevollen Leben in sein Bewusstsein gehoben hat, kann nicht mehr anders als würdevoll leben.» (44f.)
[9] Ebd.: «Ich wusste», sagt der Auschwitz-Überlebende Jehuda Bacon, «man kann mich zu Asche machen. Aber ich wusste auch, dass es etwas in mir gibt, das nicht sterben kann» (58)
«Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.» (Grundgesetz Art. 1) (62)
«Wenn also jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, durch das würdelose Verhalten anderer Personen in seiner eigenen Würde gar nicht mehr verletzt werden kann, so ergibt sich daraus eine sehr bemerkenswerte Schlussfolgerung: Seine Würde als Mensch kann man nur selbst verletzen. Oder wie es im ersten Artikel des Grundgesetzes formuliert ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber, so wäre nun noch zu ergänzen, diese Aussage gilt nur für alle jene Menschen, die sich ihrer eigenen Würde auch bewusst geworden sind.» (141)
«Die Vorstellung von der Würde, die jeder Mensch besitzt, ist die entscheidende Voraussetzung jeder demokratischen Gesellschaft.» (65)
[10] WÜRDE, in: Das ABC der Schlüsselworte, im Buch: Orientierung finden (2021), 164f.:
«‹Würde› ist mit dem Wort ‹Wert› wurzelverwandt. Dingen, die nur vereinzelt vorkommen, messen wir Seltenheitswert bei. Wer erkennt, dass jedes Ding, jedes Lebewesen, jedes Ereignis nicht nur selten, sondern einzigartig ist, wird sich der Würde bewusst, die allem, was es gibt, zukommt und wird ehrfürchtig durch das Leben gehen. Auch jedem Menschen steht diese Grundwürde zu. Wer dies erst einmal entdeckt, wird sich seiner eigenen Würde bewusst und weiß, dass sie nicht von der Anerkennung anderer abhängt. Ein solcher Mensch hat Rückgrat, geht aufrecht und weiß, was unter seiner Würde ist.»
[11] Ebd. die Überschrift des letzten Kapitels: ‹Wie wäre es, in Würde zu leben, bevor wir in Würde sterben?› (179)
Credo (2010)
Vortrag Freiburg von Bruder David,
zusammengestellt von Hans Businger
(05:39) «Herzlichen Dank! Ich freu mich wieder in Freiburg zu sein, ich bin sehr dankbar der Gemeinde der Ludwigskirche, der katholischen Akademie und Herrn Dr. Schwab[1] und auch dem Herder Verlag, auch für die Ausstattung des Buches, für die ich sehr dankbar bin.
Zunächst hätte ich auch gedacht, dass ich vielleicht gleich beginnen könnte, über das Buch selbst zu sprechen und über die einzelnen Teile des Buches: Je mehr ich aber darüber nachgedacht habe, um so klarer ist mir geworden, dass wir eigentlich damit auf das Gespräch nach dem Vortrag warten müssen, denn wir müssen zuerst darüber klar sein, was eigentlich ein Glaube ist, der alle verbindet. Und wenn wir uns darüber einmal klar sind, dann können wir auch die verschiedenen Glaubenssätze des Credo [Leseprobe S. 16f..] oder irgend eines anderen Textes nehmen und verstehen. Aber das kann man nicht voraussetzen.
Und so möchte ich zunächst einmal über die Voraussetzungen sprechen, das heißt:
‹Was meinen wir mit einem Glauben, der alle verbindet›?
Das können wir wieder in drei Fragen unterteilen:
‹Was meinen wir, wenn wir vom Glauben sprechen›?
‹Wen meinen wir, wenn wir sagen: a l l e , die der Glaube verbindet›?
‹Und was können wir tun, um diese gläubige Verbundenheit in uns selbst
zu nähren und überhaupt erst zu finden›?
Wenn wir diese drei Fragen beantworten können, dann wird es uns sehr leichtfallen, Glaubenssätze, auch Glaubenssätze, die uns sonst schwierig und unzugänglich erscheinen, viel besser zu verstehen und, wie gesagt, das möchte ich dann, wenn es Sie interessiert, im Gespräch mit Ihnen versuchen, denn Sie können ja dann ihre Lieblingsglaubenssätze oder die, mit denen Sie die meisten Schwierigkeiten haben, ins Gespräch bringen.
Ich muss Sie also bitten, mitzudenken, aber mehr als mitzudenken: Ich möchte Ihnen hier nicht etwas vorsetzen, sondern es ist mehr eine Einladung zum Mitdenken und darüber hinaus zum Mitnachdenken. Und was wir nachdenken wollen, ist unter anderem die Sprache: Heidegger hat den schönen Ausdruck geprägt:
‹Der Sprache nachdenken›:
So wie man einem Weg nachgeht, so kann man der Sprache nachdenken. Und wir wollen hier unter anderem auch der Sprache nachdenken, vor allem aber Ihrem eigenen Erleben nachdenken: Es kommt alles darauf an, dass wir genügend in Verbundenheit stehen hier heute Abend, dass das, was ich sage, Sie anregt, Ihrem eigenen Erleben, Ihrer eigenen Erfahrung nachzudenken und sich von Ihrer eigenen Erfahrung lenken zu lassen.
Was ich sage, entspringt meiner eigenen Erfahrung, wird aber für Sie erst dann wahr, wenn es auch Ihrer Erfahrung entspricht. Und wenn es Ihrer Erfahrung nicht entspricht, dann haben wir eben im Gespräch Gelegenheit für Sie zu sagen, da hat irgendetwas nicht gestimmt: Entweder habe ich mich dann nicht gut ausgedrückt oder unsere Erfahrungen sind sehr verschieden. Ich hoffe aber, dass ich auf so ganz grundlegende Erfahrungen zu sprechen kommen kann, von denen man voraussetzen darf, dass Sie bei allen Menschen, soweit man verallgemeinern darf, ein Echo finden.
(09:46) Wenn wir also mit der Frage beginnen:
‹Was verstehen wir unter Glauben›? ‒
und ich mich an Ihre eigene Erfahrung dabei wende, dann müssen wir zunächst die Unterscheidung treffen, zwischen Glauben und Für-wahr-halten.
Im alltäglichen Gebrauch des Wortes ‹glauben› machen wir diese Unterscheidung nicht. Jemand fragt: ‹Wird es morgen regnen›? Und jemand anders sagt: ‹Ich glaube›. Das ist nicht das ‹Ich glaube›, das man im Credo ausspricht oder in der Kirche, das ist etwas ganz anderes, das ist ein ‹Für-wahr-halten›: Es kann stimmen, es kann nicht stimmen:
Das Wort ‹Ich glaube› im Credo kommt von dem lateinischen Wort, das aus zwei Wurzeln zusammengesetzt ist: ‹Cor› ‒ ‹das Herz› und ‹do› / ‹dare› ‒ ‹ich gebe›: Ich gebe mein Herz, ich setze mein Herz auf etwas, ich spreche hier von etwas, auf das ich mich so tief verlasse, dass ich mein ganzes Herz darauf setze, das heißt ‹Credo›.
Der christliche, der religiöse Glaube, um den es hier geht, ist also nicht ein ‹Für-wahr-halten› im intellektuellen Sinn, sondern alle unsere intellektuellen Kräfte fließen auch darin ein, aber es geht um weit mehr, es geht um ein ‹Sich verpflichten›, ein ‹Sich so hingeben› daran, dass man sich für etwas verpflichtet, was daraus entspringt:
Wenn ich mein Herz auf etwas setze,
dann verpflichte ich mich auch,
etwas zu tun und danach zu handeln,
es geht also um weit mehr.
(11:53) Und wie erleben wir also jetzt am tiefsten, ursprünglichsten dieses ‹glauben›, dieses ‹sich-verlassen›, dieses ganzheitliche Vertrauen, dieses ‹sein Herz auf etwas setzen›? Wie erleben wir das im Leben?
Und jetzt gehe ich eben weit vom Credo weg auf unser allgemein menschliches Erleben, und jemand, der noch nie vom Christentum etwas gehört hat, müsste auch hier jetzt mitkommen: Das ist der Grundsatz, denn das Buch ist ja aus dem interreligiösen Gespräch entstanden und aus meiner Erfahrung, dass wir im interreligiösen Gespräch meistens sehr harmlose Texte heranziehen, mit denen jeder irgendwie übereinstimmen kann, aber man scheut sich, sehr spezifisch christliche Texte mit Buddhisten zu besprechen, weil man glaubt, die können das ja nicht verstehen, und die Buddhisten haben die gleiche Scheu, ihre ganz spezifisch buddhistischen Texte mit uns zu teilen, weil Sie immer glauben, wir verstehen das ja sowieso nicht. Das kann auf einer gewissen Ebene sogar stimmen.
Wenn wir aber wirklich auf ein interreligiöses Gespräch eingehen wollen, dann müssen wir den Glauben finden, der alle verbindet, der uns mit unserem Gesprächspartner verbindet. Und da müssen wir tiefer gehen, da müssen wir auf diesen existenziellen Glauben gehen, der sich dann in den Glaubenssätzen ausdrückt und in verschiedenen Glaubensgemeinschaften ganz verschieden ausdrückt.
Die buddhistische Lehre und Tradition ist in einer ganz andern Welt entstanden als die christliche, und ich nehme jetzt nur zum Beispiel diese beiden Traditionen: Die buddhistische ist in einer ganz andern Welt entstanden, zu einer ganz andern Zeit, in einer ganz andern Kultur, und hat sich auch im Lauf der Jahrhunderte ganz anders weiterentwickelt als die christliche. Daher darf man nicht erwarten, dass die Glaubenssätze einander ähneln.
(14:14) Aber, was jeder Glaubenstradition zu Grunde liegt, ist dieser menschliche Urglaube, ist dieses ‹uns verlassen›, ist dieses ‹unser Herz schenken›.
Und das ist jetzt eben meine These:
‹Wenn wir tief genug in irgendeinen Glaubenssatz
von irgendeiner Tradition eindringen
‒ in unsere eigene, da ist es am leichtesten ‒,
dann kommen wir schließlich zu diesem tiefen Glauben,
der uns alle verbindet›:
Das ist die grundlegende These und die wollen wir jetzt gemeinsam erarbeiten und der wollen wir gemeinsam nachspüren auf Ihrem eigenen Erleben beruhend.
Darum müssen wir mit der Frage beginnen:
‹Was sind die großen Fragen im Leben,
die unsere Gläubigkeit herausfordern›?[2]
Und da würde ich für heute Abend nur drei vorschlagen, und die erste ist:
‹Was ist denn der tiefste Grund von allem›?
Wer hat sich das nicht schon einmal gefragt. Besonders Kinder fragen das: Wir müssen oft weit zurückgehen, wir haben das schon längst vergessen, solche Fragen zu stellen, aber Kinder sind tiefe Philosophen und als Kinder haben wir uns meist auch schon diese Frage gestellt:
‹Warum gibt es denn überhaupt etwas und nicht nichts?
Warum ist nicht nichts? Warum ist etwas›?
Solche Fragen ‒ also: ‹Was ist der tiefste Grund von allem›? ‒, das ist eine dieser Fragen. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die Sie sich auch schon selber gestellt haben. Und wenn Sie sich diese Frage nicht so ausdrücklich gestellt haben, so steht sie doch weit hinter vielem in unserm Erleben dahinter ‒ weitgehend ‒, und es ist nicht umsonst, uns diese Frage ausdrücklich zu stellen.
Eine andere Frage, die auch so eine ganz grundlegende ist, ist:
‹Wer bin ich›?
Ja, wenn wir fragen: ‹Wer bin ich›? … Versuchen Sie es einmal. Sagen Sie schnell in ihrer Vorstellung jemandem ‒ sagen Sie mir, nur in ihrer Vorstellung ‒, wer Sie sind.
Auf eines kann man sich dabei immer verlassen: Alle diese Antworten haben eines gemeinsam: Sie drücken eine Beziehung aus, Sie drücken irgendeine Zugehörigkeit aus: Entweder zu einer Familie, zu einem andern Menschen, zu einem Land, zu einer Sprache, zu einer Berufsklasse, Sie drücken immer eine Zugehörigkeit aus. Wir antworten auf die Frage ‹Wer bin ich›? mit einer gewissen Zugehörigkeit. Jedenfalls ist das auch eine der ganz tiefen Fragen, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte.
Und die dritte ist:
‹Worum geht es eigentlich im Leben›?
Ich habe einmal einen gezeichneten Witz gesehen: Da sitzt jemand auf einem kleinen Planeten Erde im Weltall und rundherum sind alle die andern Planeten, und er sagt:
‹I want to know what this whole show
is all about, before it’s out.›
‹Ich möchte wissen, worum es sich bei dieser Show
handelt, bevor sie zu Ende ist.›
Piet Hein (1905-1996)[3]
Das fragen wir uns auch. Wir wollen das auch wissen. Das ist auch eine dieser großen Fragen.
(18:06) Wie kommen wir zu einer Antwort? Nur indem wir uns verlassen, nur indem wir uns auf etwas verlassen. Und das ist das Entscheidende:
Nur durch Gläubigkeit kommen wir zu irgendeiner Antwort
auf diese großen Fragen.
Zunächst:
‹Was ist der tiefste Grund von allem›?
Wir wissen nicht, woher wir kommen ‒ wir wissen es bis zu einem gewissen Grad, und wenn wir ganz weit zurückgehen wollen, wissen wir es vielleicht bis zum Urknall, aber dann vorher auch nicht mehr: Besonders weil es gar kein vorher gibt, wird das sehr problematisch.
Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Im Glauben haben manche Menschen eine tiefe gläubige Überzeugung, wohin Sie gehen, und können das sogar in einem Glaubenssatz ausdrücken, und ein Christ wird es in einer andern Weise ausdrücken als ein Buddhist oder ein Hindu ‒ da gibt es ganz verschiedene Ausdrucksweisen dafür ‒, aber letztlich, was immer wir dazu sagen in einem Glaubenssatz, ist
Ausdruck dieser tiefsten Gläubigkeit,
dass wir vertrauen, dass dieser Urgrund
‒ dieser völlig unergründliche Abgrund ‒,
dass wir uns irgendwie auf den verlassen können,
dass darin irgendwie eine Verlässlichkeit liegt.[4]
Und da sehen Sie schon, dass das ein Akt ist.
Der Glaube ist ein Akt, er ist etwas, was Sie tun müssen.
Sie können diesen Glaubensakt verweigern. Sie können einfach verweigern zu sagen, dass irgendetwas Sinn hat.
Wenn Sie sich aber darauf verlassen, dass dieser Urgrund, diese Unergründlichkeit, aus der wir stammen, auf die wir zugehen, und die ständig unter allem liegt, dass die Sinn hat ‒, wenn wir uns darauf verlassen, dann finden wir Sinn.[5]
Wenn wir uns nicht darauf verlassen, dann können wir nicht Sinn finden. Das heißt nicht, dass es zwingend ist, sich darauf zu verlassen. Aber wenn wir ein sinnvolles Leben leben wollen, müssen wir uns irgendwie darauf verlassen, uns verlassen; und das ist auch so schön wieder in der Sprache ausgedrückt:
Wir müssen uns verlassen auf etwas hin in diesem Vertrauen.
(21:04) Darüber wird noch mehr zu sprechen sein, aber ich möchte zur nächsten Frage übergehen:
‹Wer bin ich›?
Und da finden wir uns jetzt als einen Teil der unbegreiflichen Vielfalt von Dingen, die ebenso unbegreiflich ist: Wir können sie nicht greifen, denn sie ist viel zu viel ‒ sie ist ebenso unbegreiflich wie dieser Urgrund, aus dem wir stammen ‒, unbegreifliche Vielfalt und wir sind ein Teil davon:
Es gibt mich.
Wir finden uns hier vor: Es gibt mich. Wenn wir das einmal wirklich durchdenken, wirklich nachdenken über diesen einen kleinen Satz ‹Es gibt mich› ‒ unzweifelhaft:
Was ist dieses ES, das mich gibt?
Ich finde mich vor und ES gibt mich. Und ES gibt mich jeden Augenblick. Und ES gibt mich jeden Augenblick neu.
Und dieses ES ist dieser unerschöpfliche Urgrund,
aus dem jeden Augenblick die unbegreifliche Vielfalt aller Dinge hervorquillt.
Und auch darauf muss ich mich irgendwie verlassen, denn ES gibt mich. Damit muss ich mich irgendwie abfinden.
Der Glaube, der dem unergründlichen Ursprung entspringt,
ist das Sich-verlassen auf die Verlässlichkeit von allem, was es gibt.[6]
Dass ES mich gibt, das Erlebnis dieser unbegreiflichen Vielfalt, ist erfassbar im
Glauben als eine ehrfürchtige Begegnung mit dem letzten Du.
Und dieses letzte Du kann dieser Grund sein,
aus dem ich stamme, aus dem ich komme.
Ich kann mich an diesen Grund wenden im Vertrauen.
Dass ES mich gibt, bedeutet, dass ich mich an dieses ES wenden kann, das mich ständig gibt. Ich kann eine persönliche Beziehung haben zu diesem ES, das mich gibt.
Das ist ganz besonders eine christliche Betonung, aber es ist eine Urerfahrung des Menschen, die aber im Christentum ganz besonders stark betont und herausgestellt wurde. Es ist sozusagen einer der ganz großen Beiträge der christlichen Tradition zu diesem menschlichen Urglauben.[7]
Dass es diesen unerschöpflichen Urgrund gibt, dass es diese Vielfalt gibt, das ist unzweifelhaft. Und dass ich mich verlassen kann auf diesen Urgrund, das ist auch noch Glaubensgegebenheit; dass ich aber eine persönliche Beziehung haben kann mit diesem Urgrund, das ist christlich.
Das ist nicht ausschließlich christlich, aber das ist durch Jesus Christus eingeführt worden, der sich an diesen Urgrund wendet und ihn persönlich Vater nennt: Abba sogar, mit einer sehr warmen, persönlichen Beziehung.[8]
Gerade, weil es so ein warmes, persönliches Wort ist, würden wir heute ‒ eben auch wieder kulturell bestimmt ‒ Mutter sagen: ‹mütterlich›.
Dieser Urgrund, dieses Nichts, aus dem alles hervorströmt, kann man als einen mütterlichen Schoß erfahren, einen fruchtbaren Schoß, aus dem alles hervorkommt, und wir können uns liebend an dieses Andere wenden.
Das ES, das mich gibt,
kann erfahren werden im Glauben
als eine mütterliche Wirklichkeit,
an die ich mich wenden kann.
(25:31) Und da sind wir jetzt schon bei dem dritten:
‹Worum geht es letztlich im Leben›? ‒
Um die unerschöpfliche Lebendigkeit. Und die unerschöpfliche Lebendigkeit ist diese dynamische Wirklichkeit.
Wir haben das Nichts, wir haben die Fülle
und wir haben eine dynamische Wirklichkeit,
die die beiden verbindet.[9]
Und diese dynamische Wirklichkeit drückt sich auch in einer Gläubigkeit aus, und diese Gläubigkeit könnten wir jetzt Dankbarkeit nennen.
Denn ‹ES gibt mich› ‒ das ES, die Verlässlichkeit: ich verlasse mich auf dieses ES ‒, das ‹Mich› als einen Teil des Ganzen:
Der Glaube drückt sich hier als Begegnung aus, als ehrfürchtige Begegnung, als Beziehung, Bezogenheit: Ich verstehe mich immer in Bezogenheit auf etwas, in Zugehörigkeit.
Und das Dynamische drückt sich aus als Glaube in Dankbarkeit. Denn wenn ES mich gibt, dann ist die einzige passende Antwort Dankbarkeit.
Ich lebe in einer gegebenen Welt, zu einer gegebenen Zeit, unter gegebenen Umständen,
alles ist gegeben, also ist die einzige passende Antwort Dankbarkeit dafür.
Sehr schwierige Fragen erheben sich da: Kann man wirklich für alles dankbar sein? Meine Antwort ist: Nein. Kann man unter allen Umständen dankbar sein? Die Antwort ist Ja. Das können wir hier im Augenblick nicht ausführen, aber ich bin sehr gerne bereit, das dann mit Ihnen weiter zu besprechen.
Was für uns im Augenblick wichtig ist, ist, dass die Antwort auf ‹Was verstehen wir unter Glauben›? eine dreifache sein kann:
Weil ES mich gibt, können wir sagen:
Unter Glauben können wir verstehen das uns Verlassen
auf die Verlässlichkeit des Urgrundes,
wir können es verstehen als die ehrfürchtige Begegnung
mit allem, was ES gibt,
und als dynamische Dankbarkeit.
Und Dankbarkeit nicht als Danke sagen,
sondern als Danke leben, als Dank werden:
Die Vögel danken, indem sie singen, und die Blumen, indem sie blühen, und die Menschen, indem sie tun, was immer sie tun. Eine Mutter dadurch, dass sie mütterlich ist für ihre Kinder, und ein Wissenschaftler dadurch, dass er Wissenschaft betreibt, und ein Lehrer dadurch, dass er lehrt, und ein Schuster dadurch, dass er Schuhe macht. Dadurch, was wir tun, zeigen wir unsere Dankbarkeit.
Jedes Ding erweist sich dankbar dadurch, dass es tut, was es ist:
sich selbst verwirklicht.[10]
Soviel zu der Frage: ‹Was verstehen wir unter Glauben›?
(28:40) ‹Wer sind die Alle,
um die es sich hier handelt›?
Da können wir uns kürzer fassen: Alle, die es gibt. Und alle, die es gibt, sind eben alle, die ‹ES g i b t ›: Menschen, Tiere, Pflanzen, aber dort müssen wir nicht stehen bleiben, Denkrichtungen, Werte, Religionen: Alles, was es gibt, ist darunter verstanden, das ist alles, wozu wir Beziehung haben, das ist alles, womit uns der Glaube verbindet. Denn
der Glaube ist ja die Antwort darauf, dass E S alles gibt.
Und dadurch wird der Glaube auch religiös. Das macht den Glauben religiös im vollen Sinn des Wortes Religion, das von ‹Religio› ‒ ich sage das immer mit Vorsicht, weil die Etymologen nicht sicher sind, das ist jedenfalls nicht die einzige Ableitung des Wortes ‹Religio›, aber es ist die schönste und die passendste, und auch die der Wirklichkeit entsprechende ‒ ‹Religio›, Religion im besten Sinne ist Verbindung von etwas, was zerbrochen und zerrissen war, ein ‹Re-ligare›, ein ‹Wieder-verbinden›.
Dieser Glaube, der uns mit a l l e n verbindet,
ist daher der wahrhaft religiöse Glaube.
Religiosität ist aber etwas anderes als die Religionen.
Die Religionen sind kulturelle Formen, in denen sich die Religiosität ausdrückt, und die Religionen sind nicht immer religiös, und sind nicht in allen Teilen religiös.[11] Da muss man dann sehr vorsichtig sein. Wir sprechen hier von Religiosität und wir hoffen und wir bemühen uns darum, wenn wir in einer Religion aufwachsen oder in einer Religion stehen, die Religion auch religiös zu machen. Aber hier sprechen wir von Religiosität, von dem Glauben, der tiefer liegt als die Glaubenssätze und von einer Verbundenheit mit allen, die tiefer liegt als die Verbundenheit sogar mit unsern Glaubensgenossen. Vielleicht gibt es dazu auch noch wichtige Fragen.
(31:12) Und jetzt zur dritten Frage:
‹Wie können wir diese gläubige Verbundenheit in uns selber finden›?
‒ davon haben wir schon gesprochen ‒,
‹und wie können wir sie fördern›?
Aber ich möchte noch einmal einige Punkte geben, die unbedingt nötig sind, damit wir sie finden. Und das erste ist
ein furchtloses Umgehen mit andern.
Denn man sieht immer, dass Menschen, die wirklich eine Verbundenheit mit andern erleben und fühlen, immer die sind, die andern ausgesetzt waren. Und Menschen, die diese Verbundenheit nicht fühlen, sind typisch die, die auch nie andern ausgesetzt waren. Ich habe noch nicht jemanden getroffen, aber ich bin immer offen, dass es diese Möglichkeit gibt, der wirklich andern Ideen, andern Religionen ausgesetzt war, und nicht ein Verständnis für sie aufgebracht hat. Aber ich habe sehr viele Menschen getroffen, bin ihnen schon begegnet, die andern Religionen nicht nur völlig gleichgültig, sondern sogar oft feindlich gegenüberstehen, und noch nie einen Menschen von dieser Religion persönlich kennengelernt haben.
Also, persönlich andere Menschen kennenlernen, ist die erste Grundlage für diese gläubige Verbundenheit, um die es uns geht und um die es der ganzen Welt heute geht. Denn wenn wir die nicht finden, dann gibt es wenig Hoffnung für unsere Zukunft. Wir müssen diese Religionskriege ‒ und viele Kriege sind leider Religionskriege ‒ überwinden lernen.
(33:11) Ein zweiter Punkt, was wir haben müssen, um diese gläubige Verbundenheit zu finden und zu pflegen, ist
ein Verständnis für Dichtung.
Das wird Sie vielleicht überraschen, aber es ist ungeheuer wichtig, denn die wichtigsten Texte aller religiösen Traditionen sind in dichterischer Sprache ausgedrückt, auch unsere eigenen als Christen. Und wir sind uns oft dessen gar nicht bewusst. Und darum fallen wir oft in die Falle und nehmen sie wörtlich. Das wäre so, wie wenn wir ein ganz tiefes Erlebnis haben, dass sich nur in dichterischer Sprache ausdrücken kann, und es dann wörtlich nehmen. Und wenn wir ganz tiefe ‒ nicht nur religiöse ‒, sondern auch tiefe emotionale Erlebnisse haben, drücken wir sie immer ganz spontan dichterisch aus. Jeder Liebende wird sagen: ‹Ich schenke dir mein Herz›. Das hat nichts mit Herzchirurgie zu tun, und das wissen wir, das ist uns völlig offensichtlich. Aber wenn wir zu religiösen Texten kommen, die so etwas ähnliches sagen, dann nehmen wir sie plötzlich wörtlich.
Es ist uns gar nicht bewusst, zum Beispiel im christlichen Bereich: Ich nehme das nur als ein Beispiel hier, weil ich annehmen kann, dass doch die meisten von uns entweder Christen sind oder vertraut sind mit diesen Texten; und es hat wenig damit zu tun: Die Kritiker der Religionen sind ebenso oft Opfer des Wörtlichnehmens von dichterischen Texten wie die Gläubigen selbst.
Christen ist es sehr selten bewusst, dass Vater ‒ das Wort für Gott als Vater ‒ ein dichterisches Wort ist. Das heißt nicht, dass es weniger wahr ist. Es heißt nur, dass es viel mehr wahr ist als wir es anerkennen können, wenn wir es wörtlich nehmen. Oder, dass der Sohn, unsere Sohnschaft, unsere Gotteskindschaft: dass das dichterische Wörter sind. Ja, dass das Wort Gott selbst, ein ‹Wort› ist, ein mit dichterischen Werten völlig angefülltes Wort, aber ein Wort und nicht jemand. Es ist nicht so etwas wie Tisch oder Hund oder Baum, sondern es ist ein dichterisches Wort, das in eine Richtung weist.[12]
Augustinus sagt:
‹Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir o Gott.›
Und das heißt nicht: Ich kenne dich ja, und jetzt weiß ich, dass mein Herz unruhig ist, bis es in dir ruht. Nein, ich weiß nichts als mein Erlebnis, ich kenne nichts als mein Erlebnis, das unruhig ist und in eine Richtung weist, und diese Richtung nenne ich Gott. Und wenn ich etwas finde, weiß ich, das weist in diese Richtung, wenn es meinem Herzen Ruhe gibt.[13] Aber es ist nicht etwas, es ist nicht jemand. Wir sind völlig eingebettet darin.[14]
Also ein Verständnis für Dichtung ist ungeheuer wichtig, ebenso wichtig wie ein furchtloses Umgehen mit andern.
(36:57) Und ein drittes, das ich noch nennen würde, ist Dankbarkeit.
Und zwar deshalb, weil wir durch Dankbarkeit ‒ und zwar nicht nur durch eine gepflegte Dankbarkeit, nicht nur dadurch, dass wir halt dankbar sind, wenn uns was Nettes passiert, und undankbar, wenn es nicht passiert ‒, sondern eine dankbare Haltung dem Leben gegenüber, das, was dem entspricht, wie wir schon gesagt haben, dass alles Gabe ist.
Dass alles, was es gibt, Gegebenheit ist, dass wir in einer gegebenen Welt leben.
Diese Art von dankbarem Leben, die versetzt uns in das Jetzt.
Denn dankbar kann man immer nur im Jetzt sein. Man kann für die Vergangenheit dankbar sein, man kann für die Zukunft dankbar sein, aber man kann nur im Jetzt dankbar sein.
Und wenn wir im Jetzt sind, dann sind wir in unserem Selbst. Dann sind wir mit unserem wahren Selbst verbunden. Und dann müssen wir die Unterscheidung treffen zwischen unserm Selbst und unserm Ich. Nur unterscheiden, nicht trennen: Nicht das eine gut machen und das andere schlecht, aber das Ich ist immer in der Zeit eingebaut. Und wir können uns mit dem Ich identifizieren und dann geht alles schief. Dann stecken wir in der Zeit drinnen, dann sind wir vereinsamt, dann sind wir abgesetzt von andern, die sich auch mit ihrem Ich identifizieren: Im Augenblick, wo wir im Jetzt sind, sind wir mit unserm Selbst verbunden, und dieses Selbst ist eines, das uns alle vereint. Es ist eines für uns alle.
Wir können das auch anders angehen, vielleicht etwas leichter: Wir alle wissen, dass wir unser Denken beobachten können. Wir können sozusagen innerlich einen Schritt zurückmachen und uns beobachten beim Denken und bemerken, dass wir unser Denken gar nicht so im Griff haben, wir können nicht aufhören zu denken: es denkt uns. Wir sollten das Denken als ein Werkzeug verwenden können, aber stattdessen geht es immer vor und wir können dem gar nicht Einhalt gebieten.
Also wir können das beobachten. Trotzdem identifizieren wir uns so leicht mit dem Denken. ‹Ich denke, daher bin ich›: Stimmt! Aber es geht noch einen anderen Schritt zurück: Das Ich, das ich bin, ist nicht nur das denkende Ich, sondern ist das Ich, das das denkende Ich beobachten kann. Und dieser Beobachter, dieser innere Beobachter ‒ da richte ich mich wieder an ihre Erfahrung ‒, den kennen Sie doch, diesen inneren Beobachter ‒, der ist einer für uns alle, das ist unser Selbst, der Beobachter.
Man kann es noch einmal anders sagen: Wir haben alle eine Identifikation. Leider brauchen wir heute bei vielen Anlässen einen Identifikationsschein: irgendeinen Fotoausweis, den wir vorweisen können. Wir haben sogar viele Identifikationen: Eine Frau kann Mutter sein, sie kann zugleich Lehrerin sein, sie kann zugleich Ärztin sein, was immer:
Wir haben viele Identifikationen, aber wir haben nur eine Identität. Und diese eine Identität als Menschen ist uns allen gemeinsam. Wir sind Menschen. Wenn wir den Beobachter finden, dann haben wir das Selbst gefunden, die Identität, die uns mit allen verbindet. Und darum ist das so wichtig, denn die Dankbarkeit führt uns jedes Mal, wenn wir dankbar sind, in das Jetzt, und dadurch in das Selbst, und dadurch in die Verbundenheit.
Das ist ein Weg, und vielleicht der königliche Weg, in dem wir gläubige Verbundenheit mit allem ‒ allem, was es gibt ‒, fördern und pflegen können.
(41:30) Und auf Grund dieser Einsichten nun können wir das Credo durchdenken. Und das möchte ich eben gemeinsam mit Ihnen jetzt tun, aber eben im Gespräch, denn aus der Vielfalt, die uns da zur Verfügung steht, können wir nur das eine oder andere herausgreifen. Aber nur so als Ansatz:
Das Credo ist ursprünglich ein Glaubensbekenntnis der Täuflinge, die vorbereitet wurden für die Taufe, und dabei wurden sie gelehrt, was es heißt, Christ zu sein, worauf man sich einlässt, wenn man Christ wird, und dann vor der Taufe wurden sie gefragt: Was glaubst du jetzt? Was ist dein Glaube?
Die ‹Traditio›, die Übergabe des Glaubens hat feierlich an einem Sonntag stattgefunden, und am nächsten Sonntag die ‹Reditio›, und das Credo ist diese ‹Reditio›, dieses Zurückgeben des Glaubens: Hast du jetzt wirklich verstanden, worum es geht?
Sie wurden getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und das ist jetzt, was sie zurückgeben:
Das Credo ist aufgebaut in diesen drei Teilen, und was wir den unergründlichen Grund genannt haben,
was der Urglaube des Menschen als den unergründlichen Grund erfährt,
wird hier Vater genannt.
Was wir als unbegreifliche Vielfalt allen Seins erfahren haben,
wird hier der kosmische Christus genannt,
der alles umfasst, der Logos, das Wort.
Die unerschöpfliche Lebendigkeit ist der Heilige Geist,
das Leben, der Geist des Lebens, der Dynamismus.
Wir haben das Unmanifeste, wir haben das Manifeste
und wir haben den Dynamismus.[15]
(43:41) Und nun, wenn wir nur so viel einmal erfahren haben, nur so viel verstehen vom Credo, dann können wir auch schon sehen, dass ‒ wenn wir mit andern Religionen bekannt werden ‒, im Buddhismus der Schwerpunkt auf dieses Schweigen fällt, auf diesen unergründlichen Grund.
Das Schweigen spielt eine ebenso wichtige Rolle im Buddhismus wie bei uns das Wort.
Ich erinnere mich noch sehr gut, wenn ich mit meinem buddhistischen Lehrer zusammen war und geglaubt habe, jetzt habe ich einmal wirklich verstanden, was er mir erklärt hat, und habe ihm das zurückgegeben und gesagt: ‹Habe ich das jetzt richtig verstanden›? ‒, und habe versucht, es ganz genau wiederzugeben, worauf er gesagt hat: ‹Ganz genau! Aber wie traurig, dass du das in Worte fassen musst›: ‹Was für eine Schande, dass du das in Worte fassen musst.›
Im Buddhismus spielt die Stille, die Leere, das Nichts, dieser unerschöpfliche Urgrund dieselbe Rolle, die bei uns die Fülle spielt.
Und in den Amen-Traditionen, das sind die drei großen westlichen Traditionen, die das Wort Amen gemeinsam haben: Im Judentum, im Christentum und im Islam liegt alle Betonung auf dem Wort:
Es gibt mich, Es gibt das, Es gibt das,[16]
es gibt so vielerlei. Das wird betont.
Und das Wort Amen, das wir gemeinsam haben mit diesen andern Traditionen, ist ja auch kein Zufall. Denn das Wort Amen ist die menschliche Antwort auf die Amunah Gottes, und die Amunah ist die Verlässlichkeit.
Und wenn wir Amen sagen, heißt das einfach:
Ich verlasse mich auf diese letzte Verlässlichkeit.
Wieder:
In einem einzigen Wort ist der ganze Urglaube zusammengefasst
und in der Tradition des Westens ausgedrückt.
(46:06) Und die Dynamik ist, was das Wort und das Schweigen verbindet, und das ist das Verstehen.
Wenn wir wirklich verstehen, dann horchen wir so tief auf das Wort,
dass es uns hinführt in das Schweigen, aus dem es kommt.
Ein wahres, echtes Wort ist ja nicht ein Geplapper,
sondern ist das Schweigen, das zu Wort kommt.
Und wenn wir so auf dieses Schweigen horchen, dass es uns hinführt, wo es herkommt ‒ in das Schweigen zurück ‒, dann verstehen wir erst richtig.
Und das ist ebenso zentral für den Hinduismus, wie das Schweigen für den Buddhismus und wie das Wort für die westlichen Traditionen, für die Amen-Traditionen.
Ein großer hinduistischer Lehrer, den ich das Glück gehabt habe persönlich zu kennen, Swami Venkatesananda, hat das sehr kurz zusammengefasst: Yoga ‒ das ist ja die Spiritualität des Hinduismus ‒ i s t Verstehen. Und er hat noch dazu gesagt, dass das Wort Yoga wurzelverwandt ist mit unserem Wort Joch ‒ ein Joch, das zwei Ochsen verbindet ‒, und so verbindet Yoga das Wort und das Schweigen im Verstehen.
(47:32) Und wenn wir das erfahren, dann sehen wir plötzlich: Das ist ja unsere Trinität, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, völlig anders ausgedrückt in diesen andern Religionen, mit völlig anderer Betonung, aber es ist da, es verbindet uns, es ist nicht etwas, was uns trennt. Und oft ist das so dargestellt worden, als ob gerade unsere größten Geheimnisse die wären, die uns von allen andern trennen.
Je tiefer man geht und je größer das Geheimnis ist,
um so mehr verbindet es uns mit andern.
Wir können also sagen: Es gibt uns, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Und wir im Westen betonen immer das: Es gibt das und es gibt das und es gibt uns, und es gibt die andern: Wenn es uns gibt, gibt es auch die andern.
Und dann kommen die Buddhisten und sagen:
ES gibt: ES gibt uns und ES gibt die andern,
aber es ist das eine ES, das alle gibt.
Und dann kommen die Hindus und sagen: Das Wichtigste ist, dass
ES gibt. Versteh doch das: ES gibt. Lass dich darauf ein: ES gibt das alles.
So könnte man fast sagen, dass die einander brauchen: Für das volle Verständnis ‹Es gibt mich› brauchen wir schon die ganze Tradition der Menschheit, alle verschiedenen Formen, Ausformungen dieses einen tiefen menschlichen Glaubens.
Und da möchte ich mit diesem Bild schließen, denn es ist mir persönlich sehr wertvoll und schön, dass man sich die großen Traditionen der Welt ‒ alle die großen religiösen Traditionen ‒ wie in einem Reigentanz vorstellen kann:[17]
Die halten sich alle bei den Händen und tanzen rund herum. Und wir, solange wir außen stehen, sehen immer die uns am nächsten in einer Richtung gehen, und die am fernsten in der genau entgegengesetzten Richtung gehen. Und wo immer man außerhalb dieses Kreises steht, sieht man die einen in einer Richtung gehen und die andern in der entgegengesetzten Richtung.
Im Augenblick, wo man sich dem Kreis anschließt, die Hände fasst und mittanzt, ist es völlig offensichtlich, dass alle in einer Richtung tanzen.
Wenn wir uns auf diesen Glauben einlassen, dann tanzen wir alle in einer Richtung, und dass unser Gespräch heute Abend dazu beitragen wird, auch wenn nur ein kleines bisschen: Das ist mein großer Wunsch, und ich hoffe, er wird in Erfüllung gehen. Danke.»
________________________
[1] Dr. Norbert Schwab, Stellv. Direktor der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg i. Br.
[2] Im Buch Orientierung finden (2021): Geheimnis ‒ wenn uns die Wirklichkeit ‹ergreift›, 43, fasst Bruder David die drei Grundfragen ‹Was ist denn der tiefste Grund von allem›?, ‹Wer bin ich›? und ‹Worum geht es eigentlich im Leben›? in die drei Fragewörter: Warum? Was? Wie?›
«Es gibt drei existenzielle Fragen, um die wir Menschen nicht herumkommen. Früher oder später müssen wir uns ihnen stellen: Warum? Was? Und Wie? Alle drei führen uns ins Geheimnis hinein ‒ in ein Verstehen des Unbegreiflichen.»
Siehe auch das Audio in Fragen, denen wir uns stellen müssen (2016): Tag 1 ‒ Vormittag: Drei Grundfragen ‹Warum? Was? Wie›? ‒ drei Zugangswege zum dreifaltigen Geheimnis als Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen durch Tun
[3] In Orientierung finden (2021): Vorbemerkungen, 8, siehe Leseprobe, übersetzt Bruder David:
«Wüsst’ ich nur jetzt, um was zuletzt
sich alles dreht, bevor’s vergeht!»
[4] Bruder David am Schluss seines Vortrages ‹Der Weg zu Fülle und Nichts› im Audio 2.1 in Festival «Die Kraft der Visionen» (1991); siehe die Mitschrift:
«Wir sollten uns vielleicht daran erinnern, wenn wir das nächste Mal zu der bitteren Einsicht kommen:
‹Ich kann mich auf nichts verlassen.›
Ein wunderbarer Satz! Er kommt uns auf die Zunge gerade im rechten Augenblick:
‹Ich kann mich auf Nichts verlassen.›
Wirklich: Ich kann mich verlassen ‒ auf Nichts … ‹Wir können auf Wasser gehen›. Das Nichts ist auch etwas: die Fülle des Lebens entspringt daraus.»
[5] Vor mehr als 50 Jahren (1972), eröffnete Bruder David die damaligen Salzburger Hochschulwochen mit dem Vortrag Jesus als Wort Gottess, abgedruckt in: Die Frage nach Jesus (1973), 9-67. Im ersten Kapitel: ‹Das Wort und die religiöse Sinnfrage des Menschen› lesen wir:
«Was den Menschen wirklich glücklich macht, ist nur eines: Sinn. Was immer wir aber sinnvoll nennen in diesem oder jenem Zusammenhang, ist nur deshalb für uns sinnvoll, weil wir es letztlich in einem tiefsten Sinnbereich verankert wissen. Diese tiefste Sinngebundenheit der menschlichen Existenz aber ist Religion, ob wir es ausdrücklich so nennen oder nicht. Wenn wir im Folgenden vom religiösen Streben des Menschen sprechen, so soll darunter zunächst ganz allgemein die Suche nach dem Sinngrund menschlicher Existenz verstanden sein, unser Hunger nach letztem Sinn, wie wir ihn erleben in unserem unbestreitbaren Hunger nach Glück.» (10)
[6] Dreifaltigkeit: Anm. 1:
«In Augenblicken, in denen wir wirklich aus unserem Herzen leben, sind wir mit dem Herzen aller Dinge verbunden. Ganz spontan erkennen wir dann ‹die Zuverlässigkeit im Herzen aller Dinge›, wie Reinhold Niebuhr es so schön sagte.» [Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 93; bzw. Fülle und Nichts (2015), 92]
[7] Jesus als Wort Gottes (1972): ‹Vom Worte Gottes leben› als Kern jüdisch-christlicher Mystik, 28-38, siehe auch Vom Worte Gottes leben ‒ Die Versuchung Jesu im Garten (2021); Vom Worte Gottes leben ‒ Vom Festmahl des Lebens zur schmerzlichen Prüfung (2021); Gebet ‒ drei Innenwelten
[8] In Von Eis zu Wasser zu Dampf: im Wandel der Gottesvorstellungen: Was schätze ich am Christentum? (2003) schreibt Bruder David über seinen eigenen Erfahrungsweg, die christliche Gottesidee in ganz neuem Licht zu sehen und zu würdigen; siehe auch Gott: Ergänzend: 3.1.:
«Geistesgeschichtlich betrachtet war es die größte Leistung Jesu des Mystikers, dass er ‒ wie, auf andere Weise, Buddha vor ihm ‒ aus dem Bannkreis des Theismus ausbrach: Jesus erlebt sich als mit Gottes eigenem Leben lebendig. Dass er von Gott als ‹Vater› spricht, schafft Raum für liebende Beziehung, trennt aber nicht; für semitisches Empfinden sind Vater und Sohn eins. ‒ So unausrottbar war jedoch der Theismus, dass der geistige Durchbruch Jesu wie ein Leck im Boot verstopft wurde, um so schnell wie möglich den Status quo wiederherzustellen. Die Lehre Jesu musste uminterpretiert und dem theistischen Weltbild eingefügt werden. Wir dürfen, was sich da ereignete, als geistesgeschichtliche Katastrophe betrachten, es steht uns aber auch frei, es positiv zu sehen, dass in den Dogmen, die uns die Kirchenväter hinterließen, wirklich die bahnbrechende Gotteserfahrung Jesu enthalten ist, wenn auch in beinahe unkenntlicher Form.»
[9] Im mehrtägigen Flüeli-Retreat Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I, siehe besonders S. 13, 60f., 70, spricht Bruder David von zwei Bezugsachsen und ihrem Kreuzpunkt: Die Frage Warum? und das Geheimnis als unergründlichen Ursprung bilden die senkrechte Bezugsachse, die Frage Was? und das Geheimnis als unbegreifliche Vielfalt bilden die waagrechte Bezugsachse, und die Frage Wie? und die unerschöpfliche Lebendigkeit bilden den Kreuzpunkt.
[10] Bruder David bezieht sich im Credo (2015): ‹Und an Jesus Christus›, 65-69, auf das berühmte Eis-Vogel-Sonett von Gerhard Manley Hopkins (1844-1889),
«in welchem der Dichter für das Selbst-Werden ein neues Wort in der englischen Sprache prägt ‒ ‹to selve›, was man Deutsch mit ‹selbsten› wiedergeben kann. Etwas ‹selbstet›, indem es durch sein Tun aussagt, was es ist. … Jede Glocke, jede angezupfte Saite ‹selbstet› so durch ihren ganz eigenen Ton.» (66)
Siehe auch Geheimnis: Anm. 12 und Christuswirklichkeit: Anm. 2:
Im Buch Orientierung finden (2021): Geheimnis ‒ wenn uns die Wirklichkeit ‹ergreift›, 44, übersetzt Bruder David:
«Jedes vergänglich’ Ding tut eins nur und dasselbe:
stellt, was zutiefst ihm innewohnt, zur Schau:
es selbstet ‒ nennt sich, drückt sich selber aus,
es ruft, ich bin ich selbst: Nur dazu bin ich da.»
«Auf unsre Frage ‹Was›? ruft uns jedes Ding sozusagen seinen einzigartigen Namen zu und wartet nicht darauf, dass wir ihm einen geben. ‹Es selbstet.› Hopkins musste ein neues Wort prägen, um dies auszudrücken. Die Dinge ‹buchstabieren› ihr Selbst, wie er sagt, sie rufen es uns zu mit ihrem ganzen Sein, aber wir können das Wort, das jedes Ding im Innersten ist, nicht begreifen. Es entzieht sich dem Zugriff jeglichen Begriffes. Nur wenn wir uns davon ergreifen lassen, können wir es verstehen.»
[11] Siehe auch Religiosität ‒ Urquelle aller Religionen besonders in Ergänzend: 3.2.: ‹Die Religion religiös machen›, im Buch Verbunden trotz Abstand (2021), 43-64; und derselbe Beitrag: Die Religion religiös machen im Buch Andere Wirklichkeiten (1984), 195-204
[12] Siehe in Gott ‒ ‹mein Gott›: Ergänzend: 2.1., den Abschnitt aus Orientierung finden (2021): Gott ‒ das geheimnisvolle ‹Mehr-und-immer-mehr, 54:
«Das Wort ‹Gott› entstand früh in der Geschichte unsrer Sprache und geht auf die indogermanische Wurzel ‹gheu› mit der Grundbedeutung ‹rufen› zurück. Unter ‹Gott› wurde also ursprünglich ‹Das Angerufene› verstanden, vielleicht auch ‹Das uns Anrufende›. Jedenfalls schwingt bei dem Wort ‹Gott› von Anfang an die Gegenseitigkeit einer Ich-Du-Beziehung mit. Gleichzeitig war das grammatische Geschlecht des Wortes ursprünglich sächlich und so wurde die Gefahr vermindert, Gott ‒ das große Geheimnis ‒ zu vermenschlichen. Noch heute gibt es Völker und Stämme, die religiöse Vorstellungen bewahrt haben, welche in prähistorischen Kulturen verbreitet waren. Anthropologische Feldforschung zeigt, dass sie häufig Personifikationen natürlicher Kräfte wie Sturm oder Blitz verehren und dennoch, diesen ‹Göttern› übergeordnet, eine höchste Kraft anerkennen, von der sie weniger bildhaft sprechen.
So zum Beispiel Chief Luther Standing Bear (1868-1,939), wenn er sagt: ‹Aus Wakan Tanka, oft als großes Geheimnis übersetzt, kam eine mächtige vereinigende Lebenskraft, die in und durch alle Dinge floss.›
Black Elk (1863-1950) sprach von unsrer Beziehung zu dieser Kraft und von dem großen inneren ‹Frieden, der in den Seelen der Menschen herrscht, wenn sie ihre Beziehung, ihre Einheit mit dem Universum und all seinen Kräften erkennen›.
Aber er ging noch einen Schritt weiter und sprach von dieser Beziehung zugleich als einer persönlichen. Er betonte den Frieden, den die Menschen erleben, ‹wenn sie erkennen, dass im Zentrum des Universums der große Geist wohnt; und ‒ da dieses Zentrum überall ist ‒ wohnt er auch in uns.› Die Einsicht, dass wir mit dieser Lebenskraft in persönlicher Beziehung stehen, entspricht der bedeutsamen Entdeckung, dass das große Geheimnis unser großes DU ist.»
[13] im Credo (2015): ‹Ich glaube an Gott›: Was heißt das eigentlich? S. 25f.:
«Das Glaubensbekenntnis ist erst in zweiter Linie die Aufzählung verschiedener Glaubenswahrheiten; in erster Linie ist es eben persönliches Bekenntnis einer einzigen Wahrheit, nämlich, dass ich glaube. Das bedeutet, dass mein Vertrauen auf etwas stark genug ist, um mein Herz darauf zu setzen. Und was immer das ist, nennen wir Gott. In diesem ersten Satz des Credos bedeutet Gott noch nicht mehr ‒ allerdings auch nicht weniger ‒ als das, worauf ich mein äußerstes Vertrauen setze. Weitgehend noch inhaltslos, ist das Wort Gott hier einfach Wegweiser in die Richtung jener vertrauensvollen Zugehörigkeit, die allein dem Leben Sinn schenkt.
Hier am Beginn des Glaubensbekenntnisses ist uns noch kein Bild für Gott gegeben … Hier steht Gott nur erst einmal für den Zielpunkt der abgrundtiefen, unaustilgbaren Sehnsucht des menschlichen Herzens nach letztem Sinn. Von dieser Sehnsucht lässt sich aber das Vertrauen auf ihre Erfüllung nicht wegdenken; unser Vertrauen, dass sie gestillt werden wird, gehört wesentlich zu ihr. Und dieses Vertrauen ist der Ur-Glaube an Gott.»
[14] Immer wieder zitiert Bruder David das Wort von Thomas Merton: ‹God isn’t somebody else›, siehe Audios / Text dazu in Religionen und heiles Gottesbild: Ergänzend: 3., sowie ‹In ihm leben wir, weben wir und sind› (Apg 17,28), siehe Meine BESONDERE Bibelstelle (2023)
[15] In Jesus als Wort Gottes (1972): Hinduismus in der Perspektive von Wort und Ergriffenheit, 50f.:
«‹Gott spricht›, dieses ganz prägnante Wort, ist der Schlüssel, der uns das Verständnis aufschließt für die ganze biblische Tradition. ‹Ich habe das Schweigen gehört›, dieses Paradox kann uns als Schlüssel dienen für das Verständnis buddhistischen Sinnerlebens. Ähnlich können wir als Schlüssel (freilich n u r als Schlüssel) die immer wiederholte, zentrale Feststellung des Hinduismus betrachten: ‹Atman ist Brahman, und Brahman ist Atman›; oder, wie man sagen könnte: Gott, der sich offenbart, bleibt der verborgene Gott, und Gott als der Verborgene ist wahrlich offenbar; oder: Das Wort ist Schweigen, das zu Wort gekommen ist, und das Schweigen ist Wort, das im Schweigen aufgehoben ist. Indem Gott seine Verborgenheit offenbart, verbirgt er sich in seiner Offenbarung. Das einzusehen heißt verstehen.»
Siehe auch Christuswirklichkeit: Ergänzend: 3.: ‹Ich und der Vater sind eins› ‒ ‹Atman ist Brahman und Brahman ist Atman›
[16] Auf einzigartige Weise setzt Bruder David die christliche Lehre der Dreifaltigkeit in Beziehung zum Schweigen im Buddhismus, der Betonung des Wortes im Christentum und dem Verstehen durch Tun im Hinduismus.
Bruder David verwendet im Vortrag Wie das Göttliche in uns wächst (2005) als Schlüssel für das Verständnis der drei großen Traditionen den Satz ‹Das ist es.›; siehe das Audio ‹Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen› und die Mitschrift
[17] Mit dem Reigentanz der Dreifaltigkeit endet nicht nur das Buch Credo: ‹Amen›: Persönliche Erwägungen, 237f., siehe den Haupttext in Dreifaltigkeit, sondern auch der Beitrag Jesus als Wort Gottes (1972), 65-67; die Audios dazu sind in Dreifaltigkeit: Ergänzend: 1. zusammengestellt.
Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog (2014)
Vortrag von Bruder David,
zusammengestellt von Hans Businger
Das Thema der ganzen Veranstaltung hier ist zugleich auch das Thema meines Vortrags: «Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog».
Ich möchte in drei Schritten auf dieses Thema eingehen und hauptsächlich die Begriffe klären.
Immer wieder nehme ich an Tagungen teil, an denen über irgendetwas, zum Beispiel Dankbarkeit, gesprochen wird und bei allem, was man hört kommt niemals eine Definition von dem vor, worüber gesprochen wird. Daher kommt’s zu allen möglichen Verwirrungen und Irrtümern. Das Entscheidende scheint mir, zu definieren, wovon wir sprechen.
Wir müssen uns nicht einigen auf diese Definition. Aber für die Zeit, die wir gemeinsam sind, müssen wir uns darauf einigen. Später kann man seine eigenen Wege gehen und sich verbessern.
So können wir zunächst einmal anfangen mit der Definition von Dankbarkeit, oder ‒ vielleicht ein besserer Ansatz ‒, fangen wir mal mit Achtsamkeit an.
Jeder weiß, was Achtsamkeit bedeutet: Ganz dabei sein. Wenn man achtsam ist, ist man ganz dabei. Ganz bei der Sache sein, aufmerksam sich ganz einstellen auf das, was zur Hand ist. Das Einstellen ist etwas mehr Intellektuelles; es gehört aber auch etwas Willentliches dazu: Man muss sich einlassen auf etwas.
Das ist so das Gegenteil von dem, was man in Österreich nennt: «Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!» Wir haben immer wieder diese Einstellung.
Achtsamkeit ist genau das Gegenteil: Man stellt sich drauf ein. Man lässt sich drauf ein. Und man fühlt sich hinein. Also der Intellekt, der Wille und das Gefühl: Alle drei kommen ins Spiel, wenn es um Achtsamkeit geht, und mit Leib und Seele geht man darauf ein. Dieses ein kommt immer wieder: einstellen, einlassen, einfühlen, eingehen: es geht um das hineingehen in das, worum es im Augenblick geht.
Und wenn uns das gelingt, dann werden wir völlig lebendig. Wir brauchen uns ja nur das Gegenteil vorstellen: Unaufmerksamkeit, Gleichgültigkeit, Gefühlslosigkeit: das ist nicht sehr lebendig. Je mehr wir uns einstellen, eingehen, uns einlassen, umso mehr werden wir lebendig.
Und darum ist Achtsamkeit so wichtig im Zusammenhang mit Spiritualität, denn Spiritualität kommt von dem lateinischen Wort Spiritus: Das heißt Lebensatem, und Spiritualität ist Lebendigkeit.
Achtsamkeit führt zur Lebendigkeit auf allen Ebenen. Und Lebendigkeit auf allen Ebenen, das ist Spiritualität. Das ist die Definition: Spiritualität ‒ Lebendigkeit auf allen Ebenen.
Und manchmal denken wir, dass Spiritualität so irgendwie in den oberen Regionen sich abspielt. Aber wer nicht mit dem Leib lebendig ist, der kann so ein Obergeschoss bauen und es steht auf nichts. Das ist sehr gefährlich bei der Spiritualität. Es stimmt schon, es gehören alle Bereiche dazu, auch der Bereich der Transzendenz, wirklich spirituell zu sein, heißt auch: für den Bereich der Transzendenz lebendig zu sein.
Aber wenn wir uns wirklich einlassen auf das, was zur Hand ist ‒ und das ist Achtsamkeit: Sich völlig einlassen auf das, was zur Hand ist, dann sind wir schon auch zugleich im Bereich des Transzendenten. Denn das Transzendente ist nicht ein Obergeschoss, sondern eine Dimension von allem, was es gibt. Goethe hat das sehr schön gesagt:
«Willst du ins Unendliche schreiten,
Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.»[1]
Das wäre also ein Ansatz, wie man zur Spiritualität gelangt, wenn man mit Achtsamkeit beginnt.
(05:28) Nun können wir auch mit Dankbarkeit beginnen und das hat gewisse Vorzüge, aber vielleicht auch gewisse Nachteile. Jedenfalls, wenn wir mit Dankbarkeit beginnen, dann fragen wir uns zunächst:
Was meinen wir mit Dankbarkeit?
Und wieder, so wie Achtsamkeit: ganz dabei sein, so kann man auch sagen, Dankbarkeit ist einfach Freude durch beschenkt sein.
Das ist Dankbarkeit: die Freude, die da in uns aufsteigt, wenn wir beschenkt sind.
Freude und Dankbarkeit sind ganz eng verbunden.
Wir sagen ja sogar: Wir wollen jemandem eine Freude machen. Das heißt: Jemandem etwas schenken. Und die Freude kommt aus diesem Geschenk.
Die Freude kommt aus dem Geschenk, wenn zweierlei zusammentrifft:
Erstens: Es muss wertvoll sein für uns. Wenn uns jemand etwas schenkt, was nicht wertvoll ist, werden wir vielleicht sagen: «Das war recht nett, aber es wird keine besonders große Freude auslösen.
Und es muss wirklich geschenkt sein. Wenn es sich später herausstellt, dass das nur eine Leihgabe ist, oder, dass wir dafür dann doch noch bezahlen müssen auf irgendeine andere Art, so ist das nicht ein volles Geschenk. Beides muss zusammentreffen: Völlig geschenkt und wertvoll.
(07:12) Und bis hierher ist Dankbarkeit noch nicht «dankbar leben».
Und es erscheint mir sehr wichtig, zu betonen, dass hier in unserm Treffen es um «dankbar leben» geht und das muss man klar unterscheiden von Dankbarkeit, die hie und da mal auftritt, wenn uns etwas offensichtlich Wertvolles geschenkt wird.
Es ist nicht eine spontane Reaktion oder Antwort auf ein Geschenk, sondern ist eine Haltung dem Leben gegenüber.
So wie auch Achtsamkeit im Leben jedes Menschen auftritt, wenn der Wecker läutet wird man achtsam, ob man es will oder nicht: Aber Achtsamkeit im Sinne einer spirituellen Praxis ist eine Lebenshaltung der Achtsamkeit.
Und so gibt es eine Achtsamkeit, die hie und da auftritt, dann die Achtsamkeit, die spirituelle Praxis ist, und eine Dankbarkeit, die halt hie und da auftritt, und eine Dankbarkeit, die eine Lebenshaltung ist: dankbar leben.
Und um den Schritt zu dankbarem Leben zu machen, müssen wir uns also im Sinn behalten: Es geht um etwas Wertvolles, das uns geschenkt wird: Dann steigt diese Freude der Dankbarkeit auf ‒ und wer will nicht diese Freude?
Aber die ganz entscheidende Einsicht ist, dass uns in jedem Augenblick etwas geschenkt wird, was wir uns unter keinen Umständen selber erwerben, kaufen, eintauschen oder sonst irgendwie verdienen können: Und das ist das Jetzt: dieser gegebene Augenblick mit allen den Gelegenheiten, die er uns bietet. Das ist das Entscheidende.
Dankbarkeit kennt jeder Mensch, kennt schon jedes Kind. Dass Dankbarkeit zur Freude führt, wissen wir auch, also wollen wir eigentlich Dankbarkeit, weil wir Freude wollen. Darum geht’s im Leben. Wer will das nicht?
Aber jetzt: dass jeder Augenblick das Wertvollste von allen Geschenken gibt, nämlich die Gelegenheit etwas zu tun.
Wenn uns der nächste Augenblick nicht gegeben wäre, wäre nichts gegeben, überhaupt nichts. Kein anderes Geschenk, das man sich erträumen oder vorstellen kann, ist uns gegeben. Es ist uns alles dadurch gegeben, dass uns jeder Augenblick Gelegenheit bietet. Und also richtet sich die Dankbarkeit eigentlich letztlich immer auf Gelegenheit. Meistens die Gelegenheit uns zu freuen, manchmal auch die Gelegenheit, etwas zu lernen; das kann schwieriger sein: an etwas zu wachsen, gegen etwas zu protestieren: Es gibt schwierigere Gelegenheiten.
Aber in jedem Augenblick können wir dankbar sein, obwohl wir nicht für alles dankbar sein können.
Jeder von uns kann im Augenblick viele verschiedene Dinge nennen, für die wir nicht dankbar sein können, für die kein Mensch dankbar sein kann. Wir können nicht dankbar sein für Krieg, Gewalttätigkeit, für Ausbeutung, Unterdrückung, Zerstörung der Umwelt, Untreue ‒ tausende Dinge, für die niemand dankbar sein kann.
Aber auch in dem Augenblick, wo wir konfrontiert sind, mit etwas, wofür wir nicht dankbar sein können, können wir dankbar sein für die Gelegenheit, die uns das bietet. Und wenn es nicht die Gelegenheit ist, uns zu freuen ‒ und wie oft es die Gelegenheit ist, uns zu freuen ‒, sehen wir erst, wenn wir beginnen, dankbar zu leben. Aber wenn es nicht die Gelegenheit ist, uns daran zu freuen, dann ist es die Gelegenheit, daran zu wachsen. Und das ist auch ein wichtiges Geschenk, ganz großes Geschenk. Oder ‒ wie gesagt ‒ zu protestieren. Das kann etwas sehr Wichtiges sein. Besonders auch, wenn es um Schwierigkeiten geht, mit denen Andere konfrontiert sind. Um anderer willen sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen: So geht es nicht!
(12:01) Also Dankbarkeit, haben wir gesagt, ist die Freude des Beschenktwerdens.
Und dankbar leben heißt jeden Augenblick auf das Beschenktwerden achtsam sein.
Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Achtsamkeit: Jeden Augenblick können wir achtsam darauf achten, uns darauf einlassen, dass uns in diesem Augenblick eine einzigartige Gelegenheit geschenkt wird.
Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf die Achtsamkeit, denn die Achtsamkeit ist als solche vollkommen wertvoll und vollkommen bejahenswert.
Aber es hat sich leider etwas herausgestellt, und zwar in der Art wie die Achtsamkeit jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten ‒ vorher hat ja kein Mensch über Achtsamkeit überhaupt gesprochen, aber so in den letzten beiden Jahrzehnten langsam, langsam die Achtsamkeit ins allgemeine Bewusstsein getreten ist ‒, stellt sich heraus, dass eine gewisse Verschiebung, eine gewisse Verlagerung, ‒ entweder darin, wie die Achtsamkeit gelehrt wird, oder darin, wie sie verstanden wird, oder beides ‒, es sich ein bisschen auf das Ich verschiebt. Es wird ein bisschen egoistisch:
Das: ich lasse mich ein, ich merke auf, ich bin aufmerksam auf meine Eindrücke: das wird sehr betont:
Ich lasse mich ein auf meine Bewertungen, auf meine Wünsche. Ich fühle ‒ das ist sehr betont ‒, meine Gefühle ‒ wie fühle ich mich?
Und wir sehen plötzlich, dass eine andere Dimension, die zum Ganzen dazugehört, vernachlässigt wird.
Da hab ich vor ungefähr eineinhalb Jahren, im Oktober 2012 in einem Dialog mit dem Dalai Lama das auch zur Sprache gebracht, und auch der Dalai Lama findet stark, dass diese Achtsamkeit jetzt oft missverstanden wird, in diesem «egoistischen» Sinne missverstanden wird, und darum war er auch sehr offen für die Möglichkeit, dass eben dadurch, dass man den Ansatz vielleicht nicht zunächst mit der Achtsamkeit macht, sondern mit der Dankbarkeit, die Gelegenheit, also die Beziehung, die Bezogenheit, die Gegenseitigkeit, gleich von Anfang an hineinbringt.
Es handelt sich dann nicht nur um «meine Eindrücke», sondern um das: Wovon werde ich jetzt beeindruckt? ‒ Der Augenblick ist die Gelegenheit achtsam zu sein auf das, was auf mich zukommt, mich anspricht: auf die Gelegenheit eben, nicht auf meine Wünsche und Bewertungen, sondern auf die Gelegenheit, die das Leben mir bietet. Und nicht nur auf meine Gefühle, sondern auch auf alles, was diese Gefühle auslöst, und dadurch auch auf die Gefühle aller andern.
Es ist nur ein ganz feiner Unterschied, es ist keineswegs so ein großer Gegensatz schwarz und weiß ‒ schon überhaupt nicht ‒, hellgrau und dunkelgrau ‒nicht einmal das ‒, es ist beides:
Dankbarkeit ist Achtsamkeit in Beziehung und Achtsamkeit führt unweigerlich zu Dankbarkeit.
Aber es ist jetzt so ‒ dadurch, dass Achtsamkeit jetzt sehr in aller Munde ist, und diese Verlagerung auf das «Egoistische» hin zulässt ‒, es sehr wichtig sein könnte, jetzt auch die Dankbarkeit zu unterstreichen und zu betonen.
(16:39) Und jetzt möchte ich das noch auf zwei anderen Ebenen ein bisschen erläutern.
Warum ‒ erstens ‒, warum es so leicht ist, die Verschiebung auf das Ego hin? Wir müssen uns ja erst überhaupt bewusst werden: Was meinen wir mit Ego? Was geht denn da überhaupt vor? Also auf der persönlichen Ebene möchte ich da noch einmal überprüfen ‒ gemeinsam ‒ und dann die Implikationen für die gesellschaftliche Ebene noch auf einer weiteren Basis.
Jeder weiß, dass, wenn ich sage: Achtsamkeit neigt dazu, vom Ego ein bisschen vereinnahmt zu werden, oder bietet die Möglichkeit mehr so als Dankbarkeit, dann weiß jeder, Ego ist etwas Negatives. Aber das genügt nicht: Wir müssen uns genau bewusst sein: Was meinen wir eigentlich mit «Ego»?
Da müssen wir beginnen mit einer sonderbaren sprachlichen Tatsache ‒ die Sprache hilft uns da immer sehr, Heidegger hat sein ganzes Philosophieren «ein der Sprache nachdenken», nicht über die Sprache, sondern «der Sprache nachdenken»[2] genannt, also wie man einem Weg nachgeht, so kann man auch der Sprache nachgehen, und wenn wir das versuchen, dann können wir beginnen, uns zu wundern, warum wir manchmal Ich sagen und manchmal Ich selbst.
Eine meiner Sprachlehrerinnen hat immer wieder betont, wenn’s zwei verschiedene Ausdrücke sind, bedeutets zwei verschiedene Dinge. Nicht sagen: «Das ist das», nie ist eins das andere: Wenn’s zwei verschiedene Wörter oder Ausdrücke sind, sind’s zwei verschiedene Dinge.
Was meinen wir, wenn wir Ich sagen und was meinen wir, wenn wir Ich selbst sagen?
Da kann uns ein Gedankenexperiment helfen. Ich selbst kann mein Ich beobachten. Das können wir jetzt im Augenblick schon tun. Jede, jeder von uns kann unser Ich ‒ wir können unser Ich beobachten. Wie machen wir das? Man kann das nicht so ‒ nur ein bisschen so dichterisch ausdrücken, aber wir treten irgendwie zurück und sehen uns da, so wie wenn wir in einem Traum uns selber sehen. Aber es ist einfach eine Tatsache, eine Gegebenheit. Wer von uns ‒ hat jemand Schwierigkeiten jetzt zum Beispiel, im Augenblick, sein Ich zu beobachten? … Ich sehe keine Hände, es ist uns allen möglich. Vielleicht beobachten Sie zur Zeit auch noch den Beobachter. Da ist das Ich ‒ das sitzt da irgendwo ‒, der Beobachter, und dann ist noch jemand, der den Beobachter beobachtet: Dann sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wir müssen noch einen Schritt zurücktreten ‒ auch nur eine dichterische Ausdrucksweise ‒, aber wir wissen, was damit gemeint ist ‒ wir müssen zurückgehen, bis wir der Beobachter sind, den niemand mehr beobachten kann. Das ist das Selbst. Und wenn ich sage: Ich selbst, dann stelle ich mich in einen Doppelbereich hinein. Darauf kommen wir dann noch zu sprechen.
(20:41) Ich erlebe etwas Doppeltes: Ich erlebe mich als Ich und ich erlebe dieses Ich als Ausdruck des Selbst. Mein Selbst drückt sich in diesem Ich aus.
Und da ist jetzt ein ganz großer Unterschied zwischen dem Ich und dem Selbst, den wir sofort bemerken: Mein Ich ist völlig einzigartig, ist ganz unvergleichbar mit jedem andern. Ich glaube, selbst wenn wir Zwillinge sind, sind wir völlig anders als unsere Zwillingsschwester oder der Zwillingsbruder, sind ganz einzigartig und einzigartig in der Geschichte. Nie wieder wird jemand kommen, der auch schon physiologisch diese Eltern und Ureltern und Vorfahren hat, diese Geschichte, in diesem Augenblick in diese Familie geboren wurde, mit so einer Lebensgeschichte. Wir sind ganz einzigartig, voneinander unterscheidbar. Und wir haben eine gewisse Größe und eine gewisse Lebenslänge. Alles das kann man messen und wir sind im Bereich der Materie. Unser Ich ist im Bereich der Materie.
Unser Selbst ist eines. Wenn wir wirklich soweit zurückkommen, wo wir der Beobachter sind, den niemand mehr beobachten kann. Wir sind ja alle dort, wir erleben‘s ja, wir können ja dorthin gehen. Was unterscheidet uns dort? Nichts. Es gibt nichts, wodurch wir uns ‒ die «Selbste» ‒ unterscheiden können. Es gibt nur ein Selbst und das ist unser gemeinsames Selbst. Und ‒ es ist zwar nur eine Ausdrucksweise zu sagen, dass das Ich jetzt eine Ausdrucksweise dieses Selbst ist, aber es passt. Und es hilft uns auch, unser Leben irgendwie zu verstehen.
Ein Bild, das da sehr hilfreich sein kann, ist das Selbst so wie ein Puppenspieler ist, der mit verschiedenen Puppen ein Stück aufführt. Im Kloster Gut Aich, wo ich jetzt sehr viel Zeit verbringe, haben wir immer am ersten Sonntag des Monats Kindergottesdienst und nachher Kasperltheater, viel anziehender für die Kinder als wie der Gottesdienst. Und eine Person kann da ‒ wie wir alles wissen ‒ ein ganzes Stück spielen. Die Prinzessin wird ausgezogen, stattdessen wird der Drache angezogen oder der Prinz kommt mit der einen Hand und das Krokodil mit der andern. Es ist ein und dieselbe Schauspielerin, die verschiedene Rollen spielt. Und es ist hilfreich sich vorzustellen, dass das Selbst, das eines für uns alle ist, alle unsere Rollen spielt. Und wenn wir uns dessen bewusstwerden, und jedes Mal, wo wir Ich selbst sagen ‒ das sagen wir immer, wenn wir sehr betonen wollen, wer wir wirklich sind, sonst aber Ich: Ja, Ich selbst ‒ das ist sehr betont, jedes Mal, wenn wir Ich selbst sagen, haben wir ausgedrückt, dass Ich eben nur eine Rolle bin, die dieses Selbst spielt.
Und wenn ich mir dessen bewusstwerde, schaue ich ja die Andern ganz anders an: das ist ja nur die andere Hand, die da spielt. Es ist ein und dasselbe Selbst und das ist mein Selbst, das spielt auch mich. Das kann sehr hilfreich sein.
Aber das Spiel wird sehr ‒ wie wir alle wissen ‒ dieses Spiel des Lebens kann sehr spannend werden. Spannend in dem, was vorgeht und spannend durch die Spannungen, die entstehen, ziemliche Spannungen zwischen dem Krokodil und den anderen Figuren, die da spielen.
Und in dieser Spannung kann es vorkommen ‒ und leider kommt es häufig vor ‒, dass das Ich ‒ das Ich ist diese Figur, das Ich ist die Rolle ‒ dass das Ich vergisst, dass es ja eigentlich das Selbst ist, es ist nur ein Ausdruck des Selbst. Und im Augenblick, wo das Ich das Selbst vergisst, ist es das Ego geworden.[3] Und jetzt haben wir das Ego gefunden. Wo ist das Ego? Das Ego ist das Ich, das das Selbst vergessen hat.
Nun spielt sich das aber nicht so schlagartig ab, sondern es ist wie eine Skala, eine lange fließende Skala, und auf der einen Seite wird’s mehr und mehr Ego und auf der anderen Seite wird’s mehr und mehr «Selbst». Und wenn wir uns unsere Bekannten und Verwandten anschauen, dann sehen wir, dass manche mehr auf der Ego-Seite sind und andere mehr auf der Selbst-Seite sind und gewöhnlich die Menschen, die wir besonders bewundern, die sind so durchleuchtend für das Selbst, dass das Ich schon fast verschwindet, es wird so ganz durchscheinend. Und beim Ego ist das Ich recht handfest.
(26:44) Warum ist das Ego aber schlecht, was ist das Problem, wenn man vergisst, dass wir alle eins sind? Darum geht’s ja: Wenn man das Selbst vergisst, hat man vergessen, dass wir alle eins sind. Warum ist das so problematisch?
In dem Augenblick beginnt alles schief zu gehen.
Und zwar das Erste, das immer passiert, ist: Wir bekommen Furcht. Wir fürchten uns. Wenn ich glaube, dass ich jetzt allein bin ‒ man braucht sich ja nur einen Augenblick in dieses Ich jetzt einlassen und ganz wirklich versuchen, das Selbst ein bisschen auszublenden und zu vergessen, dann muss ich mich ja fürchten. Da sind diese ganzen Millionen und Milliarden von anderen Ich rund und mich herum: Wir haben nichts gemeinsam oder sehr wenig und jedes Ich ist die Mitte seiner Handlungen und seines Lebens. Da muss ich mich ja fürchten, dass die Anderen mir was antun.
Also das erste, was immer der Furcht entspricht, ist Gewalttätigkeit.
Ich muss mich wehren. Das ist ganz instinktiv und notwendig. Sobald ich das Selbst vergesse, muss ich mich wehren. Ich muss mich wehren, die Anderen könnten ja mir vorankommen, auf mich steigen, höher klettern als ich. Da beginnt der Konkurrenzkampf.
Furcht führt zu Gewalttätigkeit, führt zu Konkurrenzkampf, ich muss mich wehren gegen die Anderen, ich muss ihnen zuvorkommen ‒ Konkurrenzkampf ist ja auch ein Kampf ‒, und dann kommt der Kampf ums tägliche Brot. Und das artet aus in Gier, weil ich wieder Angst habe, Furcht, dass da nicht genug ist für so viele; um Himmelswillen! ‒ ist ja nicht genug. Da muss ich mich bereichern. Da muss ich schauen, dass auch für mich genug da ist.
Also alles, was in unserer Welt zum Verderben führt: zunächst die Furcht, dann die Gewalttätigkeit, dann die Konkurrenz ‒ der Konkurrenzkampf ‒, und dann die Gier: Das entspringt alles dem Ego. Und das in unserem persönlichen Leben.
Und wenn uns das bewusst wird, dann ist es ziemlich einleuchtend, dass wir immer auf dieser fließenden Skala, zwischen dem ganz in sich verschrumpften kleinen Ego und dem weit offenen lebensfrohen Ich-Selbst, immer auf das Ich-Selbst zugehen wollen, dass wir immer uns des Selbst bewusstwerden wollen. Und wodurch tun wir das? Durch Meditation. Das war ja immer wieder erwähnt worden, schon gestern in den Vorträgen.
Wie kommen wir in Kontakt mit unserem Selbst? Durch alle die verschiedenen Formen der Meditation und der spirituellen Praxis. Auch dankbar leben ist ein ganz ebenso gültiger Weg wie jede andere spirituelle Praxis, ein Weg mit dem Selbst in Kontakt zu kommen, aus dem Selbst heraus zu leben.
Vielleicht können wir, wenn nötig, dann in der Frageperiode auch noch näher darauf eingehen.
(30:31) Jetzt möchte ich noch einen anderen Ansatz zeigen:
Denn bisher habe ich mehr über das Leben gesprochen, also um wirklich freudig zu leben ‒ und darum geht’s uns allen, auch wenn wir glauben, wir müssen uns unglücklich machen, um wirklich freudig zu leben ‒ das gibt es, nicht so selten der Fall ‒, das Ziel ist doch immer, freudig zu leben.
Um wirklich freudig zu leben, müssen wir auch mit dem Sterben auskommen. Das Sterben gehört zum Leben dazu und wir müssen irgendwie auch unser Sterben verstehen.
Sterben lernen heißt leben lernen und leben lernen heißt sterben lernen.
Und da können wir jetzt einen anderen Ansatz machen ‒ wir werden sofort sehen, wie eng die beiden verbunden sind ‒, und zwar können wir wieder der Sprache nachforschen und sehen, dass wir sagen: Ich habe einen Leib. Das ist eine sehr sonderbare Feststellung. Wer hat denn diesen Leib? Wer sagt denn das? Das ist ein Leib, der das sagt; wenn er keinen Mund hätte, könnte er es nicht sagen: Ich habe einen Leib. Ist da so ein Kleiner irgendwie, der da drinnen sitzt und einen Leib hat. Sonderbare Situation: Ich bin ein Leib, der da sagt, ich habe einen Leib. Und das ist das Geist Materie Problem, auf das wir auch immer wieder stoßen.
In unserem Selbst, weil wir eben in diesem Doppelbereich von Materie und Geist leben, kennen wir etwas, was nicht gemessen und nicht geteilt werden kann, und alles, was materiell ist, kann gemessen und geteilt werden. Aber unser Selbst kann nicht gemessen und nicht geteilt werden. Es ist eines. Und das kennen wir.
Wir kennen es nur von innen ‒und das ist der Unterschied ‒ und nicht von außen. Von außen kennen wir die Dinge, die geteilt und gezählt werden können. Es gibt eben verschiedene Perspektiven. Und die Geist Perspektive ist eine Erste-Person-Einzahl Perspektive. Von innen her erleben wir das.
Ken Wilber, mit dessen Werk sicher viele von ihnen vertraut sind, hat das ja sehr eingehend und am besten von allen, die darüber schreiben, dargestellt, dass wir immer, was er die Quadranten nennt, beobachten müssen. Also wir müssen beobachten: In welcher Perspektive sprechen wir jetzt? Und über den Geist können wir nur in der ersten Person sprechen. Über die Materie in der dritten Person.
(33:58) Und jetzt leben wir in diesem Doppelbereich: Wir sind Leib und haben Leib. Und das ist die Aufgabe in unserem Leben. Und worum geht es im Leben? Worum geht es? Mit einem Wort: Um Erfahrung oder um Reife, um reif werden.
Was immer für ein Wort wir finden, wir merken, dass im Bereich der Materie ‒ also im Bereich unseres Leibes ‒ ein anderer Vorgang sich abspielt im Leben als im Bereich des Geistes.
Im Bereich des Leibes, der Materie, nehmen wir teil in dem Leben, das wir überall rund um uns beobachten können auch von außen her, und das ist, was Goethe das große «Stirb und Werde» nennt:[4]
Es beginnt mit einem Samen, es führt zu einer Geburt, es kommt zur Blüte, es treibt Früchte, es verwelkt, es stirbt. Und es bleibt vielleicht noch ein Same, der wieder aufwächst und wieder blüht und wieder Früchte trägt: Es ist dieses «Stirb und Werde.» Dem gehören wir an, dem gehört jede und jeder von uns an, weil wir eben im Bereich der Materie leben.
Im Bereich des Geistes geht es um etwas ganz anderes. Da geht es nicht um Entwicklung, sondern um etwas, was man Anreicherung nennen könnte.
Brigitte hat gestern schon in ihrem Vortrag auf das schöne Wort von Rilke hingewiesen, der sagt von uns Menschen:
«Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Wir heimsen den Nektar des Sichtbaren ‒ und das heißt, den Nektar des Sichtbaren und mit allen Sinnen Erfahrbaren: darum leben wir in dieser Körperlichkeit im Bereich der Materie ‒ Wir heimsen den Nektar des Sichtbaren in die große goldene Honigwabe des Unsichtbaren.»[5]
Und das ist der Bereich des Geistes. Das ist, was ich Anreicherung nenne und das kann niemand von außen beobachten, das können wir nur aus eigener Erfahrung, nur von innen her.
Dinge, die großartig von außen ausschauen, tragen vielleicht sehr wenig zu unserer Bereicherung innerlich bei. Und andere Kleinigkeiten, die sonst von außen kaum jemand bemerkt, können uns unglaublich Reichtum schenken.
Also, so wie wir im Bereich der Materie diesem «Stirb und Werde» angehören, so geht es im Bereich des Geistes um Erfahrungsreichtum: um Erfahrungsreichtum ansammeln.
Und wenn wir das sehen, dann haben wir schon einen Zugang, nicht nur zu dem, worum es im Leben geht ‒ eben in diesem Doppelbereich um zweierlei, das innigst miteinander verwoben ist ‒, sondern wir haben auch Zugang zu dem Sterben:
Das Sterben kann sich nur auf das Materielle beziehen.
Das, was nicht geteilt und nur innerlich erlebt werden kann, ist nicht diesem Sterben unterworfen.
Und das kann ein großer Trost sein, nicht was äußerlich Beweiskraft hat, aber etwas, das innerlich Trost und Stärke geben kann. Dass wir in diesen großen goldenen Honigwaben etwas ansammeln, was durch unser Sterben, das eben zum Leben gehört ‒ zum Leben gehört das Sterben ‒, überhaupt nicht betroffen wird, sondern eben: Sein ist über den Tod erhaben. Sterben ‒ Tod ist nicht das Gleiche.
(38:48) Also damit, was ich jetzt gesagt habe, wollte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diese Unterscheidung zwischen dem Ego und dem Selbst klar zu sehen, weil die so viel damit zu tun hat, dass Achtsamkeit recht verstanden wird und Dankbarkeit und Achtsamkeit ‒ besonders Achtsamkeit ‒ neigt dazu, von dem Ego ausgenützt zu werden.
Denn das Ego ist gekennzeichnet ‒ haben wir gesagt ‒, durch Gier und will also auch ganz gierig an sich ziehen alles, was verwendbar ist. Und wenn etwas so Nettes daherkommt wie Achtsamkeit, Spiritualität: selbstverständlich will das Ego das so viel wie möglich. Und man wundert sich manchmal, wieviel Ego da drinnen ist, und zwar nicht durch Beobachtung, sondern wenn wir auf uns selber schauen. Wir leben ja auf dieser fließenden Skala. Und wenn wir dann nach Hause kommen von so einer Tagung, wo wir uns wieder mit Spiritualität bereichert haben, … ein bisschen zu viel Ego dabei.
Noch ganz kurz möchte ich auf die soziale Ebene hinweisen, die soziale Dimension, in der sich das ausdrückt.
Wir leben in einer Zeit, in der viele von den Menschen, die in den verschiedenen Bereichen die größten und tiefsten Einsichten haben, sehen, dass es so nicht weitergeht.
Unsere Zivilisation ist jetzt wahrscheinlich 6000 Jahre alt oder älter und hat einen Punkt erreicht ‒ muss sich ja immer ändern ‒, aber hat einen Punkt erreicht, wo es wirklich so nicht weitergehen kann. Und zwar warum? Weil sie sich selbst zerstört. Also das ist der Grund, das ist eine ganz einleuchtende Antwort. Wenn etwas sich selbst zerstört, wenn etwas einen Punkt erreicht hat, wo es sich selbst zerstört, kann es so nicht weitergehen.
Und unsere Zivilisation war von Anfang an eine Ego-Zivilisation.
Sie war von Anfang an und in der ganzen Geschichte gekennzeichnet durch Gewalttätigkeit, durch Wettbewerb, Konkurrenzkampf, Unterdrückung, Ausbeutung und Gier.
Sie ist eine Pyramide.[6]
Unsere Pyramide ist das typische Bild: Eine große Zivilisation, die die Pyramiden gebaut hat, die ägyptische, war irgendwie ein Vorbild für jede Zivilisation. Kein Zufall, dass sie diese Pyramiden gebaut hat, aber jede Zivilisation, die wir gekannt haben im Lauf der Geschichte, war eine Pyramide. Und ist es immer noch. Wer oben sitzt, möchte oben bleiben und verteidigt sich mit Gewalt, hat Angst. Je höher man oben ist, umso mehr Angst hat man. Wer weiter unten ist, braucht weniger Angst zu haben, weil er weniger zu verlieren hat. Ganz unten ‒ kaum Angst.
Oben große Furcht, diese Stellung zu verlieren. Ein bisschen weiter drunten beginnt schon der Konkurrenzkampf. Und überall die Gier. Und diese Zivilisation, die wir da gebaut haben, dieses Sozialsystem, das wir gebaut haben, ist auf Angst, Gewalttätigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung gegründet und ist selbstzerstörerisch, das heißt, lebensfeindlich und widernatürlich.
Und widernatürlich ‒ dieser Ausdruck: widernatürlich ‒ zeigt uns schon, wo wir die Rettung finden können, weil ‒ wir wollen ja nicht einfach aufgeben: ja jetzt bricht alles zusammen. Ja, es bricht zusammen, aber wir müssen jede und jeder zusammen unser Bestes tun, einen Übergang zu finden, das Beste zu retten, hinüber zu retten. Und da müssen wir uns von der Natur leiten lassen.
Weil diese egoistische Zivilisation widernatürlich ist, müssen wir uns von der Natur leiten lassen. Und die Natur besteht aus Netzwerken.
Die Natur ist ein Netzwerk von Netzwerken, von einer Komplikation und von einer Feinheit, wie wir sie uns überhaupt nicht vorstellen können. Je mehr wir darüber erfahren, umso mehr staunen wir. Und so müssen wir diese Pyramide ersetzen durch ein Netzwerk von Netzwerken. Das ist unsere große Aufgabe und das sehen wir auch wieder, wenn wir klarsehen ‒ den Unterschied sehen ‒ zwischen Ich, Selbst und Ego: Ich, Selbst, Ego und unsere Erwägungen über Dankbarkeit und Achtsamkeit, haben uns darauf hingeführt.
Und von Anfang an haben wir schon immer gesagt bei diesem Netzwerk «dankbar leben», dass es eigentlich zum Ziel hat, durch die Webseite ein Netzwerk kleiner Netzwerke dankbaren Lebens zu schaffen. Und ich freu mich sehr, dass wir jetzt schon wirklich in der ganzen Welt und Rosa Paeng, unsere chinesische Freundin: Bitte steh auf Rosa, Du bist gerade gekommen ‒ Wenn sogar in China diese kleinen Netzwerke dankbaren Lebens beginnen, dann gibt uns das große Hoffnung. Und mit der großen Hoffnung möchte ich schließen und Euch ‒ jeder und jedem ‒ danken für Euren eigenen Beitrag dazu.
Br. David in der Fragerunde:
(46:15) Etwas, das so wie ein Spinnennetz ist, wo man von jedem Punkt aus die Fäden ziehen kann und alles zusammenfassen, das ist nicht die Art von Netzwerk von der wir sprechen, sondern eine Vernetzung im menschlichen Bereich heißt eine Vernetzung von Gemeinschaften, die klein genug sind, dass man noch einander irgendwie kennen kann.[7] Und wenn das nicht mehr möglich ist, wieder in kleinere noch weiter zurückgeht, bis man wieder zurückkommt, wo die kleinsten Netzwerke sind. Und das Entscheidende ist ja: Wo werden die Entscheidungen getroffen? Darum geht’s: Die Entscheidungen werden in der Natur und sollten bei uns in der Kultur immer auf der niedrigsten Stufe getroffen werden, auf der sie getroffen werden können. Und nur, wenn es um etwas geht, was weitere Bereiche einbezieht, dann auf der nächsten Stufe.
Zum Beispiel ‒ kein besonders großartiges Beispiel ‒, aber sagen wir
bei einem Eisenbahnnetz: Wie die Station angelegt ist und wie sie aufgeräumt und sauber gehalten wird, das kann an Ort und Stelle entschieden werden. Der Fahrplan muss offensichtlich auf einer anderen Ebene entschieden werden, denn dann sind mehrere Stationen beteiligt. So muss man sich das vorstellen. Und wenn es um Vernetzungen geht, sollte man sich immer fragen: Ist das eine Vernetzung, die von unten kommt, und wirklich organisch aufgebaut ist, oder ist das so ein Netz, in dem man etwas fängt.
(48:36) Die Verbindung von Mitgefühl und Dankbarkeit.
Mir scheint, das Selbst ist die Verbindung. Denn, was sich im Mitgefühl ausdrückt, ist ja: Das bin Ich selbst. Das drückt sich aus in dem Mitgefühl. Also wenn ich jemanden Andern anschaue, und wirklich als Ich selbst den Andern anschaue, und nicht als dieses verschreckte Ego, sondern als Ich selbst, dann sehe ich ja in dem Andern mein eigenes Selbst. Es ist nur ein Selbst. Und in Dankbarkeit fließt das Selbst in die Tätigkeit. So müsste man noch etwas mehr über dankbar leben sagen. Dankbar leben heißt, immer im Augenblick leben. Drum unsere kleine Übung Stop ‒ Look ‒ Go[8]. Das Stop bringt uns in den Augenblick. Wir sind immer in dem Fluss der Zeit und wir müssen uns herausnehmen in die Gegenwart.
Und wenn wir in der Gegenwart sind, im Jetzt, dann sind wir im Selbst. Und also sowohl durch Dankbarkeit ‒ im Jetzt bin ich schon im Selbst, also Dankbarkeit bringt mich ins Selbst, das ist ja das Ziel jeder spirituellen Übung ‒ und im Mitgefühl drückt sich dieses Selbst aus. Also «Selbst» scheint mir das Konzept zu sein ‒ und nicht Konzept ‒, die Wirklichkeit, die wir erfahren, die in beiden sich ausdrückt. Und drum ist es mir auch einleuchtend gewesen gestern bei deinem Vortrag, dass die Meditierenden so leicht Zugang dazu haben, sowohl zu Dankbarkeit wie zu Mitgefühl, weil: durch die Meditation gehen wir in das Jetzt und wenn wir in das Jetzt gehen, gehen wir in das Selbst.
(51:46) Die Frage, wieso wir Menschen finden, die wirklich aus dem Ich selbst leben, Ich selbst sind und wirklich dieses Selbst ausstrahlen, ohne zu meditieren?
Meine Antwort darauf ist, dass sie spontan das tun, was Meditierende mühevoll durch die Meditation tun. Sie sind mit dem Leben verbunden, dankbar verbunden. Hier im Westen, wenn sie an ihre Großeltern zum Beispiel denken oder Urgroßeltern, wenn sie sie noch gekannt haben, da hat es weder das Wort Meditation gegeben noch das Wort Achtsamkeit ‒ na ja, gegeben hat es schon, aber kein Mensch hat’s verwendet, und Spiritualität schon überhaupt nicht ‒, aber die Spiritualität der Menschen war, dankbar leben. Ich glaube, wer seine Großeltern oder Urgroßeltern gekannt hat, wird fast sicher sagen müssen, entweder: es waren sehr unglückliche Menschen oder sie haben wirklich dankbar gelebt. Und wer dankbar lebt, der strahlt dieses Licht aus. Und warum?
Also ich meine, weil dankbar leben uns mit dem Leben in Bezug setzt. Es heißt eben: Jeden Augenblick: Was bietet mir das Leben an? Und darauf antworten: Innehalten: schauen, was bietet mir das Leben an? ‒ das ist die Gelegenheit ‒ und Zusammenarbeit. Und wer das tut, der hat das, worauf Meditation hinzielt, der hat das schon. So würde ich wenigstens das beantworten. Ich hoffe, es stimmt.
(53:47) Und was die Frage betrifft, ob das Selbst göttlich ist, da muss man vorsichtig sein, was man mit Gott meint, nicht?
Also die kurze Antwort ist: Ich glaube ja, das ist die Antwort, aber man muss vorsichtig sein, denn das Wort Gott wird sehr häufig missverstanden, und es hilft sich daran zu erinnern, dass Gott ja kein Name ist, sondern eine Bezeichnung für ‒ ursprünglich sächlich ‒ das Angerufene ‒ das heißt Gott. Gott heißt ursprünglich das Angerufene. Das kann auch heißen: Das uns anruft. Das mit dem wir in Beziehung stehen, das ist das Entscheidende. Das Geheimnis, weil: sonst kann man nichts darüber aussagen ‒ das Geheimnis. Wenn man glaubt, dass man weiß, wenn man Gott sagt, dann weiß man’s nicht, das ist schon sicher. Aber solange man weiß, es ist das Geheimnis, es weist auf etwas hin ‒ auf das Geheimnis.
Zu diesem Geheimnis gehört auch unser innerstes Sein an, nämlich unser Selbst. Es ist uns ein Geheimnis, wir können ja weiter nichts darüber sagen. Wir erleben es, aber wir können es nicht begreifen, wir können’s nicht in den Griff bekommen, das heißt ja begreifen.
Also unser Selbst gehört zu diesem unbegreiflichen Geheimnis an, dass die, die das Wort «Gott» richtig verwenden, mit dem Wort «Gott» auf das hinweisen.
So würde ich sagen: Ja. Denn der Irrtum, den wir unter allen Umständen vermeiden müssen, ist, dass wir irgendwie von Gott getrennt sind. Und drum ist dieses Wort «Gott» so gefährlich, weil: wenn‘s Gott ist, bin’s nicht ich. Und Thomas Merton, den vielleicht viele von ihnen kennen, ein Schriftsteller, ein Zisterzienser, ein Amerikaner, 20. Jh., hat ganz ausdrücklich, sehr treffend gesagt: «Gott isn‘t somebody else» ‒ «Gott ist nicht ein Anderer». Wenn man denkt, ich und Gott ‒ ein Anderer ‒ schon falsch. Wir sind völlig eingetaucht in dieses Geheimnis und das Geheimnis ist völlig in uns: Das göttliche Geheimnis, wenn wir wollen.
Für viele Menschen ist es leichter, vom Leben zu sprechen. Das Leben ist ja dieses Geheimnis. Die Wissenschaft hat keine Ahnung, was das Leben ist, kann ein bisschen etwas über Leben aussagen, aber: Was ist das Leben? Und doch kennen wir’s, wir leben. Wir kennen’s von innen her: wir sind lebendig. Wir kennen die Quelle des Lebens nicht: Woher kommt Leben? Nicht: Wie entsteht Leben? Sondern: Was ist Leben? Was ist der Ursprung vom Nicht Leben, der Sprung in das Leben, in Lebendigkeit? Keine Ahnung! Wie macht man’s, wie lebt man? Keine Ahnung! Durch Leben. Wir sind völlig in dieses Geheimnis eingebettet und es ist völlig in uns.
Und das ist das panentheistische Verständnis unserer Beziehung zum Göttlichen, zum göttlichen Geheimnis. Panentheistisch heißt, so wie «pantheistisch»: Alles, was der Pantheismus sagt, und noch dazu: Ja, aber, dieses Geheimnis geht noch über alles hinaus. Alles ist dieses Geheimnis und dieses Geheimnis ist in allem und geht noch unendlich über alles hinaus. Das ist diese kleine Silbe «en», die da zum Pantheismus hinzugefügt wird. Und dieses panentheistische Verständnis des göttlichen Geheimnisses, das ist eigentlich heutzutage das Gängige.
(58:48) Gibt es nicht auch die andere Geschichte des Christentums und des Glaubens, die Tradition der Liebe, nicht nur die Gewalttradition?
«Das ist sehr wichtig, das zu betonen. Allerdings hat die nicht Geschichte geschrieben, sondern die Machtpyramide hat die Geschichte geschrieben. Aber unten durch hat’s immer wieder die kleinen Gemeinschaften gegeben, die Sangha des Buddha und unzählige Sanghas des Buddha und das Reich Gottes, das Jesus gegründet hat. Aber das typische daran ist, dass die immer wieder zerstört und unterdrückt wurden von der Machtpyramide, und wir jetzt an einer Schwelle stehen, wo die Machtpyramide zusammenbricht und mehr Menschen als früher sehen, dass die einzige Rettung ist, dass dieser Untergrund ‒diese untergründliche Wasserader der Netzwerke ‒, dass dort das eigentliche Leben ist. Und auf das zu verlassen.
(01:00:11) Und das Göttliche als die Liebe: Da muss man wieder sehr vorsichtig sein, wie man Liebe definiert oder zumindest eine Work in Definition für Liebe gibt, und da hilft mir immer ‒ es gibt ja so viele Arten von Liebe ‒ wir sprechen von Liebe: Meine ich jetzt die romantische Liebe oder die Liebe zu meinen Tieren oder die Liebe zu meinem Vaterland oder die Liebe zur Erde oder die Liebe zu ‒ alles ‒ Eltern, Kinder: Was haben sie alle, diese Formen der Liebe gemeinsam? Es handelt sich immer um ein Ja zur Zugehörigkeit, ich sage: Ein gelebtes Ja zur Zugehörigkeit.
Und das weist wieder darauf hin, das Leben, dieses Geheimnis, wir können es austauschen heutzutage: Wenn man vorsichtig ist, kann man sagen: Die das Wort «Gott« richtig verwenden, meinen das, was die Anderen meinen, wenn sie sich wirklich ganz tief auf Leben einlassen: Dieses Geheimnis, in das wir eingebettet sind und in dem wir leben, uns bewegen und sind. Und das ist Liebe, denn das ist das gelebte Ja zur Zugehörigkeit. In dem Augenblick, wo wir das Ja nicht sagen, oder auch nur ein bisschen verweigern, sind wir weniger und weniger lebendig. So würde ich das sehen. Aber danke vielmal für den Hinweis.
(01:02:28) Lässt das Bild von der Welle und dem Meer eine persönliche Beziehung zu Gott zu?
Ich habe diese Frage einmal einem meiner Zen Lehrer vorgelegt und habe gesagt: Du sprichst von unserem Leben so als eine Welle und dann geht sie wieder ins Meer zurück und jetzt haben wir Bewusstsein und Beziehung und alles Positive, was dazu gehört, und wenn wir dann zurückgehen, scheint es uns, dass wir so irgendwie in einen kosmischen Pudding zurückgehen. Und darauf hat er sehr treffend geantwortet:
«Woher hätte die Welle Beziehung und Bewusstsein und Selbstbewusstsein, wenn’s nicht das Meer hätte?»
Eine befriedigende Antwort.
Und aus unserem eigenen Erleben wissen wir: Wenn wir Ich sagen, setzt das schon eine Beziehung zum Du voraus. Und zwar zu dem Ur-Du. Es ist nicht die Summierung aller Du’s, die wir in unserem Leben treffen. Und das können wir uns auch dadurch bewusst machen, dass dieses Du, das mit meinem innersten Ich mitgegeben ist, ich immer wieder suche und in allen Menschen immer wieder suche und auch in den liebsten und nächsten Menschen nicht ganz vollkommen finde. Es ist dieses Du, dem wir unser Leben erzählen. Darum ist unser Leben eine Lebensgeschichte und nicht eine Aufeinanderfolge von Ereignissen, weil wir sie als Geschichte diesem Du erzählen durch das ich erst so Ich bin: Ich bin erst Ich, weil es dieses Du gibt. Martin Buber und Ferdinand Ebner haben das ja sehr weit ausgebaut und weitere Überlegungen angestellt.
Ich ende mit einer Geschichte vielleicht von Henry Nouwen, den viele von Ihnen auch kennen, ein belgisch amerikanischer Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts, und der war Professor in Yale eine Zeitlang ‒ an der Yale University ‒ und seine Schüler haben ihn sehr verehrt, hatte eine ganze Gruppe von Studenten gehabt, die immer bei ihm waren, und wenn er auf Reisen war, hat er dann Dias mitgebracht, das war noch die Zeit, wo man nicht mit dem Handy die Fotos gemacht hat, sondern so Dias mitgebracht hat. Und dann hat er die Dias gezeigt, wenn er zurückgekommen ist, und die Studenten waren recht geduldig und so 30, 40 Dias haben sie sich gerne angeschaut. Aber dann ist es einfach zu viel geworden, worauf Henry Nouwen gesagt hat: «Ich weiß, wie es gehen wird, wenn ich in den Himmel komme. Der liebe Gott wird sagen: ‹Henry, da bist du, zeig mir deine Dias!›»
____________________
[1] Goethes Gedichtsammlung von 1815, Abteilung «Gott, Gemüt und Welt»
[2] Martin Heidegger: Unterwegs zur Sprache, Stuttgart, Klett-Cotta 2022
[3] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014) 112-115, 150
[4] «Und so lang du das nicht hast, / Dieses: Stirb und werde! / Bist du nur ein trüber Gast / Auf der dunklen Erde.» (Johann Wolfang Goethe, Selige Sehnsucht)
[5] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014) 105-107. Br. David spricht in diesem Vortrag von Bereicherung, meint aber dasselbe wie Anreicherung.
[6] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014) 113f.
[7] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014) 114
[8] Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014) 82-92
Wie uns «dankbar leben» heil und gesund macht (2011)
Vortrag von Bruder David,
zusammengestellt von Hans Businger
(00:00) Wir alle kennen Menschen, die alles haben, alles Glück, das es brauchen würde, um wirklich Lebensfreude zu haben und die trotzdem keine Lebensfreude haben. Und wir alle kennen auch Menschen, die viele Sorgen haben, viel Unglück, von dem wir selber verschont sind, und die trotzdem von einer tiefen inneren Lebensfreude erfüllt sind.
Und so können wir gleich damit beginnen, uns zu fragen:
Was bedeutet Gesundheit?
Was bedeutet Gesundheit für mich? Nicht nur, was bedeutet sie, sozusagen in der dritten Person Einzahl, sondern in der ersten Person Einzahl: Wie erlebe ich Gesundheit? Was erleben wir, wenn wir Gesundheit erleben und erfahren? Es geht darum, diese Dinge aus eigener Erfahrung zu erleben und zu bewerten. Also ich werde immer wieder auf Ihre eigene Erfahrung zurückgreifen müssen.
Und da kommt mir persönlich ‒ und ich muss eben auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen ‒, kommt mir zunächst zu Bewusstsein: Freudige Lebendigkeit ‒ freudige Lebendigkeit.
Ich erlebe Gesundheit als freudige Lebendigkeit. Und zwar als einen hohen Grad freudiger Lebendigkeit. Es gibt ja viele Grade von Lebendigkeit. Am Morgen sind die meisten von uns nicht ganz so lebendig wie dann später am Tag. Unsere Lebendigkeit wächst. Und die meisten von uns sind dann gegen Abend so besonders lebendig. Aber es gibt immer wieder Menschen, die gerade am Morgen besonders lebendig sind und dann manchmal die anderen auf die Wände treiben, weil sie so lebendig sind, wenn die anderen noch ganz verschlafen sind.
Es gibt also Grade, Grade unserer Lebendigkeit. Und Gesundheit ist für die meisten von uns, nehme ich an, das Erlebnis einer hochgradigen Lebendigkeit. Und da kommt gleich Spiritualität herein ‒ ich werde dann eigens noch über Spiritualität sprechen ‒, aber Lebendigkeit ist schon Spiritualität. Denn das Wort Spiritualität kommt von dem lateinischen Wort spiritus und das bedeutet zunächst Lebensatem oder Atem überhaupt: spiritus ist Atem, Wind, Atem. Was lebendig ist, atmet.
Spiritualität ist also Lebendigkeit.
Und zwar wieder hochgradige Lebendigkeit,
die Erfahrung höherer Grade von Lebendigkeit.
Zum Beispiel, ein gutes Mittagessen macht uns lebendig. Es macht uns in einem höheren Grad lebendig als ein weniger schmackhaftes Mittagessen. Das kennen wir. Das wissen wir aus Erfahrung. Aber ein gutes Mittagessen, das wir noch teilen mit anderen, in Gesellschaft von anderen, macht uns mehr lebendig. Und es gibt andere Erfahrungen, die uns auf einer anderen Ebene lebendig machen, z.B. gute Musik. Das macht uns lebendig, aber auf einer anderen Ebene als ein gutes Mittagessen.
Für andere Leute ist es Dichtung, für andere ein guter Film, Theater, für viele Menschen ist Naturbegegnung, in der Natur zu sein. Jede, jeder von uns muss sich fragen:
Wie erlebe ich Lebendigkeit?
Wo bin ich persönlich am lebendigsten? Und wenn wir eine Antwort darauf geben können, dann kann man sagen: Dort beginnt für dich Spiritualität. Das ist für dich Spiritualität in der ersten Person, nicht in der dritten Person, nicht was irgendjemand anderer darüber sagt, sondern: Wie erlebe ich es? Wo werde ich lebendig? Das ist mein Ansatzpunkt für Spiritualität.
Und da werden wir dann erleben ‒ und wieder ersuche ich Sie, aus Ihrer eigenen Erfahrung zu bestätigen, dass wir umso lebendiger werden, je vernetzter unser Leben ist. Und je mehr wir allein sind und vereinzelt, umso mehr sinkt unsere Lebendigkeit ab. Je mehr wir vernetzt sind, umso lebendiger werden wir.
Oder wir können es auch umdrehen: Wenn wir uns richtig lebendig fühlen, also richtig gesund, dann merken wir auch, dass das immer mit Vernetzung zu tun hat. Zunächst, wie wir schon gehört haben, ganz wichtig: Vernetzung mit anderen Menschen, gegenseitige Beziehung, aber auch weit über menschliche Beziehung hinaus, mit der Umwelt, die ja nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt ist, wenn wir sie richtig verstehen.[1]
Gesundes Leben ist vernetztes Leben. Im weitesten Sinne vernetztes Leben. Und daher geht unsere Gesundheit weit über persönliches Wohlbefinden hinaus und hat immer zu tun mit unserem Verhalten zur Umwelt, zur Mitwelt, mit unserer weitesten Vernetzung im Lebensbereich.
Und mit dem Ja zur Zugehörigkeit: Mit unserem bewussten Ja zur Zugehörigkeit.
Und Ja zur Zugehörigkeit im weitesten Sinne, ein gelebtes Ja zur Zugehörigkeit, das ist meine Definition von Liebe. Und Sie können das ausprobieren, denn wo immer Sie Liebe erleben, und wir haben ja so viele Bereiche und so viele Grade von Liebeserfahrung: Liebeserlebnis mit unseren Haustieren, zu unserem Vaterland, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, unzählige verschiedene Bereiche und Grade von Liebe ‒ immer wird es passen: die Liebe ist ein Ja zur Zugehörigkeit.
Heil und Heilen
Und das scheint mir unerhört wichtig in diesem Zusammenhang von gesundem Leben, von vernetztem Leben, von heilem Leben. Heil heißt ja ganz. Etwas ist heil, wenn es ungebrochen ist, wenn es ganz ist. Heilen heißt wieder ganz werden von Gebrochenheit.
Heiles Leben hat also mit Gesellschaft zu tun und ein heiler Mensch, ein gesunder Mensch wirkt auch heilend. Denn es ist ja nicht nur Krankheit ansteckend, sondern weit wichtiger für uns ist zu bedenken, dass Gesundheit ansteckend ist. Gesundheit ist ansteckend. Mit einem gesunden Menschen zu leben, in Beziehung zu stehen, das heilt. Und das heilt, auch wenn unser Zustand nicht kuriert werden kann.
Da muss man unterscheiden zwischen Heilen und Kurieren. Kurieren hängt nicht immer von uns ab, wir tun unser Bestes, es ist uns nicht immer möglich. Heilung ist immer möglich! Denn sie hängt von der Beziehung, von der ganzheitlichen Lebendigkeit ab.
(07:29) Ich könnte auch Sätze aus anderen Traditionen zitieren: Für die meisten von uns ist es die biblische Tradition, die am geläufigsten ist, und da wird vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist gesprochen.
Also die Spiritualität hat jedenfalls etwas mit Geist ‒ spiritus ‒ zu tun, und da heißt es, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist das Weltall erfüllt. Der Geist Gottes erfüllt das Weltall, hält alles zusammen und spricht jede Sprache.
Wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes das Weltall erfüllt, dann können wir das ja umdrehen, das ist ja nur eine dichterische Weise, in der jemand versucht hat auszusprechen, was wir alle erleben können, wir können es umdrehen und sagen:
Ah! Was ich da erlebe als diese Lebendigkeit, das ist, was jene, die das Wort richtig verwenden, Geist Gottes nennen, der in mir lebt, der alles zusammenhält ‒ daher die Beziehung zu allem ‒, und jede Sprache spricht, also die Umwelt, Mitwelt und die sozialen Beziehungen beinhaltet.
Und das gibt uns dann schon einen Einstieg zu unserer zweiten Frage:
Und da könnte man es ganz einfach sagen: Spiritualität ist aus der Ganzheit leben. Das ist dann diese Lebendigkeit, die aus der Ganzheit kommt, aus der Verbundenheit mit allen und allem.
Und da muss ich eben wieder auf ein persönliches Erlebnis zurückgreifen, denn wir wollen ja nicht etwas über die Sache sagen, sondern Ihr Erlebnis wecken: Wo haben Sie diese Einheit mit allen erlebt? Wo haben Sie diesen Geist, Lebensatem, diese Lebendigkeit, die alles verbindet, wo haben Sie die erlebt?
(09:36) Und da können wir auf ein Erlebnis zurückgreifen, das in der Psychologie sehr gut erforscht wurde von Abraham Maslow, einem sehr großen Psychiater aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, der von Gipfelerlebnissen gesprochen hat. Und da ist es ganz interessant, sich daran zu erinnern, wie Maslow überhaupt dazu gekommen ist, dieses Gebiet zu erforschen. Und zwar hat er einige Lehrer gehabt, die er sehr bewundert hat an der Universität. Und er hat sich gefragt: Wieso sind das so große Menschen? Und dann hat er begonnen, sich zu fragen: Was macht eigentlich Menschen zu so gesunden, großen Menschen?
Was macht Menschen so gesund?
Da kommt wieder die Gesundheit herein. Er ist ein junger Psychiater und sagt sich plötzlich: Also ich bin schon Doktor der Psychologie, aber nichts hat mich darauf vorbereitet, die Frage zu beantworten, was Menschen so gesund macht. Wir haben immer nur gelernt, was sie krank macht.
Und das war ein Wendepunkt in der Geschichte der Psychologie. Maslow hat sich jetzt die Aufgabe gestellt zu fragen: Was macht Menschen so gesund?
Und das Erste, worauf er gestoßen ist, hat ihn völlig überrascht. Und er hat es so ausgedrückt: Die Menschen, die ich so bewundere, haben eines gemeinsam: Mystische Erfahrungen!
Mystische Erfahrungen! Und er hat dann damit angefangen, über mystische Erlebnisse zu schreiben. Das ist in der Psychologie gar nicht gut angekommen. Das war viel zu mysteriös für die Wissenschaft der Psychologie. Und da hat er dann schnell den Ausdruck geändert und hat es Gipfelerlebnisse genannt. Ein sehr guter Ausdruck, denn dieses Erlebnis ist ja wirklich ein Gipfel unseres Bewusstseins. Aber er hat zeitlebens darauf bestanden, dass man psychologisch die Gipfelerlebnisse nicht unterscheiden kann von dem, was in der Literatur als mystische Erlebnisse dargestellt wird. Das ist die Erfahrung des All-eins-seins, wirkliche tiefe Erfahrung des All-eins-seins mit allem: Umwelt, Mitwelt, mit sich selbst, mit der letzten Wirklichkeit.
Und die zweite Einsicht, die er gefunden hat in langen Jahren der Forschung, war, dass man sagen muss ‒ soweit man in der Psychologie verallgemeinern kann ‒, dass alle Menschen diese Erlebnisse haben. Also nicht nur menschlich herausragende Menschen und die großen Mystiker, sondern jeder Mensch.
Und Maslow ist zur Einsicht gekommen,
dass die Mystiker nicht besondere Menschen sind,
sondern dass jeder Mensch ein ganz besonderer Mystiker ist.
Und dass der Unterschied zwischen uns so gewöhnlichen Menschen und den großen, ganz gesunden Menschen darin besteht, dass sie aus ihrer mystischen Erfahrung heraus die Konsequenzen ziehen für ihr weiteres Leben. Und wir, wie die meisten Menschen, diese Erlebnisse entweder vergessen oder sogar zurückdrängen.
Wir haben alle Augenblicke, in denen wir erfahren,
dass wir eins sind mit allem.
Da bitte ich Sie, an irgendein solches Erlebnis zu denken. Und weil es Gipfelerlebnis heißt, müssen Sie nicht glauben, das muss jetzt ein Mount Everest sein, das Matterhorn, sondern es kann ja auch ein Ameisenhaufen sein, der auch ein Gipfel ist. Alles, das zu einem Gipfel kommt, ist ein Gipfel. Man kann die nicht vergleichen.
Das ist das einzig wichtige: In diesem Erlebnis des All-eins-seins war ich wirklich eins mit allem. Das muss nicht bei Gelegenheiten kommen, in denen man es erwartet, sondern das kommt oft in den unerwartetsten Gelegenheiten:
Man hat ein nettes Fest gefeiert, viele Freunde waren hier, die ganze Wohnung war voll mit Freunden, es war ein schöner Abend, jetzt sind sie alle weg, man steht allein da, furchtbar viel ungewaschenes Geschirr, eine Unordnung in der ganzen Wohnung, und plötzlich ist man eins mit allem: in diesem Augenblick nachher.
Oder viele Menschen erleben dies in der Natur ‒ vielleicht erlebt man es da sehr häufig: bei einem Wasserfall oder bei einem Regenbogen. Frauen erleben es sehr häufig bei der Geburt eines Kindes, von Eltern hören wir es immer wieder.
Es müssen auch nicht unbedingt freudige Erlebnisse sein. Es kann der Tod eines Menschen sein, ein friedlicher Tod eines Menschen, bei dem man gegenwärtig ist.
(15:02) Worauf es ankommt, ist, wir erleben dieses Einssein mit allem, und zwar mit uns selbst, mit allen und allem und mit dem Grund des Lebens, dem Lebensgrund. Und in diesen Augenblicken sind wir über ‒ da müssen Sie wirklich genau aufpassen, war das auch wirklich so bei mir? ‒ da sind wir irgendwie über die Zeit erhaben.
Es kann ein Augenblick sein, in dem sich so viel ereignet, als ob es Stunden gewesen wären, fast ein Leben lang. Es kann aber auch sein, dass eine ganze Stunde plötzlich vorüber ist, wie wenn es nur ein Augenblick gewesen wäre.
Also die Zeit verschiebt sich in diesen Gipfelerlebnissen:
Das ist das Entscheidende: wir sind wirklich im Jetzt. Und meistens sind wir nicht im Jetzt. Meistens sind unsere Gedanken 49% schon in der Zukunft und wir können es nicht erwarten oder befürchten, was sich ereignen wird, und 49% hängen wir noch an der Vergangenheit und bedauern, dass wir nicht mehr dort sind, oder wir beweinen die Umstände und sehen uns als Opfer. Wir hängen an der Vergangenheit, wir strecken uns aus in die Zukunft. Und nur ungefähr 2% sind da für unser Bewusstsein im Augenblick zu leben, im Jetzt zu leben. Und in diesen Augenblicken der Gipfelerlebnisse ‒ das ist für Maslow auch so bedeutsam ‒, sind wir im Jetzt, vollkommen, 100% im Jetzt. Und darum erleben wir diese große Befreiung:
Es ist eine Befreiung von der Zeit.
Wir sind in diesem Augenblick im Jetzt:
wir sind wirklich Wir-selbst.
Wie unterscheiden wir unser kleines Ich vom Selbst?
Wieder appelliere ich an Ihr Erleben. Versuchen Sie einen Augenblick jetzt zurückzutreten und sich zu beobachten. Sie können sich beobachten.
Ich kann mich beobachten, wie ich hier stehe und zu Ihnen spreche. Sie können sich beobachten, wie Sie dort sitzen und mir zuhören. Wir können uns beobachten. Sind wir gar zwei: wer beobachtet wen? Das Selbst beobachtet das Ich.
Wenn ich Ich selbst sage, ist das mehr, als wenn ich Ich sage. Ich selbst kann mich beobachten. Und wenn ich so weit zurücktrete, bis ich der Beobachter bin, den niemand mehr beobachten kann ‒ das kann ich nur im Jetzt tun ‒, dann bin ich wirklich Ich selbst.
Und dieses Selbst gibt es nur einmal.
Dieses Selbst verbindet mich mit allem.
Das wird von selbst einsichtig,
wenn wir diesen Punkt erreichen.
Aber wie ist dieses Selbst, dieses eine Selbst, das uns alle verbindet, nicht nur mit allen Menschen, sondern mit allen Tieren, mit dem ganzen Universum, mit der göttlichen Wirklichkeit ‒ davon haben die Mystiker jahrtausendelang gesprochen ‒, wie ist dieses Ich-selbst meiner eigenen Erfahrung mit meinem Ich verbunden?
Denn mein Ich ist ganz einzigartig, ganz ungleich von jedem anderen. Mich hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben. Nicht einmal meine Fingerabdrücke hat jemals ein anderer Mensch gehabt, noch wird jemals ein anderer Mensch haben.
Also wie ist das Selbst mit dem Ich verbunden?
Und da kann man erleben
und sich auf dieses Erlebnis einlassen,
dass mein Ich das Selbst einmalig ausdrückt.
Das Selbst ist so unerschöpflich,
dass es sich in unzähligen Ichs ausdrücken will und muss.
Und ich bin einer der vielen Ausdrücke meines Selbst.
Und so kann ich auch die anderen anschauen als einen Ausdruck, einen ganz anderen Ausdruck meines Selbst, dieses einen Selbst, das wir alle gemeinsam haben.
Und das können wir erleben in unseren Gipfelerlebnissen. Und jetzt reflektieren wir darüber. Das ist etwas anderes als von einem Gipfelerlebnis ergriffen sein. Jetzt spekulieren wir nur darüber.
Und es kommt noch etwas dazu:
Da ist zunächst unser Selbst, das uns alle verbindet, dann das Ich, diese unzähligen Ichs, in denen das Selbst sich ausdrückt, die ungeheuer wichtig sind, die einzigartig sind.
«Im Laufe meines Lebens wurde mir mehrmals die Freude zuteil,
Menschen kennenzulernen,
deren Ich das Selbst mit großer Klarheit durchscheinen ließ.
In ihrer Gegenwart fiel es mir leichter,
‹ich selbst› zu sein.
Sie machten mir bewusst,
dass auch ich ein einzigartiger Ausdruck
des einen großen Selbst bin.»
Orientierung finden (2021), 21
Wenn ich meine Rolle als dieses Ich, das ich bin, nicht spiele, gibt es keinen anderen Menschen und wird es nie geben, der diese Rolle so spielen kann wie ich. Nur ich kann diese Rolle in der Welt spielen.
Das Selbst will durch mich diese Rolle spielen.
Das Selbst ist sozusagen die große Schauspielerin,
die durch das Ich eine Rolle spielt.
Und es ergibt sich die Frage:
«Woran kann ich erkennen, dass ich meine Rolle gut spiele?
Was heißt hier ‹gut›?
Die Antwort ergibt sich aus dem,
was wir über das Selbst gesagt haben:
Sie lautet: Du musst als ‹Du selbst› spielen.»
Ebd. 22«Unsere Rolle im Leben ist kein festes Drehbuch,
und sie zu spielen, bedeutet zu improvisieren ‒
wie Schauspieler bei Improvisationsaufführungen
oder wie Jazzmusiker.
Jazz entfaltet und verändert sich ständig
auf unvorhersehbare Weise,
weil die Spieler aufeinander hinhorchen
und jeder von allen andren beeinflusst wird.»
Ebd. 21f.
«Was ein Einzelner beitragen kann, wird von seinem Instrument in all dessen Möglichkeiten und Grenzen bestimmt. Das Instrument, das wir von Geburt an mitbekommen, ist weitgehend durch Faktoren bestimmt, die nicht unter unsrer Kontrolle stehen. Die Erfüllung unserer Aufgabe, ‹gut zu spielen›, kann also nicht vom Instrument abhängen, auf das wir ja keinen Einfluss haben.» Ebd. 22
«Wie gut wir ‹unsere Rolle im Leben spielen›,
hängt nicht von unserer Veranlagung ab,
sondern davon,
dass unser Ich immer transparenter wird
für das Selbst.»
Ebd. 22«Letztendlich ist das e i n e Selbst
die große Schauspielerin,
die a l l e Rollen spielt.»
Ebd. 23
Und jetzt kann es sehr leicht geschehen und geschieht immer wieder, dass das Ich sich irgendwie irrt und i d e n t i f i z i e r t mit dieser Rolle. Das ist etwas ganz anderes als die Rolle gut zu spielen:
Wenn eine Schauspielerin die Minna von Barnhelm oder das Gretchen im «Faust» gut spielt, verkörpert sie völlig diese Rolle, vergisst aber keinen Augenblick, dass sie ja doch eine Schauspielerin ist, die diese Rolle spielt. Im Augenblick, wo sie dies vergisst und glaubt, sie sei jetzt die Minna von Barnhelm, ist sie verrückt geworden.
Und so sind wir alle verrückt. Meistens! Außer in unseren Gipfelerlebnissen. Denn wir glauben immer, wir seien diese Rolle. Wir sind sie nicht. Wir spielen sie nur.
Und die große Aufgabe jetzt, und die wird von allen Spiritualitäten der Welt ganz klar gesehen, immer wieder so ausgedrückt:
Die große Aufgabe ist es,
unser Gewicht zu verlegen auf das Selbst.
Aus dem Selbst zu leben, das uns alle vereinigt, dann unsere Rolle wirklich gut zu spielen, aber eben zu spielen und nicht drinnen gefangen zu sein. Das ist die große Aufgabe.
(21:56) Und daher kommt jetzt unsere dritte Frage: Wie können wir dankbar leben?
Und warum springe ich jetzt zum dankbaren Leben über?
Weil es für uns, für die meisten Menschen eine leicht zugängliche Methode der Spiritualität ist.
Ich könnte auch über Zen sprechen, ich könnte über Yoga sprechen, all die vielen, vielen verschiedenen Formen von Yoga usw.. Jede spirituelle Praxis, die Sie je einmal kennengelernt haben und geübt haben, passt hier herein, ist auch völlig vereinbar mit der Dankbarkeit. Aber die Dankbarkeit ist etwas, das so viel einfacher ist, weil jeder Mensch weiß, worum es geht:
So wie wenn man Kindern ein Geschenk bringt ‒ wir besuchen die Eltern und bringen den Kindern also ein Geschenk mit, und die Kinder sagen «Dankeschön», legen es weg und spielen mit etwas anderem, dann werden wir sagen: ja die waren gut erzogen, aber wir werden nicht sagen, die waren sehr dankbar dafür.
Aber wenn sie gar nicht «Danke sagen», sondern nur das Geschenk nehmen und den ganzen Nachmittag damit spielen, sagen wir: Die haben sich aber wirklich gefreut, die waren sehr dankbar dafür.
Die Dankbarkeit zeigt sich nicht im Danke sagen:
«Die Vögel danken, indem sie singen,
und die Blumen, indem sie blühen,
und die Menschen, indem sie tun, was immer sie tun:
Eine Mutter dadurch, dass sie mütterlich ist für ihre Kinder,
und ein Wissenschaftler dadurch, dass er Wissenschaft betreibt,
und ein Lehrer dadurch, dass er lehrt,
und ein Schuster dadurch, dass er Schuhe macht.
Dadurch, was wir tun, zeigen wir unsere Dankbarkeit.»
Credo ‒ Vortrag ‒ Freiburg (20. Oktober 2010)
Und, wenn wir dankbar leben als spirituelle Übung praktizieren, dann verwirklichen wir das, was jede spirituelle Praxis zu verwirklichen versucht.
Denn in dem Augenblick, wo wir dankbar sind ‒ wieder, erinnern Sie sich an einen Augenblick, in dem Sie wirklich dankbar waren ‒, sind wir im Jetzt. Man kann für die Vergangenheit dankbar sein, man kann für die Zukunft dankbar sein, dankbar sein kann man immer nur im Jetzt.
Sind wir im Jetzt, sind wir Wir-selbst.[5]
Wir sehen den Wert von etwas, wofür wir dankbar sind: eine Begegnung, einen Menschen, ein Ding, eine Situation, eine Blume, ein Tag ‒ was immer Ihnen einfällt, wofür Sie gerne dankbar sind:
Sie sehen den Wert und den Selbstwert dessen, wofür Sie dankbar sind. Also nicht Wert in dem Sinne von: wieviel kostet es? Das verschiebt ja nur den Wert, wir wollen es gar nicht, wir wollen etwas anderes dafür, wir wollen es verkaufen sozusagen. Nein, der Selbstwert, der Wert, die Einzigartigkeit: das sollte zu Ihrem Erlebnis passen, den Wert dessen, wofür wir dankbar sind.
Und das zweite ist der Geschenkcharakter: Wir sehen, dass es völlig geschenkt ist. Und dass es völlig geschenkt ist, ist so offensichtlich, wir leben ja in einer gegebenen Welt, wie wir sagen, in einem gegebenen Augenblick.
Es ist gegeben, es ist uns gegeben: Es gibt das, es gibt das, es gibt alles. Alles, was es gibt, ist gegeben.
Augustinus sagt: «Alles ist Geschenk, alles ist Gnade.»
Das ist eine ganz tiefe Einsicht.
Und wenn diese beiden zusammenkommen:
Wertschätzung und zu sehen: das ist ein Geschenk, dann sind wir dankbar. Und wenn wir dankbar sind, werden wir lebendig.
Lebendigkeit ist eine Funktion der Dankbarkeit.
Thomas von Aquin sagt irgendwo:
«Gesundheit ist kein Zustand,
Gesundheit ist eine Haltung»,
eine dankbare Haltung dem Leben gegenüber:
Das ist Gesundheit.
Wenn wir dankbar sind, werden wir gesund.
Dankbarkeit macht uns gesund.
Wir werden dadurch gesund.
Wir können also jederzeit dankbar sein, denn
jeder Augenblick ist ein gegebener Augenblick
Da stellt sich aber in uns sofort die Frage:
Und die Antwort ist: Nein. Wir können alle vieles aufzählen, wofür man nicht dankbar sein kann: Man kann nicht dankbar sein für Krieg, für Gewalttat, für Ausbeutung, für Armut ‒ schreckliche Armut ‒, Hunger, Not. Unsere Welt ist erfüllt von Dingen, für die man nicht dankbar sein kann.
Aber man kann in jedem Augenblick dankbar sein, auch wenn man in diesem Augenblick mit etwas konfrontiert ist, wofür man nicht dankbar sein kann. Wieso?
Weil das Geschenk innerhalb jedes Geschenkes Gelegenheit ist.
Dieses Wort Gelegenheit ist unerhört wichtig in diesem Zusammenhang. Das ist das wichtigste Wort im Bereich der Dankbarkeit.
Denn wenn wir dankbar sind für etwas, worüber wir uns freuen können, dann sind wir nicht dankbar für die Blume als solche, sondern für die Gelegenheit, uns an der Blume zu freuen, für die Gelegenheit, diesem Menschen zu begegnen. Denn die Blume könnte es ja auch woanders geben: die Gelegenheit, mich daran zu freuen, wäre mir nicht geschenkt. Das Geschenk, wofür ich dankbar sein kann, ist die Gelegenheit, mich daran zu freuen.
Und wenn wir dafür aufwachen, wenn uns das einmal bewusst wird, dann sehen wir erst, dass das größte Prozent, das größte Ausmaß der Zeit, Gelegenheit ist, uns zu freuen.
Und wenn wir das jetzt als spirituelle Übung verwenden wollen, dann müssen wir uns fragen:
Wie kann man sie praktizieren? Wie können wir es methodisch tun? Und wie können wir uns methodisch immer wieder an die Gelegenheit erinnern, die uns da geboten wird, und diese Gelegenheit verwenden im Jetzt?
Denn das ist das Ziel jeder spirituellen Übung.
(28:23) Ich möchte noch schnell zum Abschluss ein paar Punkte erwähnen, die mir besonders wichtig erscheinen in der heutigen Zeit, warum es so wichtig ist, diesen Schlüssel zur Dankbarkeit auch zu verwenden.
Zunächst einmal:
Nicht nur viele von uns persönlich in Schwierigkeiten ‒ die Weltzeit, in der wir leben, ist eine schwierige Zeit.
Wir brauchen Schöpferkraft. Wir brauchen schöpferische Einsicht.
Und was könnte uns schöpferischer machen, als immer wieder auf die Gelegenheit zu achten?
Und Dankbarkeit macht uns achtsam für die Gelegenheit:
Wozu ist das jetzt die Gelegenheit, die Gelegenheit, dankbar zu sein?
Meistens die Gelegenheit, uns zu freuen, das Leben zu feiern!
Stellen Sie sich einmal vor, wie anders das Leben aussehen würde in einer Familie, in einer Gemeinschaft, in einem Staat, in der Welt, wenn die Menschen das Leben feiern würden! Immer wieder Gelegenheiten, das Leben zu feiern! Ganz eine andere Gesellschaft!
Und die Gelegenheit auch zu ergreifen, wenn wir etwas nicht feiern können, das macht uns schöpferisch. Denn diese Schöpferkraft brauchen wir.
Wozu ist das jetzt die Gelegenheit?
Also nicht deprimiert werden, überwältigt werden von dem Schlimmen, das uns da widerfährt, sondern gleich fragen ‒ okay, dafür kann ich nicht dankbar sein, aber diese Situation bietet mir die Gelegenheit, mich dankbar zu erweisen, indem ich auf sie eingehe und etwas aus ihr mache. Das wirkt ungeheuer schöpferisch. Das wäre der erste Punkt.
(30:12) Der zweite Punkt ist, dass es wissenschaftlich erwiesen wurde, dass Dankbarkeit gesünder macht. Robert A. Emmons an der Universität von California (Davis), hat mehrere Bücher veröffentlicht und eines heißt: «The psychology of Graditude», Oxford University Press (2004). [Siehe auch: Das kleine Buch der Dankbarkeit (2016)]
Und darin beschreibt er Experimente, viele Experimente, die mit den Studenten gemacht wurden, sehr wissenschaftlich mit Vergleichsgruppen usw., blinde Versuche, alles, was dazugehört. Und die dankbaren Studenten, die zum Beispiel jeden Abend irgendein Ding aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind, so ein kleines Tagebuch geführt haben, die haben plötzlich bessere Noten bekommen, die waren gesünder, sportlich waren sie besser.
Weil wir eben mit dem gegebenen Leben in Einklang sind, muss das ja dazu führen, dass wir auch gesünder leben, denn Gesundheit hängt damit zusammen, dass wir mit dem Leben im Einklang sind.
Leben ist ein Gegebenes. Die realistische Haltung zur Welt und zur Umwelt macht uns gesund.
(31:24) Ein dritter Punkt, der in unserer Konsumgesellschaft ungeheuer wichtig ist, ist, dass Dankbarkeit uns genügsamer macht.
Erinnern Sie sich an das Erlebnis des Dankbarseins. Und da kann man darauf reflektieren und sehen, dass da eigentlich zwei Phasen sind:
In dem Erleben des Dankbarseins ist eine erste Phase, in der es sich irgendwie so anfühlt, als ob unser Herz voller und voller wäre von Wertschätzung. Und dann fließt es über in Danksagung.
Das sind zwei verschiedene Phasen. Und erst, wenn es in Danksagung überfließt oder in Dank-tun, in der Verwirklichung des Dankes, erst dann kommt die Freude wirklich so zum vollen Ausdruck.
Es ist wie ein Brunnen, wo die Schale sich langsam anfüllt und dann, wenn sie überfließt, dann bricht sich das Licht und glitzert und dann wird es freudig. Das sind diese beiden Phasen.
Und in unserer Gesellschaft, gerade in dem Augenblick, wo wir überfließen wollen von Freude und Wertschätzung, kommt die Reklame herein und sagt uns, nein, nein, da gibt es noch ein viel besseres Modell, ein neueres Modell, ein größeres, der Nachbar hat ein viel Größeres usw.. Also machen wir jetzt diese Schale größer und sie fließt noch nicht über. Und gerade, wenn sie wieder überfließen will, wird uns wieder gesagt, dass sie eigentlich nicht überfließen sollte.
Und wir kommen in dieser Konsumgesellschaft nie zum Überfließen und daher sind wir nicht freudig! Wir haben keine Freude! Und dann kommen wir auf Reisen in Länder, wo wir sehen, die Menschen sind furchtbar arm. Und wieso sind die so freudig? Ja ihr Gefäß ist so klein, dass es viel früher überfließt! Es fließt sofort über! Das können wir an uns selber ausprobieren:
Verkleinere dein Gefäß, 72f.
Wir machen an einem Tag unser Gefäß etwas kleiner: Wir fasten zum Beispiel. Plötzlich schmeckt das Brot so gut. Vorher haben wir das Brot gar nicht bemerkt, wir waren nur an dem interessiert, was drauf liegt, an der Auflage. Plötzlich sind keine Auflagen da, da wird das Brot wunderbar, weil das Gefäß kleiner wird.
Und so können wir das üben. Und wenn Sie es sich eine wirklich dankbare Gesellschaft vorstellen, das wäre keine solche Konsumgesellschaft, sondern eine genügsame, freudig genügsame Gesellschaft.
(33:56) Noch ein Punkt:
Durch die Dankbarkeit lernen wir im Jetzt zu leben.
Und jedes Mal, wo wir dankbar sind, verschieben wir unser Gewicht vom Ich auf das Selbst.
Ich habe da immer das Bild von den klassischen Statuen im Sinn, zum Beispiel den David von Michelangelo: Er steht auf einem Standbein und das andere ist sein Spielbein, wie es in der Kunstgeschichte heißt. Weil er fest auf dem einen Bein steht, kann er mit dem anderen spielen. Das Bein, auf dem wir gewöhnlich feststehen, ist unser kleines Ego. Und hie und da gehen wir so auf eine Einkehrwoche oder so etwas, oder zu einem Vortrag, und dann spielen wir ein bisschen mit dem Selbst. Und dann vergessen wir es und stehen wieder fest auf dem Ego.[8]
Diese Gewichtverschiebung ist entscheidend.
Jedes Mal, wenn wir dankbar sind, auch nur einen kleinen Augenblick lang, verschiebt sich das Gewicht und unser Standbein wird jetzt das Selbst. Und dann können wir ganz leicht mit dem Ego spielen ‒ nicht mehr so verfangen drinnen, wir spielen damit.
Das zu lernen, diese Gewichtsverschiebung zu lernen, das ist etwas ungeheuer Wichtiges. Es kommt beides zusammen:
Wenn wir wirklich unser Leben zum Ausdruck unseres Selbst, unseres wahren Selbst machen, dann dienen wir zugleich auch der Welt. Und dazu Mut zu haben, das ist das innerste Geheimnis von Demut, die ja ursprünglich Dienmut heißt, diesen Mut zum Dienen, unserem Selbst zu dienen, dadurch dass wir es durchscheinen lassen und der Welt dadurch dienen in einer einzigartigen Weise.
(35:52) Und wenn wir im Selbst sind und im Jetzt sind, dann sind wir über den Tod erhaben. Dann brauchen wir keine Furcht mehr vor dem Tod haben.
Denn der Tod kommt, wenn meine Zeit um ist, aber das heißt gar nicht, dass mein Selbst davon betroffen wird.
Das Jetzt ist nicht in der Zeit.
Die Zeit ist im Jetzt!
Das wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich sage, das Jetzt ist nicht in der Zeit. Aber unsere westliche Philosophie hat das schon sehr lange gewusst:
Wir stellen uns das meistens so vor, dass die Zeit eine lange, lange Linie ist: Auf der einen Seite ist die Vergangenheit, auf der anderen Seite ist die Zukunft. Wo ist jetzt das Jetzt? Es ist der kleine Abschnitt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wenn es ein kleiner Abschnitt ist, lade ich Sie dazu ein, diesen kleinen Abschnitt in die Hälfte zu schneiden und die eine Hälfte ist nicht, weil sie nicht mehr ist, und die andere Hälfte ist nicht, weil sie noch nicht ist: Wo ist das Jetzt? Das ist Haarspalten. Gut ‒, solang es ein Haar ist, können wir es spalten.
Wir können es spalten, bis wir finden, dass das Jetzt, das wir erleben, zu unserem Leben gehört, nicht in der Zeit ist: In der Zeit frisst die Vergangenheit nahtlos die Zukunft auf.
«Wir reichen heraus aus der Zeit ins Sein, ins Ewige.
Ewig heißt ja nicht: lange, lange Zeit;
Ewigkeit ist das ‹nunc stans›,
das Jetzt, das niemals vergeht.
‹Ich bin› gehört also zur Ewigkeit,
zum ‹Jetzt, das bleibt›.
Dieses bleibende Jetzt kennt schon jedes Kind,
wenn es nur versteht, was ‹ich bin› heißt.
Jeder Mensch reicht eben existenziell über die Zeit
in die Ewigkeit hinein,
in das Sein.
Ich muss mit dieser Spannung leben,
dass ich der bin,
der dieses ‹bin› nie in der Zeit findet
und es doch in der Zeit verwirklichen muss.»
Jetzt im Doppelbereich[9]
(37:18) Noch ganz kurz:
Eine letzte und vielleicht für mich die wichtigste und schönste und tiefgehendste Frucht von Dankbarkeit ist, dass sie uns unser Gottesverständnis neu erfahren lässt, dass sie uns ein neues Gottesverständnis gibt.
Ein Gottesverständnis, das allen Menschen zugänglich ist, nicht nur denen, die es schon gewohnt sind, von Gott zu sprechen, den «religiösen» Menschen, sondern allen Menschen. Die letzte Wirklichkeit und die große Schwierigkeit, die wir heutzutage haben mit diesem Begriff von Gott, ist, dass wir uns immer getrennt fühlen.
Die Bildersprache, in der den meisten von uns durch die verschiedenen Religionen die Gottwirklichkeit nahegebracht wird, ist immer: Wir sind irgendwie getrennt ‒, Gott ist der ganz andere. Und wir sind auf dieser Seite. Und da ist diese große Kluft.
Und heutzutage fällt dies zunehmend mehr Menschen schwieriger und schwieriger.
Wenn wir uns auf das dankbare Leben einlassen,
dann haben wir uns auf die göttliche Wirklichkeit eingelassen.
Denn die letzte Wirklichkeit ist die Quelle aller Gaben:
Dieser Satz ist unwiderlegbar. Es ist einer der wenigen Sätze, ich kenne kaum einen anderen, in dem alle Menschen übereinstimmen.
Jeder von uns muss sagen: Es gibt mich. Darin können wir alle übereinstimmen. ES ‒ Was ist dieses ES? ‒ Das große Geheimnis, aus dem alles hervorfließt.
Nicht in dem engen Sinn von Schöpfung mit einem Schöpfer irgendwo anders, der … ‒ das war eine Bildersprache.
Wem das hilft: fein. Wem das nicht hilft: Bilder sind Bilder!
Dieses ES, das ist das Geheimnis, mit dem wir alle als Menschen konfrontiert sind. Das ist die göttliche Quelle.
Und ES gibt m i c h. Mein innerstes Selbst ist das eine Selbst, das göttliche Selbst, das mich mit allen Menschen, mit allem, was ES
g i b t und mit der göttlichen Wirklichkeit verbindet, vereint:
ES g i b t: Was kann ES geben?
Diese göttliche Wirklichkeit kann nur s i c h s e l b s t geben.
Und alles, was gegeben ist, ist Ausdruck dieser göttlichen Wirklichkeit.
Und das ist Glaube: sich darauf einzulassen.«Unter Glauben können wir verstehen das uns Verlassen
auf die Verlässlichkeit des Urgrundes,
wir können es verstehen als die ehrfürchtige Begegnung
mit allem, was ES gibt,
und als dynamische Dankbarkeit.
Und Dankbarkeit nicht als Danke sagen,
sondern als Danke leben, als Dank werden.»
Credo ‒ Vortrag ‒ Freiburg (20. Oktober 2010)
Und wenn wir uns darauf einlassen, verwirklichen wir die tiefste Möglichkeit des dankbaren Lebens und sind völlig eingebettet in die göttliche Wirklichkeit als die Quelle, das ES, das alles gibt, als die Fülle von allem, die aus dem Nichts hervorkommt ‒, und die Liebe, durch die alles wieder zurückkehrt zu dem Ursprung.
Wir sind ein großer Reigentanz, in dem wir da eingebettet sind.
Und das ist die tiefste und schönste Wurzel unseres gesunden Lebens.
Denn Leben kann erst wirklich gesund genannt werden, wenn es diese Intensität der Lebendigkeit erlangt hat.
Danke!
____________________
[1] Siehe die Schlüsselworte «Umwelt» und «Mitwelt» im Buch Orientierung finden (2021), 159f. und 150, ebenso in Anm. 3f. in Es gibt mich
[2] Siehe auch die deutsche Erstveröffentlichung des Beitrags von Abraham H. Maslow in Jeder Mensch ist ein Mystiker (2014)
[3] Siehe auch Credo: Ein Glaube, der alle verbindet (2015): «Ich glaube an Gott»: «Persönliche Erwägungen», 31-36, ebenso in Sehnsucht:
«Darauf kommt es also an: Ob wir jene allumfassende Zugehörigkeit kennen, die den Gegenpol darstellt zu Verlassenheit und Verzweiflung.
Wir dürfen sicher sein, dass wir schon irgendwann einmal dieses All-eins-sein gefühlt haben ‒ in einem Gipfelerlebnis, würde Maslow sagen.
Wir dürfen uns nur nicht irreführen lassen durch diesen Ausdruck und gleich ans Matterhorn denken oder an einen Gipfel im Himalaya. Vielleicht war unser persönlicher Gipfel im Vergleich dazu ein Ameisenhaufen; das spielt keine Rolle.
Es genügt jedenfalls, dass wir uns schon einmal so recht daheim gefühlt haben im All, wenn auch nur einen Augenblick lang. Wir hörten etwa eine Melodie (Händels Alleluja ist für mich so eine) und waren plötzlich so ganz da; alles war recht so, wie es war, und wir waren Teil des Ganzen, waren irgendwie das Ganze. Einmal wenigstens, das genügt ‒ oder es sollte genügen. Wir dürfen das Geschenk eines solchen Augenblickes nur nicht vergessen.
Sooft wir uns dankbar daran erinnern, wissen wir, dass wir ‹dazugehören› und sind vor der Verzweiflung gerettet.
Das ist aber eine Haltung, die wir täglich neu erringen; täglich auf neue Art beweisen müssen. Das Leben verändert uns ja ständig, ob wir es wollen oder nicht. Es fordert uns heraus, sicher zu sein, dass der Anker hält, auch in Stürmen.»
[4] Siehe auch Audio Fragen, denen wir uns stellen müssen (2016)
Tag 2
Nachmittag: Im Jetzt sein und im Selbst sein ist identisch (Bruder David)
(29:08) Was verbindet das Ich mit dem Selbst? Warum das Ich? Das eine unteilbare Selbst in den Weltreligionen und das richtige Verständnis des Liebesgebotes / (34:10) Jedes Ich ist ein einmaliger Ausdruck des Selbst ‒ der Begriff ‹Seele› in diesem Zusammenhang ‒ das Selbst umfasst alles Lebendige und sehr wahrscheinlich auch die unbelebte Natur / (38:11) Das Selbst spielt in jedem Ich eine einzigartige Rolle ‒ der Vergleich mit dem Kasperltheater ‒ Unsere Rollen sind uns weit mehr aufgegeben als wir meinen ‒ Mir ist eine Rolle aufgegeben: Wie kann ich sie gut spielen? ‒ Freiheit ist ein Wesenszug von allem, was es gibt / (42:00) Wir sind zu einem gewissen Grad frei, uns dem Leben hinzugeben oder uns gegen das Leben zu sträuben: Immer wieder ins Jetzt kommen und das Leben durch uns fließen lassen. Im Jetzt sein heißt, sich der Frage, der Aufgabe stellen, die das Leben uns jetzt stellt: ‹Es gibt nichts Gutes, außer man tut es› / (45:19) ‹To live in tune with the world› ‒ ‹Alles ist Schwingung, alles ist Klang›: Im Einklang mit dem Leben tanzen ‒ Tanzend arbeiten
[5] Siehe den Titel des Audios in Anm. 4: ‹Im Jetzt sein und im Selbst sein ist identisch›
[6] Siehe auch Bedeutung und Glück der Dankbarkeit: Blog-Beitrag von Alexandra Hildebrandt (25. Juli 2023) ‒ Warum Dankbarkeit glücklicher macht: Blog-Beitrag von Valeria Gadde (18. Juli 2023) ‒ Dankbarkeit aufschreiben ‒ deine «Drei guten Dinge» des Tages: Blog-Beitrag vom 09. Mai 2023 ‒ Durch Dankbarkeit die eigene Resilienz steigern und Stress senken: Blog-Beitrag vom 03. April 2023 ‒ Dankbar zu sein hält uns geistig fit: Blog-Beitrag von Mag. Roswitha Jauk (13. Februar 2021)
[7] Vier Übungen zur Vertiefung der Dankbarkeit: Blog-Beitrag von Juliana Breines (28. Dezember 2019)
[8] Siehe auch Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014): 109f.
[9] Der Text ist dem Vortrag ‹Im Paradoxen Sinn finden› entnommen, abgedruckt im Buch Aufwachsen in Widersprüchen (1990), 62. Der ganze Vortrag ist zu hören im Audio unter dem Titel ‹Im Paradoxen Sinn finden: Teil 1› in der Reihe Aufwachsen in Widersprüchen (1989)
Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 1-2, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
Tag 1: Dienstag, 10. Februar
Wo stehe ich?
Ich-Du-Achse und Ich-Es-Achse
Wohin gehe ich?
Ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen:
zu Buddha: wacher Geist,
zum Dharma: das Leben, unser Lehrmeister,
zur Sangha: Verbundenheit
Tag 2: Mittwoch, 11. Februar
Unsere Beziehung zum Geheimnis
Unterschied von Begreifen und Verstehen
Leiden und das Leidige
Angst ‒ Furcht und Vertrauen
Gott in den religiösen Traditionen
Fürchte dich nicht!
Die drei Geistesgifte
Die sechs Ratschläge des Tilopa
Drei Daseinsmerkmale
Postscriptum:
unsere Licht- und Schattenseiten
Tag 1: Dienstagvormittag: 1. Impulsvortrag (Bruder David):
Der Philosoph Martin Heidegger (1889-1976) sagt: Philosophie ist ein der Sprache nachdenken. In der Sprache, in ihren Worten und Begriffen ist sehr viel Weisheit.
Das Wort Orientierung kommt von ‹oriens›, was Aufgang bedeutet. Man orientierte sich am Sonnenaufgang, dann wusste man um die Himmelsrichtungen. Und in einer tieferen Schicht der Orientierung kann man sagen, es geht uns ein Licht auf. Wir benutzen zur Orientierung Karten, Landkarten, den Globus. Um zu wissen, welches Hilfsmittel nützlich ist, müssen wir uns entscheiden, worum es uns geht. Dann muss die Karte mit unserer Erfahrung zusammengebracht werden. Im letzten geht es um die eigene Erfahrung.
Ausgangspunkt für jede Orientierung ist mein Standpunkt, wo ich mich befinde. Dort beginnen wir immer. ‹Ich bin da› ist unser Ausgangspunkt. Wir beginnen mit dem Ich.
Wir können das auf zwei Weisen ausdrücken:
‹Ich bin da›, oder ‹Es gibt mich›.
Es macht einen Unterschied aus, wie wir beginnen. ‹Ich bin da› beinhaltet die Gefahr, dass ich mich zum Mittelpunkt mache. In gewissem Sinne bin ich immer Mittelpunkt. Die Gefahr ist, darin stecken zu bleiben, dann wird das Ich zum Ego.
Wenn ich ‹ES gibt mich› sage, gehe ich über mich hinaus und trete ein in ein Beziehungsfeld. Ich finde mich als gegeben vor, bin Gegebenheit, bin ein Geschenk.
Im Augenblick, wo ich ‹Ich› sage,
setze ich ein Du voraus.
Denn Ich zu sagen hat keinen Sinn,
wenn es nicht auf ein Du bezogen ist:
«Ich bin durch Dich so ich.»
«I am through you so I» ist die Schlusszeile im Gedicht des amerikanischen Dichters E. E. Cummings: ‹I am so glad and very›.
Die erste Orientierungsachse ist die Ich-Du-Achse.
Die ersten Du-Beziehungen sind zur Mutter, zu den Geschwistern, zum Vater, Verwandten, Bekannten, zur Katze, zum Hund oder zum Teddybär.
In der Ich-Du-Achse ist das Du die Verallgemeinerung aller Du-Beziehungen.
Später kommen wir zur Einsicht,
dass das letzte Du dem innersten Ich entspricht.
Das letzte Du ist im Unbegreiflichen, im Geheimnis zuhause.
Wir können das besser verstehen, indem wir uns klarmachen, dass wir das Leben als Lebensgeschichte erfahren. Wir wollen unsere Lebensgeschichte jemandem erzählen. Aber das gelingt uns nie ganz, sondern nur teilweise. Doch unser innerstes Ich erzählt sie dem Ur-Du in uns, das im Geheimnis verborgen ist.
Letztlich gehören wir einem Bereich an, der über alles Begreifen hinaus geht. Dichterische Sprache reicht am ehesten an diesen Bereich heran.
Rilke spricht vom Ur-Du in seinem Gedicht: ‹Du wirst nur mit der Tat erfasst› (Das Stunden-Buch):
«Ich geh doch immer auf Dich zu,
mit meinem ganzen Gehn;
denn wer bin ich und wer bist Du,
wenn wir uns nicht verstehn.»
Die Orientierungsachse der Ich-Du-Beziehung spielt sich im Doppelbereich ab von Innerlichkeit und Außenwelt, materiell ‒ immateriell, Ich und Selbst, Zeit und Ewigkeit, begreifen und ergriffen sein: Wir werden am Donnerstagvormittag (Tag 3) auf den Schlüsselbegriff Doppelbereich näher eingehen.
Dann gibt es noch die Beziehungen zu Dingen, die Ich-Es-Beziehungen. Ich spreche z.B. in unpersönlicher Weise vom Buch: es liegt auf dem Tisch. Sage ich jedoch:
‹ES gibt›,
komme ich wieder in den Bereich des Geheimnisses.
Die Dinge werden zu Brüdern, wie Rilke sagt im Stundenbuch:
«Ich finde Dich in allen diesen Dingen,
denen ich gut und wie ein Bruder bin.»
Hier fließen beide Bereiche zusammen, das letzte Du und das ES gehören beide dem Geheimnis an.
Ich stehe am Schnittpunkt dieser beiden Achsen,
der vertikalen Ich-Du-Achse und
der horizontalen Ich-Es-Achse.
Das kann mir zur Orientierung im Beziehungsgewebe helfen.
Vanja sagt dazu aus buddhistischer Sicht: Das Ich ist ein Knotenpunkt im Beziehungsnetz. Wir sind ohne wirkliche Grundlage. Wir finden uns in einer Welt ohne Substanz. Die Buddhisten sprechen von Nicht-Wesenhaftigkeit, ‹anatman›. Das ist eine schwierige Situation für die Orientierung. Wir können nicht begreifen, aber wir können uns hineinbegeben ins Geheimnis.
Bruder David: Ein gutes Beispiel ist die Musik. Wir können uns von ihr ergreifen lassen.
Tanz ‹Om Mani Peme Hung› (Tibet) ‒ ‹Mantra des Mitgefühls›:
Eine Anrufung der göttlichen Liebe, die unendliches Mitgefühl ist. Frei übersetzt: ‹Mögen alle Wesen frei sein von Leid Mögen alle Wesen glücklich sein›!
Dienstagnachmittag: 2. Impulsvortrag (Vanja):
Als Orientierung können dienen: Texte, Stille und die Gemeinschaft, die Weisheit, die wir als Gruppe haben. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Buddhistisch ausgedrückt sind es die drei Juwelen, zu denen ich Zuflucht nehmen kann:
1. Ich nehme Zuflucht zu Buddha.
‹Bud› bedeutet wach. Buddha kann übersetzt werden: ‹wacher Geist›, unsere besten Momente. Auch psychedelische Substanzen können bei gutem Setting zu Einsichten verhelfen, zum Aufwachen helfen.
2. Ich nehme Zuflucht zum Dharma, der Lehre.
Damit ist eigentlich unser Leben mit seinen Erfahrungen gemeint. Das Leben selbst lehrt uns. Unsere Erlebnisse sind unsere Lehre.
3. Ich nehme Zuflucht zur Sangha:
zur Verbundenheit mit allen Lebewesen auf dieser Welt, zur Gemeinschaft zuerst mit unserem Partner, mit den Menschen am Arbeitsplatz.
Diese drei Juwelen sind drei Pfeiler der Orientierung.
Bruder David dazu: Diese drei Juwelen kommen zwar aus dem Buddhismus, berühren aber allgemein menschlichen Wurzelgrund. Man könnte es so zusammenfassen:
Wir wachen auf und leben wach das Leben
und merken, dass es letztlich um Beziehungen geht,
dass das Leben ein Netz von Beziehungen ist.Frage: Wozu wache ich auf?
Vanja: Zu mystischen Einheitsmomenten. In meinen Kontakten, in Gesprächen, im Austausch kann ich dann wirken wie ein Prophet.
Bruder David: Ein Prophet ist ein Mahner. Durch außergewöhnliche Erlebnisse leben Propheten die Einsicht, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt und diese entscheidend ist. Sie mahnen den Rest der Welt: ‹Ihr seid auf dem Holzweg›! Sie sagen auch, dass wir alle gleichwertig sind und setzen sich deshalb ein für die Entrechteten. (Die außergewöhnlichen Erlebnisse der Propheten ähneln den Beschreibungen von Reisen mit Substanzen.)
Im Patanjali, dem Buch der Weisheit wird gesagt, dass man die Siddhis, die außergewöhnlichen Kräfte eines Yogi, auf verschiedene Weisen erreichen könne: spontan, durch Medizinpflanzen, Meditation, Tapas und Mantren.
Tag 2: Mittwochvormittag: 3. Impulsvortrag (Bruder David):
Bruder David fasst zuerst noch einmal das Wichtigste vom Vortag zusammen: Zur Orientierung gehören die Frage nach dem Standpunkt und wohin es geht.
1. Der Standpunkt: Wo stehe ich?
Ich stehe in einer persönlichen Beziehung zum Du, stehe in der Ich-Du-Achse, durch die ich in den Doppelbereich eintrete: Ich kann mich selber nicht völlig begreifen. Das geht über Zeit und Raum hinaus ins Geheimnis.
Das Geheimnis ist der Bereich,
mit dem wir uns auseinandersetzen müssen,
den wir nicht begreifen können,
von dem wir uns aber ergreifen lassen müssen, wie z.B. von der Musik.
Sich ergreifen lassen führt zum Verstehen.
Die Silbe ‹ver› im Wort ‹verstehen› ist eine Intensivierungssilbe; verstehen heißt also ‹völlig drin stehen›, englisch: ‹to understand›: ‹drunterstehen›.
[Bruder David ergänzend in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 61f.; siehe auch in Verstehen:
Einer meiner Zen Lehrer hat immer gesagt: ‹O ihr im Westen, ihr sagt immer, ihr wollt verstehen im Sinne von u n t e r stehen, aber was ihr eigentlich wollt ist ü b e r stehen, aus der Hubschrauberperspektive betrachten.› Er sagt: ‹Ihr seid wie Leute, die unter der Dusche stehen und einen Regenschirm aufspannen.›
Oder so wie das Kind sagt: ‹Wie ist es eigentlich, wenn man stirbt? Ich möcht’s nicht tun, aber ich möcht‘s wissen.›
Wenn ihr Schwimmen lernt: Ihr könnt jedes Buch lesen oder euch jede Vorlesung über Schwimmen aneignen, habt aber dennoch keine Ahnung vom Schwimmen, bevor ihr ins Wasser geht. Man muss hineingehen: ‹Du wirst nur mit der Tat erfasst› (Rilke, Das Stunden-Buch).
Das Geheimnis ist uns unzugänglich, außer wenn wir auf die Frage: Wie? durch Tun antworten:
‹Tu es einfach, dann wirst Du schon verstehen.›]
Die zweite, zuerst unpersönliche Ebene, ist die Ich-Es-Achse. Aber mit ‹ES gibt› sind wir im Geheimnis des ES, an dem Punkt des Ursprungs, wo alles aus dem Nichts herausspringt.
Im Geheimnis treffen sich Du und Es. Dinge werden wie Brüder.
2. Der zweite Punkt der Orientierung, den Vanja angesprochen hatte, ist die Frage: Wohin geht es? Wie gehe ich weiter?
Der Buddhismus gibt die Antwort: Buddha ‒ Dharma ‒ Sangha: Aufwachen zum Leben in Beziehung. Wir stellen uns in Beziehungen. Dazu Ja zu sagen ist Liebe.
Liebe ist das gelebte Ja zur Zugehörigkeit,
das Ja zum Leben, und Leben ist Beziehung.
Thema dieses zweiten Vormittags ist unsere Beziehung zum Geheimnis. Statt Geheimnis können wir auch das Leben sagen.
Im Leben treffen wir auf das Leid, das ein Teil des Lebens ist.
Buddha sagt:
«So wie das Meer nur einen Geschmack hat nach Salz,
so schmeckt meine ganze Lehre nach Überwindung von Leid.»
Im Althochdeutschen bedeutet das Verb ‹leiden› soviel wie ‹gehen, fahren, reisen› und ist nicht verwandt mit dem Substantiv ‹Leid› in der Bedeutung von ‹leidig, widerwärtig›.
Leiden und Leid sind nicht dasselbe.
Leiden ist unvermeidlich,
wie der Tod und unsere Vergänglichkeit
unvermeidlich sind.
Leid dagegen muss überwunden werden.
Das Leidige im Leiden besteht darin,
dass wir uns gegen das Leiden sträuben.
Erst im Verlauf der Christianisierung mit der Vorstellung vom Leben des Menschen als einer Reise durch das irdische Jammertal vermischten sich die beiden Worte. Dennoch gilt es zu unterscheiden:
Wir können dem Leiden auf zwei Weisen begegnen:
m i t der Faserung, das ist die Bewegung des Lebens:
Wir gehen mit dem Leben, und schauen, wo es hinführt,
oder g e g e n die Faserung, was zum Leid führt.
Ähnlich verhält es sich mit den Begriffen Angst und Furcht.
Furcht sträubt sich gegen die Angst,
die zum Leben gehört:
Angst ist unvermeidlich.
Angst im Sinn von ‹Enge›, Beklemmung› gehört zur indogermanischen Wortgruppe ‹eng›: ‹einengen, zusammendrücken oder -schnüren›. Urverwandt dazu sind zahlreiche Wörter wie im Lateinischen ‹angustiae›: ‹Enge, Engpass, Klemme, missliche Lage.›
[Bruder David ergänzend in Wir sind schon über die Schwelle getreten (2021):
Angst hat jeder Mensch. Seit der Geburt begleitet sie uns. Immer wieder gelangen wir in unserem Leben wie vor der Geburt in eine Enge, aber wie bei der Geburt kennt die Angst auch das Lebensvertrauen.
Dieses Vertrauen sagt: Es gibt immer einen Weg hindurch, auch wenn es ganz schwierig sein wird. Und wenn wir in solchen Momenten auf das Leben zurückschauen und uns an frühere Situationen der Angst erinnern, dann spüren wir, dass die schwierigsten Situationen oft zu den schönsten wurden, weil es so etwas wie eine Neugeburt gab.]
Schön beschrieben ist dieses Vertrauen ins Geheimnis angesichts aller Schwierigkeiten im Gedicht von Joseph von Eichendorff: ‹Der Umkehrende, 4›; siehe auch Das Leid des Lebens zu Herzen nehmen, 24-27:
«Es wandelt, was wir schauen,
Tag sinkt ins Abendrot,
die Lust hat eignes Grauen,
und alles hat den Tod.Ins Leben schleicht das Leiden
sich heimlich wie ein Dieb.
Wir alle müssen scheiden,
von allem, was uns lieb.Was gäb’ es doch auf Erden,
wer hielt den Jammer aus,
wer möcht geboren werden,
hieltst Du nicht oben Haus.Du bist’s, der, was wir bauen,
mild über uns zerbricht,
dass wir den Himmel schauen ‒
darum so klag ich nicht.»
Wir alle sind ins Geheimnis des Lebens hineingestellt, in das Unbegreifliche, von dem wir uns ergreifen lassen müssen, um es zu verstehen.
Bei Eichendorff heißt das Geheimnis Gott.
Das Wort ‹Gott› entstand früh in der Geschichte unsere Sprache und geht auf die indogermanische Wurzel ‹gheu› mit der Grundbedeutung ‹rufen› zurück.
Gott bedeutet wörtlich ‹Das Angerufene
vielleicht auch ‹Das uns Anrufende›.
Jedenfalls schwingt bei dem Wort ‹Gott› von Anfang an die Gegenseitigkeit einer Ich - Du-Beziehung mit.
In den Amen-Traditionen (Christentum, Judentum und Islam: sie haben das Wort Amen gemeinsam) ist die Ich-Du-Beziehung stark im Vordergrund. Amen heißt: Ja, ich vertraue, ich verlasse mich darauf. Im Judentum ist die Verlässlichkeit Gottes das Innerste.
‹Das Angerufene› oder ‹Das Anrufende› bezieht sich auf das WORT. Alles, was es gibt, will mir etwas sagen, ist Wort und erwartet meine Antwort.
Für den Buddhismus ist das, was für die Amen-Traditionen das WORT ist, das SCHWEIGEN.
Den Buddhisten geht es darum, sich ins SCHWEIGEN, ins Nichtwissen hinunterzulassen.
Wir finden das aber auch bei den christlichen Mystikern. Gerhard Tersteegen in der 5. Strophe im geistlichen Lied: ‹Gott ist gegenwärtig› (1729):
«Oh Wunder über Wunder,
ich lasse mich in Dich hinunter.»
Swami Venkatesananda gibt uns einen Schlüssel zum Verständnis des Hinduismus, wenn er sagt: «Yoga ist Verstehen». Das deutsche Wort ‹Joch› kommt von derselben Wurzel wie Yoga.
WORT und SCHWEIGEN sind da zusammen gejocht im VERSTEHEN.
Kommt Verstehen nicht immer dann zustande,
wenn wir auf ein Wort so tief hinhören
und ihm so innig gehorchen,
dass es uns zurückführt
in das Schweigen,
aus dem es kommt?
Dieses Horchen und Gehorchen ist auch der springende Punkt in der Bhagavadgita: Arjunas verzweifelte Frage kann keine andere Antwort finden als im Tun.
In der Bhagavad-Gita wird Prinz Arjuna mit einem Rätsel konfrontiert, das er wahrscheinlich gar nicht lösen kann. Der Glaube hat ihn in eine Situation gebracht, in der es seine Pflicht ist, eine gerechte, aber grausame Schlacht gegen seine eigenen Verwandten und Freunde zu führen. Wie kann ein friedliebender Prinz dieses Dilemma sinnvoll lösen? Sein Wagenlenker, der als Krishna verkleidete Gott Vishnu, kann ihm nur den Rat geben: «Tu deine Pflicht, und im Tun wirst du verstehen.» [Auf dem Weg der Stille (2016), 37-39; siehe auch Religionen ‒ drei Innenwelten]
Nur im Tun, im Erleben verstehen wir wirklich.
Das ist ein Prozess. Und das VERSTEHEN führt uns wieder zurück ins SCHWEIGEN: SCHWEIGEN ‒ WORT ‒ VERSTEHEN.
Aus dem SCHWEIGEN kommt das WORT
und führt zum VERSTEHEN und zurück zum SCHWEIGEN.
Die kappadokischen Kirchenväter in der zweiten Hälfte des 4. Jh. haben es den Reigentanz der Dreieinigkeit genannt.
Der Mystiker Thomas Merton (1915-1968) sagt:
«God isn’t somebody else»:
«Gott ist nicht jemand anders.»
und
«Wir stecken gemeinsam drin.»Frage: Wo ist dann der biblische Gott?
Da müssen wir zurückfragen: Welcher Gott der Bibel? Der Gott welches Buches der Bibel? Seit dem 16. Jahrhundert spricht man erst von der Bibel. Früher sprach man von biblia, den Büchern.
Die Bücher sind Niederschlag des Ringens mit dem Geheimnis. In den verschiedenen Büchern der Bibel finden sich ganz verschiedene Vorstellungen von Gott.
Wesentlich bei allen Verschiedenheiten ist der Glaube, das Vertrauen, das sich Verlassen auf das Leben.
Das Gegenteil von diesem Glauben ist die Furcht.
Hier kommen wir zurück zu unserem Gegensatzpaar Angst und Furcht.
Während die Angst das Mitgehen mit dem Leben durch die Enge ist, sträuben wir uns in der Furcht dagegen. So ist das häufigste Wort in der Bibel die Aufforderung:
Fürchte dich nicht!
Es ist die Aufforderung,
mit dem Strom des Lebens mitzugehen.Rilke im Stundenbuch:
«Gott spricht zu jedem nur, eh er ihn macht,
dann geht er schweigend mit ihm aus der Nacht.
Aber die Worte, eh jeder beginnt,
diese wolkigen Worte sind:Von deinen Sinnen hinausgesandt,
geh bis an deiner Sehnsucht Rand;
gieb mir Gewand.Hinter den Dingen wachse als Brand,
dass ihre Schatten ausgespannt
immer mich ganz bedecken.Lass dir alles geschehn: Schönheit und Schrecken.
Man muss nur gehn: Kein Gefühl ist das fernste.
Lass dich von mir nicht trennen.
Nah ist das Land,
das sie das Leben nennen.Du wirst es erkennen
an seinem Ernste.Gieb mir die Hand.»
Tanz: Om namo Amitabaya Buddhaja Dharmaja Sanghaja
Amitabaya wird als der geistige Vater Avalokiteshvaras angesehen. Als der große Buddha des Mitgefühls wird er besonders in Südostasien verehrt. Man betet zu ihm in ganz schwierigen Zeiten, wenn man dringend Hilfe benötigt und sich nach Licht am Ende des langen Tunnels sehnt. Er erfüllt im Buddhismus eine ähnliche Funktion wie in der christlichen Tradition Maria.
Frei übersetzt:
‹Ich vertraue auf das Göttliche im Menschen,
auf die Eingebungen des Geistes und
auf die Gemeinschaft der Liebe› oder
‹Ich nehme Zuflucht zum Erwachen
zum Leben in der Gemeinschaft.›
Mittwochnachmittag: 4. Impulsvortrag (Vanja):
‹Ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen›:
Zuflucht nehmen ist auch ein Name für Orientierung.
Der Buddhismus kennt die drei Geistesgifte, die das Rad des Lebens in Gang halten und den Geist trüben:
1. Anhaftende Geisteshaltung: Habgier, Sucht
2. Ablehnende Geisteshaltung: Hass, Zorn, Aggression, Selbstbehauptung
3. Gleichgültige Geisteshaltung: Verblendung, Verwirrung, Unwissenheit
Sie können zu Großzügigkeit, zu Mitgefühl und Weisheit und Klarheit führen.
Wir leben in einer gegebenen Welt. Wir haben nichts als diesen Augenblick und in diesem Augenblick nur unser Bewusstsein. In diesem Augenblick ist alles gegeben: Ort, Stimmung, Gedanken. Wir haben wenig Kontrolle über die Gegebenheiten.
Wo ist der freie Wille?
[Bruder David wird am Freitagmorgen (Tag 4) auf das Thema Willensfreiheit eingehen]
Wir können auf die Gegebenheiten mit Dankbarkeit antworten. Aber manchmal empfinde ich den Augenblick auch als Gefängnis. Das Bewusstsein ist gefangen in Situationen. In diesen Situationen können die sechs Ratschläge des Tilopa (988-1069), des geistigen Urgroßvaters von Milarepa (1040-1123) hilfreich sein.
Tilopa sagt:
1. Erinnere dich nicht: Lass los, was vergangen ist.
2. Stell dir nichts vor: Lass los, was kommen wird.
3. Denke nicht: Lass los, was jetzt ist.
4. Prüfe nicht: Versuche nicht, etwas zu begreifen.
5. Sei nicht in Kontrolle: Gib dich dem Fluss hin.
6. Ruhe dich aus, entspanne dich jetzt und hier.
Drei Daseinsmerkmale in der buddhistischen Lehre, drei Merkmale, die allen physischen und psychischen Phänomenen des Daseins innewohnen:
1. Vergänglichkeit, ‹anitya› oder ‹anicca
2. Leidhaftigkeit, ‹dukkha› (man kann es übersetzen mit dem Wort Stress)
3. Nicht-Wesenhaftigkeit, ‹anatman› oder ‹anatta›
Bruder David: Alles dreht sich um Nahrung und Paarung. Wir können den ganzen Prozess mit Humor anschauen. das macht uns zu Menschen.
Das Wort Humor ist aus der gleichen Sprachwurzel abgeleitet wie im Lateinischen die Worte, ‹humus› (Feuchtigkeit, fruchtbare Ackererde) und ‹homo› (Mensch). Wir sind ‹Erdlinge›.
[Siehe auch die Audios ‹Demut ‒ der Weg zum Gipfel› (12:13) und ‹Dem Welthaushalt freudig dienen› (48:27) in der Seminar-Reihe 2011 im Europakloster Gut Aich Dem Welthaushalt freudig dienen.]
Vanja: Humor ist für mich das Öl im Getriebe.
Bruder David: In jedem Menschen ist eine einzigartige Mischung von Leid und Freude. Keiner ist ersetzlich. Wenn wir unseren individuellen Beitrag geben, kann das im Positiven aus dem kommen, dass wir das Beste aus uns machen möchten. Im Negativen kann es aus der Rivalität kommen.
Postscriptum
Bruder David schreibt in seinem Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021): ‹Berufung ‒ folge deinem Stern›, 91f.; siehe auch in Berufung:
«Was ist mein tiefstes Begehren? Wozu bin ich besonders begabt? Und welche Gelegenheit bietet mir das Leben hier und jetzt, meine Begabung zu nutzen, um mein Begehren zu stillen?
Unser echtes Begehren sitzt tiefer als unsre Begierden.
Um herauszufinden, was wirklich dein tiefstes Begehren ist, wirst du einen Ort brauchen, an dem du ungestört allein sein und dir Zeit lassen kannst, um ganz still zu werden. Um innere Klarheit zu finden, ist Stille notwendig ‒ in uns und um uns herum.
Ein oft gebrauchtes Bild dafür ist trübes, aufgewirbeltes Wasser im Teich. In Stille wird es von selber klar. Du musst nichts tun, als zu warten, bis der Schlamm sich senkt, dann kannst du bis tief auf den Grund sehen. Stille ist auch unerlässlich, um die zarte Stimme des Herzens zu hören ‒ die Stimme unsres tiefsten Begehrens. Sie wird immer wieder übertönt vom lauten Schreien unsrer Begierden, verstummt aber doch nie ganz.
Begierden kommen und gehen. Um das bleibende Begehren unsres Herzens kennenzulernen, können wir uns also fragen: Wonach würde ich immer noch begehren, wenn all meine Begierden gestillt wären?»
Bruder David im Gespräch mit Anselm Grün und Johannes Kaup im Buch: Das glauben wir: Spiritualität für unsere Zeit (2015): ‹Die Achtlaster-Lehre ‒ oder: Die Anfänge einer spirituellen Psychologie›, S. 129-134:
«Weil ich selbst zum Jähzorn neige, hat es mich immer angesprochen, dass bei Thomas von Aquin der Zorn weitgehend positiv gewertet wird ‒ als eine Extraportion an Energie, die wir brauchen, um Widerstand zu überwinden, so wie wir beim Autofahren mehr Gas geben, wenn es steil den Berg hinaufgeht. Das negative am Zorn ist eigentlich nur die Ungeduld.» (S. 129)
«In unserem Kloster, in Mount Saviour, wurde uns die Lehre des frühen Mönchtums über Laster und Tugenden so dargestellt:
Unser Ziel ist es, wach im Jetzt zu stehen.
Dieses Ziel können wir auf dreierlei Weise verfehlen: Wir können das Jetzt versäumen, weil wir uns noch an die Vergangenheit klammern oder weil wir schon von der Zukunft träumen.
Wenn keines von beiden zutrifft, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das Jetzt zu versäumen: Wir können es verschlafen.
Alle anderen Laster entspringen diesen drei Wurzeln.
So sind zum Beispiel Nachträgerei, Geiz, Kleinlichkeit und Knauserei sowie Unmäßigkeit in Essen, Trinken, Sex und Luxus nicht offen für die einzigartig neue Gelegenheit, die das Jetzt uns bietet, weil wir uns an schon aus der Vergangenheit Bekanntes klammern.
Auf entgegengesetzte Weise können wir das Jetzt auch versäumen durch zornige Ungeduld, Neid und Missgunst, Geldgier, Ruhmsucht und ähnliche Verstrickungen in Wunschträume für unsere Zukunft.
Aber auch ohne an Zukunft oder Vergangenheit zu haften, können wir das Jetzt versäumen, etwa durch Trägheit, Trübsinn, Lauheit, Überdruss, oder durch jene Unlust auf allen Ebenen, die ‹akedia› genannt wurde und vom Mittagsdämon der Wüstenhitze stammen soll.
Diese Sicht vereinfacht den Katalog der Laster auf drei und macht zugleich verständlich, warum sie uns schaden:
Sie vereiteln unsere wache Antwort auf die Gelegenheit,
die das Jetzt uns schenkt.Man kann anhand dieses einfachen Schemas
aber auch erkennen,
dass jede dieser potentiell negativen Neigungen
auch etwas Positives hat.
Jeder von uns neigt von Natur aus zu einer dieser drei Haltungen. Jede hat ihre Licht- und Schattenseiten. Es geht darum, die Lichtseite unserer natürlichen Neigung zu erkennen und zu entwickeln.
Laster sind schlechte Gewohnheiten, die uns zur zweiten Natur geworden sind. Aber wir können uns auch gute Gewohnheiten zur zweiten Natur werden lassen, also zu Tugenden.
Zwei Schritte sind dazu nötige. Wenn wir im ersten Schritt unsere Neigung erkennen, können wir im zweiten Schritt fragen, was unsere naheliegenden Tugenden sind, Tugenden, die uns leicht fallen, weil wir durch unsere natürliche Neigung schon leidenschaftlich in dieser Richtung gepolt sind.» (S. 133)
«Grundsätzlich ist die Antwort auf die Frage, wie wir mit unseren Schwächen und Lastern umgehen,
nicht dagegen anzukämpfen,
sondern das Positive darin zu finden.
Das Positive, das mir am nächsten liegt,
gilt es zu entwickeln.» (S. 133)
Anselm Grün: «Ich zitiere da nur den Anfang des Märchens von den drei Sprachen. Der junge Sohn eines Grafen lernt die Sprache der bellenden Hunde. Sein zornentbrannter Vater verstößt daraufhin den Sohn. Dieser kommt zu einer Burg, um zu übernachten. Der Burgherr kann ihm nur den Turm anbieten, wo die bellenden Hunde hausen, die schon manchen zerrissen haben. Aber der Junge, der die Sprache der Hunde versteht, geht freundlich mit ihnen um. Da verraten sie ihm, dass sie nur deshalb so wütend sind, weil sie den Schatz hüten. Sie zeigen ihm den Schatz und helfen ihm, ihn auszugraben.
Das ist für mich ein hilfreiches Bild in der geistlichen Begleitung. Dort, wo einer die meisten Probleme hat ‒ der eine bei der Sexualität, der andere im Jähzorn, der andere wiederum in der Überempfindlichkeit ‒, liegt auch sein Schatz begraben. Der lauteste Hund ist der, der auch den Schatz anzeigt.» (S. 133f.)
Bruder David: «Ich habe mir immer gewünscht, dass es einen heiligen Georg gibt, den man klar an seinem Heiligenschein erkennen kann und der den Drachen tötet, den man natürlich schon deutlich an seinem Atem riechen kann.
Doch wo immer ich hinschaue,
hat in der Wirklichkeit der Drache
auch einen kleinen Heiligenschein
und der heilige Georg auch einen Drachenschwanz.
Also: Säuberliche Unterscheidungen finde ich nur in den Büchern, im wirklichen Leben nirgends.»
Bruder David zur ‹Akedia› oder ‹Acedia›, dem ‹Mittagsdämon› mit Trägheit, Trübsinn, Überdruss, Unlust auf allen Ebenen in seinem Buch Musik der Stille: Die Gregorianischen Gesänge und der Rhythmus des Lebens (2021), 102f.:
«Jeder hat seine eigene Version des Mittagsteufels. In der jüdischen Überlieferung wird gelehrt, dass man einfach tun soll, was einem aufgetragen ist, auch wenn einem nicht danach ist. Sag das Gebet, führe die Mizwa, das Gebot, aus. Mit der Zeit wird dein Gefühl sich dem, was du tust, angleichen. Wir wissen beispielsweise, dass eine wirkliche Hilfe in Depressionen ‒ für die der Mittagsteufel ein Symbol ist ‒ darin besteht, einfach in Bewegung zu bleiben: Mach einfach weiter, was du tun sollst, ob es dir gefällt oder nicht, ob dir danach ist oder nicht.
Der Mittagsteufel ist die Stimme der Negativität, der Verzweiflung und der Depression. Sein Gegenspieler, der ihm entgegengesetzte Engel, ist die Freude. Das Gegenteil von Freude ist nicht die Traurigkeit, sondern die Faulheit, welche die Mühe scheut, auf den geschenkten Augenblick voll und ganz zu antworten, und die Trübsinnigkeit, die daraus entspringt.»
Siehe auch in Erlösung ‒ Sünde und Heil: Ergänzend: 1.3. das Audio: Mit allen Sinnen leben
Christlicher Glaube in heutiger Sprache (3. Juli 1993):
Teil 3: «Die Rose, welche hier dein äußeres Auge sieht, die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht» (Angelus Silesius):
(11:51) In der Schule der Wüstenväter und Wüstenmütter: Drei Hauptsünden: 1. Ungeduld, Zorn ‒ 2. Lust im Sinn von ‹sich anklammern› ‒ 3. Faulheit, Acedia, Traurigkeit
Beten – mit dem Herzen horchen (1988)
Vortrag von Bruder David in der Fragerunde «Rechtgläubigkeit und Mystik»
Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
Teil I
00:00 Dogmatische Kämpfe vom mystischen Erleben her verstehen
Bruder David: «Die Frage ist im Zusammenhang mit meiner Gegenüberstellung von dem Glauben und den Glaubensüberzeugungen, von der ich gesagt habe, sie gehören zusammen — sie dürfen nicht getrennt werden, aber sie müssen klar unterschieden werden:
Wie sehen wir in dem Zusammenhang jetzt Jahrhunderte der Kirchengeschichte, besonders die ersten Jahrhunderte, in denen es so weitgehend um Glaubensüberzeugungen geht, bis der Glaube an den dreieinigen Gott und an Christus, die ganze Christologie, herausgehämmert wird, und manchmal herausgehämmert mit Waffengewalt und sich gegenseitig auf den Kopf hämmernd?
Wie sehen wir das?
Ich glaube, wir sehen es falsch, wenn wir es aus der tiefsten Überzeugung herauslösen, das worauf es letztlich ankommt, der Glaube ist.
Wenn auch da Gegensätze waren zwischen den verschiedenen Strömungen in der Kirche, und dann schließlich zwischen der Kirche, die sich herauskristallisiert hat, und denen, die sich abgespalten haben — auch wenn diese Gegensätze da waren:
Was allen gemeinsam war und was wir nicht übersehen dürfen, nicht vergessen dürfen, ist, dass worauf es letztlich ankommt, der tiefste Glaube ist.
Aber, worum es in der Ausformung der Glaubensbekenntnisse geht, ist der Ausdruck — und ein immer nicht ganz völlig gelungener Ausdruck, das muss man auch sagen — es ist ein Aussprechen des Unaussprechlichen, um was es da geht, dessen waren sich auch alle bewusst:
Es geht darum, dass die tiefsten Erkenntnisse des Herzens auszusprechen sind, genau das, worum wir uns heute bemüht haben.
Wenn wir an diese Glaubensstreitigkeiten und die Glaubensentwicklung der ersten Jahrhunderte nur so von außen herangehen, nur so geschichtlich, und sehen dabei nur eine Folge von Strömungen, bei denen eine aus oft sehr politischen Gründen
gewonnen hat und eine andere unterlegen ist, dann bleibt das völlig an der Oberfläche.
Wir müssen uns fragen: Worauf haben sich diese Menschen gestützt?
Ja, sie haben sich auf die Schrift gestützt, aber nicht auf die Schrift als einem toten Buchstaben, der dort steht: Aus der Schrift als einen toten Buchstaben kann man viel Widersprüchliches herauslesen: Und daher auch diese Glaubensstreitigkeiten.
Worauf sie sich wirklich gestützt haben, war ihr mystisches Erleben, ihr Christus Erleben, genau das, wovon wir auch heute gesprochen haben, und das hat sich als Ergebnis eines mühsamen Ringens in den Glaubenssätzen ausgesprochen:
Zum Beispiel gegen alle gnostischen Tendenzen — das ist heute wieder sehr spruchreif: Die Gnostiker haben den Leib und den Geist — das war eines der wichtigen Merkmale dieser ganzen Bewegung, die man Gnostik genannt hat: Sie haben den Leib und den Geist völlig polarisiert — ‘geistig‘ oder ‚leiblich‘—, soweit das manchmal so ausgedrückt wurde, dass der Widersacher, der Teufel, die Leiber baut und die Seelen darin fängt — die werden dann von Christus befreit, oder so etwas —, und dagegen hat sich zum Beispiel die orthodoxe Kirche ausdrücklich ausgesprochen, dass eben wir eins sind, und dass Christus im Fleisch gekommen ist.
Und schon das Johannesevangelium beginnt sich gegen diese gnostischen Einstellungen auszusprechen — ausdrücklich in dieser Richtung formuliert zu sein, dass also:
Leib und Seele — ‚Was er angenommen hat, das hat er erlöst‘,
Christus ist: ‚Wahrer Mensch und wahrer Gott‘:
Das wäre so ein Punkt, aber das Wichtige daran ist, zu fragen:
Worauf haben sich die Kirchenväter, die unsere Lehrsätze formuliert haben, gestützt?
Ja, sie haben sich auf die Schrift gestützt, weil sich auch ihre Gegner auf die Schrift gestützt haben. Auf was haben sie sich sonst noch gestützt? —
Auf ihr mystisches Erleben! Sonst wäre uns das nicht nachvollziehbar.
Das ist nicht etwas, was so in der Luft hängt, das ist nicht etwas, was vom Himmel heruntergefallen ist, das ist etwas, was Menschen in der Nachfolge Christi, die ja mit dem Herzen — das schließt den Verstand ein und den Willen und die Gefühle —, völlig durchgearbeitet haben, und manchmal nicht nur die Theologen, nicht nur die Bischöfe:
Der Arianismus zum Beispiel: Die ganze Welt, die Mehrzahl der Bischöfe waren Arianer zur Zeit der Hochblüte des Arianismus, und es war das christliche Volk, das den christlichen Glauben festgehalten hat.
Das ist für uns heutzutage sehr wichtig, dass jeder Einzelne von uns verantwortlich ist für den Glauben und nicht nur für das, was im Katechismus steht.
Viele Leute haben den Katechismus gelesen oder gelernt, und haben keinerlei Beziehung mehr zum Christentum.
Für wen ist das Christentum lebendig?
Für alle jene, denen es möglich war, die Lehren der Kirche mit ihrem Erleben zu verbinden.
Auf das Erleben kommt es an: Was nicht aus dem Erleben stammt und zum erlebten Erleben führt, ist tot!»
06:02 Liebe statt Rechtgläubigkeit — Das Jüngste Gericht (Mt 25,31-46)
Ein Teilnehmer: «Worauf es ankommt, ist die Liebe!»
Bruder David: «Ich hab dem kaum etwas hinzuzufügen: Wonach wir gerichtet werden — im 25. Kp. von Matthäus — ist unsere Liebe: Unsere Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, nicht unsere Rechtgläubigkeit!
Und das interessante ist dort noch, dass die, die also nicht richtig gehandelt haben, die sind, die ja Christus gekannt haben.
Denn die Szene ist die: Jesus sagt: ‚Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank und ihr habt mir nicht geholfen‘ usw. Und die einen sagen: ‚Wann haben wir dich krank gesehen?‘ Das heißt: ‚Wir kennen dich ja, und wir haben dich nie krank gesehen‘. Und die sind es, die fehl gegangen sind.
Die anderen, denen der Richter hier sagt: ‚Ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist‘, sagen: ‚Wann haben wir dich gesehen? — Wir kennen dich ja gar nicht.‘
So die, die ihn so gar nicht kennen, sind die, die am Ende gerechtfertigt werden in der Geschichte als die, die sich richtig verhalten haben.
Und die, die ihn gekannt haben, haben ihn nicht erkannt. Das ist noch ein Schritt weiter hinein in diese Problematik. Das ist ein ungeheuer wichtiges Kapitel.»
07:37 Mystik in einer Kirche, die sich auf die Lehre versteift?
Ein Teilnehmer: «War es nicht ein Fehler der Kirche, dass sie sich auf Dogmatik und auf Scholastik versteift hat und die Mystik dabei zu kurz kommen ließ?»
Bruder David: «Wenn man einen geschichtlichen Überblick macht, legt vieles dieses Urteil nahe. Ich würde das schon sagen.
Andererseits richtig verstanden, war die Mystik immer da, und wenn Sie sich an ihre Großmütter erinnern, und an alte, einfache Leute in den Bergen, die ihren Rosenkranz gebetet haben und ihren Angelus, wenn die Glocken geläutet haben, und die am Sonntag in die Kirche gegangen sind und zu den Maiandachten:
Da ist eine so tiefe Mystik unter Umständen drin, eine so tiefe Verbundenheit mit Gott, erlebnismäßige Verbundenheit mit Gott, dass wir mit all unseren ganzen mystischen Erlebnissen denen nicht einmal das Wasser reichen können — unter Umständen:
Es ist nicht damit gegeben, aber irgendeiner Religion, inklusive des Christentums, wirklich das religiöse Leben, das heißt das mystische Leben, abzusprechen, das wäre falsch.
Aber Sie haben vollkommen recht: Geschichtlich gesehen ist das Schwergewicht immer auf die Rechtgläubigkeit gefallen, anstatt auf das rechte Leben aus dem Geist heraus.»
Und deshalb müssten wir als die Neuerer innerhalb der Kirche — wenn wir noch in der Kirche stehen —, uns auf das Älteste besinnen, und das ist wieder das Mystische, und das trifft sich mit dem Neuen ganz.»
09:21 Mystische Phänomene im Unterschied zu Mystik
Bruder David zu einer Teilnehmerin: «Sie haben ausdrücklich über Mystik gefragt und da möchte ich sagen, wenn ich über Mystik hier spreche, ich nicht irgendwelche Phänomene im Auge habe, die oft mit der Mystik Hand in Hand gehen und oft so als besonders betont werden, wenn man von Mystik spricht.
Das ist mir hier wichtig: Mystik ist etwas, was keiner von uns sich absprechen lassen darf, Mystik ist das tiefste Erleben unseres Herzens von der Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen, das ist das Mystische.
Alles Drum und Dran: Elevation und an zwei Orten zugleich sein und in Sprachen sprechen und alle diese Erscheinungen usw., das kann oder kann nicht dabei sein, und kann sogar davon getrennt vorkommen. Das sind Phänomene, die wir heutzutage noch nicht völlig verstehen, und die mit dem Mystischen als solchem nicht ausdrücklich zu tun haben.
Die Mystiker sind die Ersten, die das immer wieder betonen und die Kirche hat das immer wieder betont.»
10:27 Pantheismus: Zustimmung und Abgrenzung.
Die Frage war: «Ja, ich habe diese Einstellung, von der Sie da gesprochen haben, öfters ganz spontan, aber dann fürchte ich mich immer, das kommt mir immer so wie Pantheismus vor».
Bruder David: «Wo stehen wir in Hinblick auf den Pantheismus?
Ich glaube, man kann mit Recht sagen: Dass unter allen Religionen der Erde das Christentum dem Pantheismus so nahe kommt, wie man nur überhaupt nahe kommen kann, ohne Pantheist zu sein.
Also: Alles ist da, was sich der Pantheismus nur erträumen kann, mit einem Unterschied: Und das ist die Dankbarkeit:
Denn im klassischen Pantheismus, und die Frage ist — es ist eine ganz berechtigte Frage unter Religionsphilosophen —, ob es überhaupt je einen klassischen Pantheisten gegeben hat. Es ist eine große Frage, denn man kann nicht eigentlich religiös und Pantheist sein im klassischen Sinn, so dass auch die Leute, die sich für Pantheisten halten, vielleicht gar nicht klassisch Pantheisten sind, sondern zutiefst religiös.
Der Unterschied ist der: Im klassischen Pantheismus fließt die Welt und wir und alles, was ist, unweigerlich aus Gott sozusagen. Gott kann sich gar nicht helfen, wenn man das so ausdrücken will. Es ist nur so eine Ausstrahlung von Gott. Alles ist Gott — nicht wahr? Dann bin ich einfach Gott.
Das entspricht aber unserem religiösen Erleben gar nicht.
Das Herz des religiösen Erlebens ist unsere Dankbarkeit.
Und ‚dankbar‘ ist etwas, was wir nicht uns selber sein können. Sie können sehr freundlich zu sich sein und sich alles gönnen, aber wenn sie nach Hause kommen, nachdem sie sich alles gegönnt haben, können sie nicht sich selber danken dafür. Das ist einfach Akrobatik, die unserem Geist nicht möglich ist.
Dankbarkeit richtet sich immer auf einen anderen, aber auf einen anderen, dem wir so tief verbunden sind — und je tiefer wir dem anderen verbunden sind: ein Herz und eine Seele —, umso dankbarer sind wir.
Das schließt gar nicht aus, dass Gott uns näher ist als wir uns selber sind.
Aber die Dankbarkeit ist der kleine Unterschied zwischen echter Religiosität und einem einfach philosophischen Pantheismus, der sich religiös nicht nachvollziehen lässt.
Und darum kann man sagen:
Wenn ‚das Wort Fleisch geworden ist‘, wenn wir Gott mit unseren Sinnen erfassen können, — und das schließt schon die erste Seite vom 1. Johannesbrief, eine ganz wichtige Stelle im Neuen Testament ein:
‚Den wir angefasst haben, den unsere eigenen Augen gesehen haben, was wir berührt haben, was wir mit unseren Sinnen erfahren haben vom ewigen Wort Gottes, von dem sprechen wir, nicht von irgendwelchen Überlegungen, so dass unsere Freude allen zuteilwerde‘ (1 Joh 1,1-4).
Also: Pantheismus: Keine Angst!
Solange wir Angst haben vor dem Pantheismus, brauchen wir keine Angst davor zu haben — so kann man es auch ausdrücken.
Solange wir dankbar sind, wenn es auch jemand anderen vielleicht pantheistisch erscheint: Es ist nur umso christlicher, wenn wir glauben, dass ‚das Wort Fleisch geworden ist‘ (Joh 1,14), dann übertrifft das alles, was der Pantheismus überhaupt sich nur erträumen kann.»
Jemand fragt nach: «Was ist mit Pantheismus gemeint?» —
«Dass alles Gott ist — pan, griechisch alles / theos — Gott, dass alles einfach Gott ist, einfach Gott.
Dass Gott in allem ist und dass alles in Gott ist, das nennt man übrigens auch: Pan-en-theismus:
Das ist mit der christlichen Überzeugung nicht nur vereinbar, sondern es wird eigentlich verlangt von unserem christlichen Glauben. Dass, wenn Gott spricht, dass das ja nicht eine Konversation ist, sondern, dass Gott sich selbst ausspricht, dass Gott das göttliche Wesen ausspricht:
‚Und Gott sprach und es ward Licht‘ (Gen 1,3).
Und seit dem, wenn immer jemand Licht sieht, sieht man Gott, — das von Gott, was eben zu sehen ist durch die Augen. Und wenn man etwas hört, so hört man Gott, das Meer und das Firmament und die Sterne und die Erde und alles ist Wort Gottes in der Bibel schon von der ersten Seite an, das heißt, in allem können wir Gott finden, und daher auch im Menschen dann: ‚Lass uns den Menschen schaffen nach unserem Ebenbild‘ (Gen 1,26).
Auch wenn wir einen Menschen sehen, sehen wir Gott in letzter Hinsicht, und wenn wir Gott nicht sehen, haben wir den Menschen noch nicht richtig gesehen, nicht mit dem Herzen haben wir den anderen Menschen gesehen.»
Beten – mit dem Herzen horchen (1988)
Vortrag von Bruder David in der Fragerunde «Das Urwesen des Christlichen zurückgewinnen»
Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
Teil II
00:00 Gott mütterlich
Jemand fragt: «Was Sie so sagen, setzt irgendwie den gütigen Gott voraus. Mir ist aber immer so der strenge und strafende Gott — steht so hinter mir und schreckt mich: Was ist dazu zu sagen?»
Bruder David: «Ich greife das besonders auf, weil das so oft so vielen Christen so geht. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Gott in der Bibel immer als der Vater und immer als männlich vorgestellt wird:
In der Bibel und im biblischen Zusammenhang heißt das etwas anderes als es für uns heißt. Das ist sehr wichtig das festzuhalten:
Wir dürfen nicht unsere Vorstellung vom Vater, der so gar nicht mütterlich ist, jetzt auf die Bibel zurückprojizieren. Und das könnte man aus der Bibel selbst beweisen, dass das ganz falsch ist. Aber jedenfalls tun wir das unwillkürlich und daher haben wir jetzt die Vorstellung von Gott als dem Vater, und was wir in unserer Kultur weitgehend mit Vater verbinden, ist die Vorstellung, dass der Vater uns bedingungsweise liebt, während die Mutter uns bedingungslos liebt. Der Vater liebt uns, wenn wir so und so das tun oder das nicht tun, die Mutter liebt uns unter allen Umständen.
Und Gott wird in der hebräischen Bibel, schon in dem, was wir das Alte Testament nennen, viel mütterlicher dargestellt als wir uns die Mutter vorstellen.
Die Liebe Gottes, schon im Alten Testament: Das hebräische Wort dafür kommt von derselben Wurzel wie der ‚Mutterschoß‘, was wir mit ‚Gottes Barmherzigkeit‘ übersetzen ins Deutsche. — Das hebräische Wort ist rachamím, der Plural von ræchæm, und ræchæm heißt der ‚Mutterschoß‘.
Also die Barmherzigkeit Gottes ist — fast wörtlich übersetzt — die Mütterlichkeit Gottes. Das haben wir eben verloren.
Und wenn wir uns das mehr zum Bewusstsein bringen könnten, und immer wieder uns daran erinnern — das ist schwer, wenn man immer von Gott als ‚Er‘ spricht —, aber wir müssen irgendwie versuchen, uns das zurück zu gewinnen.
Und natürlich dann auch im Neuen Testament: Oft wird darauf angespielt, umso mehr natürlich:
Die wichtigste Stelle, in der die ganze Botschaft Jesu zusammengefasst wird, in
Mk 1,15: Jesus kommt nach Galiläa und verkündet die Frohbotschaft und sagt:
‚Die Zeit ist erfüllt, jetzt, das Reich Gottes ist zur Hand, hier, nahe, zur Hand: Bekehrt euch und glaubt der frohen Botschaft.‘
Und die frohe Botschaft ist — das hat Paulus schon lange vor Markus, die frühen Paulusbriefe kommen ja vor den Evangelien, vorher schon gesagt:
‚Aus Gnade seid ihr erlöst, aus Gnade, nicht durch irgendwelche Werke‘
(Eph 2,8f.).
Wir haben es uns nicht verdient!
Das ist die frohe Botschaft, dass wir uns nichts verdienen müssen:
Aus Gnade und bedingungslos liebt uns Gott.
‚Und jetzt lebt dementsprechend‘, das ist dann das Nächste, das gehört schon auch dazu.
Also ich glaube, wenn wir uns wirklich auf die Botschaft Jesu zurückbesinnen, auf die wirkliche Botschaft Jesu, und das ernster nehmen als den Rahmen, in dem uns Religionsunterricht oder unsere erste Religionsausbildung erteilt wurde, wenn wir das ernster nehmen, dann können wir das ein bisschen überwinden. Aber schwierig bleibt es.»
04:47 Kreuz und Auferstehung ist nur vom Leben Jesu her zu verstehen
Bruder David: «Alles steht und fällt im Christentum mit der Auferstehung. Das sagte schon Paulus:
‚Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendesten aller Menschen‘ (1 Kor 15,19).
Was ich eigentlich zu Kreuz und Auferstehung zu sagen habe, und zwar nur deshalb, weil es nicht genügend betont wird, ist, dass wir das Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu — das gehört alles zusammen — nicht, wie das so oft getan wird, abgetrennt von seinem Leben betrachten dürfen.
Man kann es vielleicht so ausdrücken: Es waren ja drei gekreuzigt. Stellen Sie sich vor, dass nicht Jesus auferstanden ist, sondern einer von den beiden, die mit ihm gekreuzigt waren. So, am dritten Tag ist er nicht mehr tot, sondern er lebt. Was heißt das? Wem bedeutet das etwas? Was ist daraus zu schließen? — Nichts!
Warum ist es so entscheidend, dass Jesus lebt?
Weil dadurch denen, die mit ihm gelebt haben, klar wird, dass das, wofür Jeus steht — der Name Jesu, wie wir vorher gesagt haben —, das wofür Jesus sein ganzes Leben gelebt hat, eben nicht weggeräumt werden kann durch den Tod, sondern lebt, auch wenn es gestorben ist — und wirklich gestorben ist, und wenn er für seine Überzeugung gestorben ist. Er ist wahrhaft gestorben, das Lamm ist geschlachtet und siehe, es lebt, er lebt, er ist lebendig:
Das ist das Entscheidende!
Und dann müssen wir uns fragen: Was ist dann dieser Geist Jesu, der nicht getötet werden kann — nicht Geist in dem Sinn von Gespenst —, was ist diese Lebensüberzeugung Jesu, auf die es uns ankommt, wenn wir von der Auferstehung sprechen?
Und das ist: Aus dem Herzen leben.
Er richtet sich auch immer an das Herz seiner Hörer und nicht an ihren Verstand und nicht an ihre religiösen Überzeugungen, sondern immer an ihr wirkliches Leben, an den mystischen Kern, aber das natürlich können wir hier nicht weiter ausführen.
Aber das Wichtige ist, dass wir, wenn wir das Glaubensbekenntnis beten: Wir springen von ‚Empfangen von der Jungfrau Maria‘ zu ‚Gelitten unter Pontius Pilatus‘.
Um Himmelswillen, da liegt ja etwas dazwischen!
Und das müssen wir mit unserem Glauben wieder gewinnen, was dazwischen liegt: Dass Jesus auf eine ganz gewisse Weise gelebt hat, für uns gelebt hat, sonst könnten wir nicht sagen, er ist für uns gestorben, sein Kreuz ist ja nicht so etwas, was so zufällig vom Himmel fällt.
Warum ist er denn gekreuzigt worden?
Weil er in einer gewissen Weise gelebt hat, aus einer Lebensquelle heraus: Wenn man aus dieser Lebensquelle heraus lebt und aus dieser Überzeugung, wird man möglicherweise auch heutzutage gekreuzigt werden oder so etwas ähnliches. Darauf kommt es an:
Auf die Lebensüberzeugung Jesu, nicht auf irgendetwas Magisches: Das sind Überstrukturen, das sind Theorien, die nicht unbedingt falsch sind, aber heutzutage viele Menschen irreführen.
Wenn man über den Tod und die Auferstehung spricht, ohne über das Leben Jesu zu sprechen, das ist sehr gefährlich.»
08:29 Reinkarnation, Wiedergeburt
«In letzter Zeit hört man viel von Reinkarnation und Wiedergeburt: Hat es einen Platz im Christentum?»
Bruder David: «In der frühesten Zeit des Christentums bis Origines, also das war so Mitte des 3. Jh. war das sehr weit verbreitet, aber man kann nicht sagen, es hat zum christlichen Glauben gehört, aber man hat jedenfalls keinerlei Widerspruch gesehen zu dem christlichen Glauben. Dann wurde Origines — seine Schriften — von der offiziellen Kirche zurückgewiesen, nicht so sehr wegen irgendwelchen Fehlern, die er selber gemacht hat, sondern wegen Übertreibung so seiner Jünger und seiner Nachfolger. Und damit wurde auch das in Bausch und Bogen hinausgestoßen und nie wieder eigentlich rehabilitiert. Und die Frage hat sich dann nicht mehr so gestellt.
Heute stellt sich die Frage nach Reinkarnation und: Ist dieses Leben das einzige Leben? usw. dadurch, dass wir mit östlichen Religionen in Verbindung kommen, in denen das eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen also die Frage ganz neu durchdenken. Und das ist heute noch nicht geschehen.
Aber ein so großer und unbedingt orthodoxer Theologe wie Karl Rahner hat gegen Ende seines Lebens — er hat erst gegen Ende seines Lebens begonnen, sich mit östlichen Religionen auseinanderzusetzen —, hat er einen Aufsatz geschrieben, und ich habe es selber gelesen, über das, was wir die letzten Dinge nennen: Tod, Gericht, Fegefeuer, Himmel, Hölle. Und im Zusammenhang mit Fegefeuer hat er geschrieben — die Reinigung — das ist ja auch nur ein Bild natürlich, eine bildliche Vorstellung des Fegefeuers:
‚An diesem Punkt müssten wir die Reinkarnation neu durchdenken, da passt sie wahrscheinlich herein‘ oder so ähnliche Worte[1] —
Und da stehen wir jetzt. Es ist eine Frage, die sich in unserer Zeit aufgeworfen hat, die Theologen noch nicht durchgedacht haben und die jedenfalls in diesen Bereich hinein passt.
Mit anderen Worten: Die Lehre von der Reinkarnation, die ja auch nur eine Symbolsprache ist, das ist nicht historisch zu nehmen, in den Kleinbüchern wird das manchmal so dargestellt, aber von den Lehrern der großen Traditionen ist das nicht so dargestellt: ‚Ich war einmal das und jetzt werde ich das sein oder so‘.
Wer bin denn ich?
Das ist schon die Frage zum Beispiel in dem Zusammenhang. Was ist denn dieses Ich, das einmal das war?
Das ist sehr kompliziert philosophisch und theologisch.
Aber jedenfalls: Es ist eine Bildsprache, die auf dieselben Fragen grundsätzlich antwortet, auf die wir mit Fegefeuer antworten in der christlichen Tradition.
Nämlich: Was sollen wir sagen von einem Menschen — das war schon in der frühesten Kirche eine Frage —, der stirbt und von dem man von uns aus gesehen nicht sagen kann, dass er wirklich ausgereift ist zur Fülle seines Menschseins, zur Anschauung Gottes —, andererseits aber auch nicht ein völliges Versagen da war, ein völlig verfehltes Leben? Was soll man von dem sagen?
Und unser Herz sagt ganz spontan: Ja, dem wird Gott noch eine andere Gelegenheit geben. Und da sagen wir: Aha, also zwischen dem Tod und der Anschauung Gottes ist eine Gelegenheit zur Läuterung für die, die grundsätzlich in der richtigen Einstellung sind, aber noch nicht völlig geläutert.
Und der Osten sagt jetzt: Ja, da sind so viele Lebensspannen, die da hineinpassen und in jedem Leben werden wir mehr geläutert. Und wir können nur darüber sagen: Wir wissen es nicht. Wir haben darüber nicht nachgedacht — und wer kann es schon wissen?
Und einmal nach einer — ich hatte das Glück gehabt, viele Gelegenheiten zu haben mit buddhistischen und auch mit hinduistischen Lehrern auch darüber zu sprechen —, und einmal nach einer stundenlangen Diskussion mit einem Hindu Swami über Reinkarnation hat er dann alles zusammengefasst mit den Worten: ‚Ja, wenn es wirklich so wichtig wäre, dann hätte uns Gott sicher größere Klarheit darüber geschenkt‘ — (Lachen im Saal): Das war von der Hinduseite.
Und das können wir Christen auch sagen: Wir wissen nichts. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns alle, dass wir lernen zu sagen: Wir wissen es nicht. In der Religion muss man nicht alles wissen. Religion ist nicht die Instanz, die alles weiß und über alles antwortet. Nur über das Wesentliche.»
13:52 Bruder Davids Einsichten in den Buddhismus
Bruder David: «Das stimmt, dass ich das Glück gehabt habe, verschiedenen anderen Religionen schon als Mönch ausgesetzt zu sein, von meinem Kloster dorthin geschickt. Ich habe mehrere Jahre z.B. bei Zen Mönchen gelebt und dort praktiziert.
Die wichtigste Erfahrung ist natürlich die, dass im Letzten kein Widerspruch besteht.
Ich bin nicht hingegangen mit dieser Überzeugung. Ich bin einfach hingegangen mit Offenheit, zu sehen, wie es dort steht. Und immer mit der kritischen Offenheit, die ich auch hier vorgeschlagen habe. Man öffnet sich, aber man öffnet sich nicht unkritisch. Man frägt immer, man hinterfrägt immer. Mit dieser Haltung habe ich mehr als drei Jahre nicht nur über Buddhismus nachgedacht oder über Buddhismus gelesen, sondern mit buddhistischen Mönchen gelebt, und bin zu der Überzeugung gekommen, dass im Tiefsten kein Widerspruch besteht. In oberflächlichen Sachen
bestehen ja auch Widersprüche zwischen Benediktinern und Jesuiten oder Dominikanern und Franziskanern. Aber im Tiefsten bestehen keine Widersprüche zwischen Christen und Buddhisten.
Und dass man dadurch — und das gehört dazu — durch die Begegnung mit anderen Religionen unter Umständen, wenn alles gut geht, neue Horizonte seiner eigenen Religion sehen kann, die vorher gar nicht in den Blick gerückt sind. Es werden da Fragen erhoben, die man, solange man nur mit sich selber spricht, nie erhebt, es werden ganz neue Fragen gestellt: Man muss sie jetzt beantworten. Und durch diese Gegenüberstellung: Man kann nicht mehr im eigenen Privatjargon sprechen wie zu Hause. Man muss das jetzt mit allgemeinmenschlicher Sprache aussprechen.
Dadurch kann diese Religionsbegegnung für uns sehr wichtig und für uns sehr hilfreich sein. Allerdings werden die Meisten von uns dem nicht ausgesetzt sein. Aber dadurch, dass heutzutage schon mehr und mehr Menschen in dem Religionsgespräch stehen, wirkt das auch auf uns alle so im übertragenen Sinn dann weiter.
Das Wichtigste war eigentlich, dass kein Widerspruch entsteht und dass man dabei sogar noch tiefer in seinen eigenen Glauben hinein kommt — kommen kann.»
Eine Teilnehmerin: «Was war dann der mystische Kern bei den Buddhisten?»
Bruder David: «Christlich gesprochen — und das würde ich nicht den Buddhisten jetzt auflasten, die würden das nicht so sagen —, aber christlich gesprochen: Der Vater. Und zwar ist der Vater das Schweigen, aus dem das Wort kommt. Und wenn Zen-Buddhisten auf ihrer Matte sitzen, dann beten sie in unserem Sinn, indem sie sich ständig in dieses Schweigen fallen lassen.»
17:02 New Age und ‚Selbsterlösung‘
Eine letzte Frage: «Was würden Sie zu New Age sagen? Und sehen sie da eine Frage zu ‚Selbsterlösung‘?»
Bruder David: «New Age ist ein sehr vager Begriff und wird gewöhnlich verwendet von Leuten, die sich gegen das Neue so im Allgemeinen wehren und vor dem Neuen im Allgemeinen Angst haben, und das jetzt projizieren in diese fast Personifizierung von New Age, als ob das so eine Art Club wäre oder eine Sekte oder so etwas, die sich so zusammengetan haben und irgendwie zusammengehören, und da werden dann alle möglichen Sachen hineinprojiziert, nämlich zum Beispiel die Idee von der Selbsterlösung usw., auf die ich gleich zurückkommen werde.
Aber der erste Punkt ist, dass es dieses New Age als eine klar ausgeformte Bewegung nie gegeben hat und auch jetzt nicht gibt. Es gibt nur Menschen, die dem Neuen offener sind und andere, die sich vor dem Neuen fürchten und oft auch dem Neuen verschließen. Und die nennen dann diese Welle, die sich jetzt in vielen, vielen Gebieten zeigt:
Das Neue bricht durch, wir sind in einer Zeit, in der das Neue aufbricht, ‚jede Stunde, die hingeht wird jünger‘ (Rilke, Sonette an Orpheus 2. Teil, XXV), es ist
eine Vorfrühlingszeit, es ist eine Zeit des Neuen, des Aufbruches und des Umbruches, eine Wendezeit — in dieser Zeit darf man sich dem Neuen nicht verschließen.
Man muss aber auch zugeben, dass im Neuen, wie im Alten, Verirrungen stattfinden, und Selbsterlösung kann falsch verstanden werden.
Es handelt sich hier nicht um die Frage: Kann ich mich selbst erlösen, so mit dem eigenen Schuhriemen aus dem Sumpf ziehen oder so etwas? Oder muss ich mich auf jemand anderen verlassen? Sondern es handelt sich hier, wenn ich es richtig verstehe, um einen Hinweis von Menschen, die sehr wach sind für etwas, was wir in
der traditionellen Kirche oft übersehen haben, dass es nach der strengsten Lehre der christlichen Tradition unser Erlöser einer von uns ist.
19:44 Erlösung in biblischer Schau
Das ist das Urwesen des Christlichen, dass Gott uns nicht so von außen erlöst, sonst müsste man ja diese ganze christliche Geschichte gar nicht haben, sondern, dass die Erlösung von innen kommt, durch einen, der uns gleich ist in allem. Das ist ausdrücklich gesagt von Christus:
Jesus Christus ist uns in allem gleich außer in dieser Entfremdung, in der Sünde — richtig verstanden — in der Vereinzelung, in der Verelendung, in der inneren Abspaltung von unserem göttlichen Kern, von unserem innersten göttlichen Wesen.
Man kann es auch so ausdrücken — und das ist der Sprache der Bibel sehr nahe: Gott hat uns Menschen — das ist jetzt biblische Bildersprache — so erschaffen, dass was unser Leben durchdringt — der Lebenshauch, den wir atmen —, das göttliche Leben ist.
Das ist schon nach der ersten Seite der Bibel: Gott erschafft uns Menschen und atmet uns seinen eigenen Lebensgeist ein.
Wir sind die Geschöpfe, die mit Gottes eigenem Lebensgeist lebendig sind. Und dann fallen wir von unserem eigenen wahren Selbst ab in unser kleines Selbst hinein.
Unser wahres Selbst ist das göttliche Selbst und endlich nach Jahrtausenden kommt dann einer: Das ist eben Christus in der christlichen Schau, Jesus Christus, der endlich das wird, was Gott mit dem ersten Menschen schon beabsichtigt hat, mit uns allen.
Und er ist nicht von uns getrennt: Das muss man auch so betonen. Das ist nicht etwas, was sich so halt in Jesus dort vor langer Zeit einmal begeben hat, sondern in der biblischen Schau hängen wir alle zusammen.
Adam —Mensch, bedeutet nicht einen Menschen, bedeutet nicht den ersten Menschen. Adam in der Bibel heißt: Mensch — wir alle.
Und Jesus ist einer von uns allen und der, der deshalb für uns alle, an unserer Stelle das wird, was wir werden sollten, nämlich völlig göttlich. Und ich sage: ‚Er wird es‘ — das war auch eine frühe Ausdrucksweise des neuen Testamentes.
22:24 Die ursprüngliche Christologie
Im Neuen Testament finden wir viele verschiedene Christologien, eine neben der anderen, wahrscheinlich deshalb, damit man nicht den Eindruck gewinnen soll, dass man mit einer Christologie alles richtig aussprechen kann.
Da ist die Christologie von unten: ‚Er wird‘, ‚Gott hat ihn erhöht‘, ‚Gott hat ihn auferweckt‘. Da ist eine andere, von oben: ‚Das Wort ist Fleisch geworden‘, aber die ursprüngliche, die frühere, und die, die von allen übrigen vorausgesetzt wird, ist die Christologie von unten:
‚Einer von uns ist völlig Mensch geworden‘ und daher völlig göttlich. Denn das ist es, was ursprünglich Menschsein heißt.
Und daher: Das wahre Selbst von uns allen ist Christus.
In unserem innersten Herzen haben wir Zugang zu dem Herzen der Welt, zu dem, in dem wir alle eins sind, weil wir im Herzen allen zugehören:
Im Herzen sind wir alle eins, und das ist das göttliche Herz. Und daher ist die Frage von der Selbsterlösung gar nicht so einfach:
Im richtigen Sinn verstanden ist unser wahres Selbst Jesus Christus, in dessen Bild und Gleichnis wir erschaffen sind, und er hat uns erlöst. Und dieser kleine Punkt wird oft von Leuten gesehen, die sonst dem Glauben fernstehen, und von anderen als Selbsterlösungsglaube gebrandmarkt. Das ist eine schwierige theologische Frage, die sich dahinter verbirgt. Und ich fürchte, ich konnte Ihnen den entscheidenden Punkt, um den es geht, so aus dem Stegreif heraus nicht genügend klar darstellen. Aber wenn ich es wenigstens andeuten konnte, vielleicht auch, wenn Sie mir mit weiteren Fragen weiterhelfen.
Worauf es hinausläuft: Es läuft darauf hinaus, dass nach dem orthodoxen christlichen Glauben, nach der christlichen Rechtgläubigkeit, die Trennung zwischen Gott und uns, mit der wir anfangen, wenn wir von der Erlösung sprechen, schon ein falscher Anfang ist. Da kann man gar nicht anfangen.
Gott ist nicht von uns getrennt, Gott ist das Selbst unseres Selbst, wir leben mit Gottes eigenem Lebensatem. Nur leben wir nicht danach. Und einer lebt danach, einer von uns, und daher haben wir es geschafft, sozusagen.
24:59 ‚Ich bin‘ — Werden, was er ist
Immer wieder legt Johannes Jesus diese Worte in den Mund: ‚Ich bin‘. Und das ist zugleich eine göttliche Aussage: Gott, der zu Moses sagt: ‚Ich bin‘. Und so sagt Jesus: ‚Ich bin‘: Also, es ist dasselbe Wortspiel.»
Eine Teilnehmerin: «Auf uns alle?»
Bruder David: «Ja, nach dem Johannesevangelium ist es auf uns alle übertragbar, und es ist ein sehr wichtiger Punkt:
Im Prolog des Johannesevangeliums, der heutzutage also hunderte Male analysiert wurde, und ganz im Zentrum des Interesses steht, ist der Mittelpunkt und die Hauptaussage — das sieht man aus der Struktur — nicht, was wir annehmen würden, dass ‚das Wort Fleisch geworden ist‘ (Joh 1,14) — das ist ungeheuer wichtig.
Aber die Hauptaussage im Prolog ist:
‚Und all denen, die an ihn glauben, gab er Kraft, Kinder Gottes zu werden‘
(Joh 1,12f.):
Nämlich das zu werden, was er ist, in ihm und durch ihn und mit ihm: Es ist ja nicht ihm gegenüber. Dieser Individualismus ist der Bibel völlig fremd.
Weil er es geworden ist, haben wir die Möglichkeit, es zu sein.
Er hat es für uns getan, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir sind gar nicht abgetrennt voneinander.»
Bruder David schließt mit der Bemerkung:
«Es lässt sich das alles mit dem orthodoxen christlichen Glauben völlig vereinbaren, wenn man vorsichtig ist. Aber das ist so wie Hirnoperation selbst ausgeführt.»
[1] http://www.christian-reincarnation.com/Rahner.htm
Copyright © 2026 - Bibliothek - David Steindl-Rast OSB