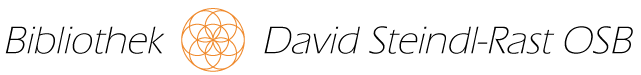Text, Video und Audios von Br. David Steindl-Rast OSB
«Du großes Geheimnis, Quellgrund meines Lebens,
Meer, dem alles zuströmt!Wenn ich in allem, was meine Sinne empfangen,
das ‹Darüber-Hinaus› mit aufnehme,
wird das mir Geschenkte so dicht,
dass nur Dichtung diese Fülle aussprechen kann.
Es wird zu schwer; nur dichterische Sprache
kann so Gewichtiges tragen und vermitteln.
Heute will ich ein Gedicht,
das mich zu vollem Leben und Erleben ermutigt hat,
wiederfinden und mir Zeit nehmen,
es in Ruhe zu lesen.
Ich will mit der Dichterbegabung,
die uns allen ins Herz gelegt ist,
bei allem, was ich erlebe, für Dich,
Du ‹Darüber-Hinaus›,
wach sein. Amen.»[1]
Auch wenn das Wort «Dichtung» von einer anderen sprachlichen Wurzel abstammt als «dicht» im Sinne von «gedrängt» und «fest gefügt», so gibt doch Dichtung der Sprache eine Dichte, die von keiner andren Sprachform erreicht wird. Wir können bei diesem Bild bleiben und sagen, dass die feste Fügung dichterischer Sprache ihr eine sonst nicht erreichbare Tragkraft gibt. Wer Schwerwiegendes aussprechen will, greift zur Dichtung, von verliebten jungen Menschen bis hin zu Staatsoberhäuptern bei feierlichen Anlässen.
Auch wir müssen in diesem Buch immer wieder Dichtung heranziehen, wo wir Wesentliches von solcher Gewichtigkeit vermitteln wollen, dass Prosa unter ihr zusammenbrechen müsste. Nur dem staunenden Herzen zeigt sich das Wesentliche:
«Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.»
Das lernt «der kleine Prinz» vom Fuchs in dem bekannten Buch von Antoine de Saint Exupéry (1900-1944).
Dichtung ist die Sprache des Staunens, die Sprache des Herzens.[2]
«Staunen, Du staunenswürdiges Geheimnis,
ist meine Grundhaltung vor Dir ‒
ein Staunen, das nichts als gegeben hinnimmt
und in allem letztlich Dich betrifft, Dich erkennt.
Alles Gegebene hat ja in Dir seinen geheimnisvollen Grund.
Und das ist auch der Grund meiner Freude.
‹Staunen nur kann ich und staunend mich freu’n›:[3]
über die Bäume, die bläuliche Ferne, die Blumenwiese
und alles, was mich selber betrifft.
Alles ist ja Dein erstaunliches Geschenk.
Lass nicht zu, dass ich dieses Erstauntsein verlerne.
Lass es immer tiefer werden, immer aufmerksamer,
dieses freudige Staunen,
Du meine staunenswerte Freude. Amen.»[4]
Die Freude an Bildern und Namen für Gott kann unser Innenleben ungemein bereichern ‒ die islamische Mystik beweist dies. Aber das Sich-Festklammern an solchen Bildern und Namen bleibt eine ständige Gefahr.
Wie Liebende, die immer neue Namen füreinander erfinden, dürfen wir unsre Gottesbeziehung in zahllosen Gottesnamen feiern, solange wir sie «leicht nehmen».
Aber festes Anklammern an Vorstellungen bedroht unsre persönliche Beziehung zu Gott, die nur gedeihen kann, wenn wir zulassen, dass das Unvorstellbare uns immer wieder neu und anders ergreift. Darüber hinaus führt die zu starke Betonung von Namen und Bildern Gottes schnell zu Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, weil wir zu leicht vergessen, dass sie alle auf ein und dieselbe mächtige vereinigende Lebenskraft hinweisen.
In der christlichen Bibel (Apg 17,28) heißt es, dass wir in Gott «leben und weben und sind» ‒ nicht nur wie Fische im Wasser, sondern wie Tropfen im Meer. Und doch lösen wir uns nicht auf in diesem «Meer» wie in einem unpersönlichen Etwas. Wir sind eins damit und stehen doch gleichzeitig in einer persönlichen Beziehung dazu ‒ als zu dem großen Du unsres kleinen Ich.[5]
Bruder David: «In Gott s i n d wir, weil das Mysterium alles Seiende durchwaltet – uns selbst sowie die Welt um uns und in uns. In Gott w e b e n wir, wie Luther so schön übersetzt, denn mit allem was wir tun, weben wir mit am Teppich des Lebens, in dem alles mit allem verwoben ist – und letztlich mit Gott als seinem innersten Mysterium.
Niemand kann herausfallen aus diesem i n G o t t S e i n . Diese unverlierbare Geborgenheit schenkt mir tiefes Lebensvertrauen. Aber diese Bibelstelle gilt für alle Menschen. Paulus spricht ja hier zu Leuten, die von der christlichen Lehre nie gehört haben. Er sagt:
‹wie auch einige eurer Dichter gesagt haben.›
Er stützt sich nicht auf Philosophen und Theologen, sondern auf Dichter.
Nur Dichter finden Bilder und Worte, die uns gemeinsam ergreifen. Das aber brauchen wir heute dringend:
Gemeinschaftssinn durch Ergriffenheit vom einen Gott,
in dem wir leben und weben und sind.»[6]
«Worte, die aus der Stille kommen, reden ‒
von was immer sie auch sonst noch reden mögen ‒
von Dir, Du großes Geheimnis.
Sie weisen auf Unaussprechliches hin.
Sie offenbaren ein flüchtiges Glänzen von einem Ganzen,
das dunkel im Schweigen ruht.
Mach mich hellhörig für das Unsägliche,
das in allem Ausgesagten mitschwingt ‒
für den unfasslichen Überfluss.Zugleich aber möchte ich auch auf die Fasslichkeit achten,
die Worte uns zeigen, indem sie Fließendes einfassen,
bevor es wieder überfließt.
Dankbar für alles in ihren Schalen erfasste,
will ich Worte achtsam hören und sorgfältig nutzen ‒
achtsam, gewissenhaft und dankbar für diesen Schatz,
unseren Wortschatz.
Danach nimm mich wieder auf in Deiner Stille. Amen.»[7]
Das Wort Orientierung kommt wie «Orient» aus dem Lateinischen, wo «oriens» auf den «Sonnenaufgang», den «Osten» hinweist. Wenn wir wissen, wo die Sonne aufgeht, können wir alle andren Himmelsrichtungen bestimmen und uns auf unser Ziel ausrichten.
Manche Wörter können uns auf ähnliche Weise den Weg weisen. Sie strahlen auf wie Leuchtturmlichter und leiten uns verlässlich durch stürmische See. Solche leuchtenden Wörter können zu Schlüsselwörtern werden, die uns neue Erkenntnisse eröffnen. Wir müssen nur «der Sprache nachdenken» lernen, wie man einem Pfad durch Wiesen nachgeht und sich dabei Blume um Blume an neuen Entdeckungen freut.
«Der Sprache nachdenken» ist ein Ausdruck, den der Philosoph Martin Heidegger (1889-1976) geprägt hat.[8]
Ich habe schon vor langer Zeit die Freude entdeckt, die diesem Nachdenken entspringt. Es lehrt uns, den Einsichten große Aufmerksamkeit zu schenken, die unsre Vorfahren als Spuren ihres Denkens in der Sprache zurückgelassen und uns so vererbt haben. So wie wir versuchten ja auch sie, sich in der Welt und im Leben zurechtzufinden. Auch sie suchten nach verlässlichen Koordinaten für innere Ausrichtung und spirituelle Orientierung.
Deshalb steckt in der Sprache, die sie uns hinterlassen haben, ein Schatz an wegweisender Weisheit. Und weil Dichtung die Sprache um ein Vielfaches verdichtet, enthüllen oft Gedichte diesen Schatz in seiner reinsten und strahlendsten Erscheinungsform.[9]
[Quellenangaben zum obigen Text in Anm. 1f., 4-7, 9]
[Ergänzend:
1. Clown fragt Mönch (2024): Interview von Reinhard Horstkotte mit Bruder David:
«Was haben Mönche und Clowns gemeinsam?»
«Sowohl der Clown wie der Mönch sind Außenseiter der Gesellschaft. Sowohl für den Clown wie für den Mönch ist Achtsamkeit oder spielerische Wachsamkeit im Hier und Jetzt zentral.
Beide folgen einem inneren Ruf und sind bereit, auf ihrem ungewöhnlichen Weg Entbehrungen freudig in Kauf zu nehmen.
Beide spielen gern – der Clown beim Mitspielen in der Show, der Mönch beim heiligen Spiel der Liturgie. Und sie nehmen ihr Spielen so ernst wie wahres Spielen das verdient – nicht todernst, sondern viel ernster: mit dem Ernst des lebendigsten Lebens, das über sich selber lachen kann.»
2. Worum sich letztlich alles dreht (2021): Interview geführt vom Tyrolia-Verlag mit Bruder David:
«Sie benennen in Ihrem Buch Orientierung finden (2021) fast 100 Schlüsselworte für Ihr Leben – gibt es auch ein besonderes Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselbegegnung für Sie?»
«Martin Heidegger hat mir so ein Schlüsselerlebnis geschenkt, für das ich zutiefst dankbar bin. Er spricht davon, dass wir ‹der Sprache nachdenken› können, wie man etwa einem Feldweg nachgeht. Das hat mich zutiefst berührt, als ich es zum ersten Mal las. Es hat mir bewusst gemacht, dass das Denken unsrer Vorfahren unsre Sprache geformt hat und dass wir uns unbewusst in diesen Denkbahnen bewegen – dass wir dies aber auch mit großem Gewinn bewusst tun können.
Heidegger hat mir durch diese Einsicht einen Schlüssel in die Hand gegeben, der mir in unsrer Muttersprache Tür um Tür aufgeschlossen und immer neue Einsichten geschenkt hat. Auch an andren Sprachen durfte ich dies erfahren, besonders im Englischen, wo ich mich ja ebenso zuhause fühle wie im Deutschen. ‹Der Sprache nachdenken› wurde zur Grundhaltung meines Denkens und hat auch mein neues Buch Orientierung finden, entscheidend beeinflusst.»
3. Religionen ‒ drei Ausdrucksformen: Ergänzend: 3.1.: zwei Abschnitte im Buch Orientierung finden (2021), 66f.:
«Erinnern wir uns an einen Augenblick höchster Lebendigkeit. … Nun haben wir aber etwas erlebt, was sich nicht in Begriffe fassen lässt. Wie sollen wir also darüber sprechen? Wie können wir uns selbst klarmachen, was wir erlebt haben, und die Freude daran mit anderen teilen? Dichtung ist der Ausweg, den Menschen in dieser Lage immer wieder finden. Nur Dichtung kann Ahnungen ausdrücken, die nur wie ein Duft an den Worten hängen.»
4. Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), 18f.:
«Die Glaubenssätze sind uns schon von Kindheit an als sehr vertrauenswürdig und fest vorgestellt worden, und jetzt klammern wir uns an sie. Und in dem Augenblick sind wir wieder auf dem Holzweg.
Denn an den Glaubenssätzen ist nichts falsch, die sind schon Ausdruck ‒ wenn man tiefer wird, geduldig nachforscht ‒ sind die immer radikaler Ausdruck aufs Leben.
Aber alles ist falsch mit sich an sie anklammern.
Wir müssen auch die Glaubenssätze im Credo z.B. leicht halten. Fest, aber leicht: So wie man mit einer Feder schreibt: Wenn man sie zu leicht hält, kann man nicht schreiben, aber wenn man sie zu fest hält, kann man auch nicht schreiben. Fest und leicht. So müssen wir die Glaubenssätze halten.»
5. Audio Aufwachsen in Widersprüchen (1989)
Im Paradoxen Sinn erfahren ‒ Vortrag und Dialog:
Teil 1 in folgende Themen zusammengefasst:
(17:09) Die Antwort des Schöpfungsmythos
Der Vortrag in Teil 1 erschien ebenfalls unter dem Titel Im Paradoxen Sinn erfahren im Buch Aufwachsen in Widersprüchen (1990), 59-71; Bruder David in diesem Vortrag S. 62, wie auch in Heldenmythos, Opfer, Dankbarkeit:
«Mythos in diesem Sinn ist keineswegs etwas Unwahres. Oft verwenden wir das Wort falsch und sagen: Das ist ja gar nicht wahr, das ist nur ein Mythos. Wenn es wirklich Mythos ist im vollen Sinn des Wortes, dann ist es nicht nur wahr, sondern überwahr; dann ist es Ausdruck dessen, was sich in logischer Sprache nicht mehr fassen lässt.»
6. Wie Bruder David Dichtung in seinen Vorträgen einbezieht:
6.1. Video Leben in Zeiten der Bedrängnis (2017); siehe auch Transkription:
(00:50) «Nach so ergreifender Musik fühlt man fast, dass man sich entschuldigen muss, die Stille jetzt durch Worte zu unterbrechen. Aber vielleicht gelingt es uns stattdessen, die Stille, die aus der Musik kommt, zu Wort kommen zu lassen. Und das gelingt am ehesten durch Dichtung. Und darum bin ich auch eingeladen worden, ein paar Worte zu sagen zu den vier Zeilen, die im nächsten Stück aus einem Sonett von Rilke vertont werden. Die Zeilen lauten:
‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
dass, überwinternd, Dein Herz überhaupt übersteht.›[10]
Ich glaube, das ist eine der schönsten Strophen, die ich in der deutschen Sprache überhaupt kenne, schon der Musik nach, und ich habe öfters vor einem Publikum, das nicht Deutsch versteht als Beispiel, wie schön die deutsche Sprache sein kann, gerade diese vier Zeilen zitiert. Das ist fast reine Musik. Und ich möchte jetzt diesen Beginn des Gedichtes weiter ausdeuten, wie Rilke das selber tut im Rest seines Sonettes. Und dann werde ich es am Ende noch einmal lesen.»
6.2. Credo ‒ ein Glaube, der alle verbindet (2010): Audio und Mitschrift des Vortrags in Freiburg i. Br. (DE):
(33:11) Ein zweiter Punkt, was wir haben müssen, um diese gläubige Verbundenheit zu finden und zu pflegen, ist
ein Verständnis für Dichtung.
Das wird Sie vielleicht überraschen, aber es ist ungeheuer wichtig, denn die wichtigsten Texte aller religiösen Traditionen sind in dichterischer Sprache ausgedrückt, auch unsere eigenen als Christen. Und wir sind uns oft dessen gar nicht bewusst. Und darum fallen wir oft in die Falle und nehmen sie wörtlich. Das wäre so, wie wenn wir ein ganz tiefes Erlebnis haben, dass sich nur in dichterischer Sprache ausdrücken kann, und es dann wörtlich nehmen. Und wenn wir ganz tiefe ‒ nicht nur religiöse ‒, sondern auch tiefe emotionale Erlebnisse haben, drücken wir sie immer ganz spontan dichterisch aus. Jeder Liebende wird sagen: ‹Ich schenke dir mein Herz›. Das hat nichts mit Herzchirurgie zu tun, und das wissen wir, das ist uns völlig offensichtlich. Aber wenn wir zu religiösen Texten kommen, die so etwas ähnliches sagen, dann nehmen wir sie plötzlich wörtlich.
Es ist uns gar nicht bewusst, zum Beispiel im christlichen Bereich: Ich nehme das nur als ein Beispiel hier, weil ich annehmen kann, dass doch die meisten von uns entweder Christen sind oder vertraut sind mit diesen Texten; und es hat wenig damit zu tun: Die Kritiker der Religionen sind ebenso oft Opfer des Wörtlichnehmens von dichterischen Texten wie die Gläubigen selbst.
Christen ist es sehr selten bewusst, dass Vater ‒ das Wort für Gott als Vater ‒ ein dichterisches Wort ist. Das heißt nicht, dass es weniger wahr ist. Es heißt nur, dass es viel mehr wahr ist als wir es anerkennen können, wenn wir es wörtlich nehmen. Oder, dass der Sohn, unsere Sohnschaft, unsere Gotteskindschaft: dass das dichterische Wörter sind. Ja, dass das Wort Gott selbst, ein ‹Wort› ist, ein mit dichterischen Werten völlig angefülltes Wort, aber ein Wort und nicht jemand. Es ist nicht so etwas wie Tisch oder Hund oder Baum, sondern es ist ein dichterisches Wort, das in eine Richtung weist.»
6.3. Audio 2.1, in Festival «Die Kraft der Visionen» (1991) und Mitschrift:
(00:00) «Wenn man zu einem Vortrag kommt, der den Weg zu ‹Fülle und Nichts› im Titel hat, dann ist es schon klar, dass es hier nicht um eine vorwiegend akademische Abhandlung gehen kann, sondern, dass der Titel selbst schon dichterisch ist. Und für uns ist es nicht so leicht, aus unserem alltäglichen Leben in das Dichterische einzutreten. Manchen fällt es weniger schwer, andern mehr, aber wir alle müssen eine gewisse Bemühung machen, dorthin zu kommen.
Ich würde vorschlagen, dass wir, was ich Ihnen zu sagen habe, mit einem Gedicht verbinden. Und zwar mit einem der Sonette an Orpheus von Rilke, das mir schon lange sehr lieb ist, und das uns wirklich in diese Welt einführt.[11] Und um uns auf das Dichterische einzustimmen, würde ich vorschlagen, dass wir die ersten paar Zeilen dieses Gedichtes anhören, aber noch ohne uns über den Inhalt Gedanken zu machen. Nur reine Musik. Es ist das 13. der Sonette an Orpheus aus dem zweiten Teil: die ersten vier Zeilen gehören zum Schönsten und Musikalischsten in der deutschen Sprache. So könnten wir uns vielleicht zunächst nur die Musik anhören; ich lese sie Ihnen mal vor, aber bitte nur zuhören und nicht … wenn Sie’s können, nicht zu sehr darüber nachdenken. Nur der Klang …
Ich habe das öfters schon Leuten vorgelesen, die gar nicht Deutsch können, und schon der Eingang ist bezaubernd, im wahren Sinn des Wortes bezaubernd, denn wir wollen uns eben bezaubern lassen und durch diesen Zauber hineinführen in eine Welt, in der allein wir eine Sprache sprechen können, die dem gewachsen ist, wovon wir hier sprechen wollen.
Die dichterische Sprache ist tragkräftiger für Wahrheit als irgend eine andere Ausdrucksweise.
Die abstrakte logische Sprache wird zu gebrechlich, lange bevor wir noch das gesagt haben, was wir eigentlich wirklich sagen wollen. Die dichterische Sprache ist tragfähig. Das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung: Wenn wir wirklich von Einsicht und Lebenserfahrung und Liebe überwältigt werden, werden wir plötzlich dichterisch in unserer Ausdrucksweise. Das zeigt uns schon, dass unser gesunder Instinkt uns in diese Richtung weist.
Diese ersten vier Zeilen des Sonettes lauten:
‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
dass, überwinternd, dein Herz überhaupt übersteht.›
Um noch tiefer einzudringen, schlage ich jetzt vor, wir machen es gemeinsam. Ich lese die erste Zeile, Sie sprechen sie nach. Ich lese die zweite Zeile und Sie sprechen sie nach …»
6.4. Retreat-Woche in Assisi (1989); siehe auch Heldenmythos, Opfer, Dankbarkeit: Ergänzend: 4.3.:
Audio: ‹Nur die dichterische Sprache ist tragfähig genug, um so viel Wahrheit zu tragen›: Das Glaubensbekenntnis im Licht der großen Menschheitsmythen]
________________
[1] Du großes Geheimnis: Gebete zum Aufwachen (2019), ‹40 ‒ Dichtung›, 49
[2] DICHTUNG, in: Das ABC der Schlüsselworte, im Buch: Orientierung finden (2021), 132
[3] Johann Philipp Neumann (1774-1849), Liedtext aus dem Gloria in Franz Schuberts ‹Deutscher Messe›
[4] Erwachende Worte (2023): 2 ‒ Staunen, 21
[5] Orientierung finden (2021): Gott ‒ das geheimnisvolle ‹Mehr-und-immer mehr›, 56
[6] Meine BESONDERE Bibelstelle ‒ ‹In ihm leben wir› (2023)
[7] Erwachende Worte (2023): 13 ‒ Worte, 43
[8] Martin Heidegger: ‹Unterwegs zur Sprache›, Stuttgart, Klett-Cotta 2022; siehe auch die Transkription des Vortrags Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog (2014), 5, wie auch die Einleitung in allen drei Vorträgen zum Credo ‒ ein Glaube, der alle verbindet (2010)
[9] Orientierung finden (2021): Der erste Schritt ‒ Orientierung, 15f.
[10] In Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II: 140-148, 150f., den Vorträgen im Haus St. Dorothea in Flüeli-Ranft vom 14.-18. September 2014, bildete dieses Sonett ‒ wie auch das vorhergehende: ‹Wolle die Wandlung› ‒ das Herzstück dieser vier intensiven Tage.
Die Beziehung von Bruder David zu Rilke und besonders zu ‹Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter/dir› (Die Sonette an Orpheus 2. Teil, XIII) ist einzigartig und spürbar in allen seinen Büchern und Vorträgen; siehe den Video Dem Geheimnis auf der Spur (2016) ab (40:06)
Abschied, der Klang des Lebens enthält wegweisende Passagen zu diesem Sonett aus dem Buch Credo (2015) und dem Vortrag Leben in Zeiten der Bedrängnis (2017). In Ergänzend: 2.-4. sind weitere Vorträge zusammengestellt, in denen Bruder David dieses Sonett vorträgt und deutet.
[11] Bruder David spricht vom gleichen Sonett wie in Anm. 10