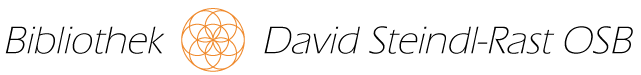Text und Audios von Br. David Steindl-Rast OSB
Wir haben falsche Vorstellungen vom Glauben; wir meinen, Glaube bedeutet: etwas glauben. Ja, Glaube bedeutet tatsächlich: etwas zu glauben. Wenn wir jemandem wirklich vertrauen, wenn wir wirklich an einen Freund glauben, dann bedeutet das auch, dass wir bestimmte Dinge über diesen Freund glauben. Aber das ist allenfalls zweitrangig, und wenn wir daran hängenbleiben, dann werden wir nie die Wurzeln des Glaubens erkennen. Das ist es nicht, was Glaube bedeutet. Glauben heißt nicht, einigen Dogmas oder Glaubensartikeln oder etwas Ähnlichem beizupflichten.
Letztlich ist Glaube mutiges Vertrauen ins Leben,[1]
ein gläubiges Sich-verlassen auf das Leben in uns,
das letztlich Anteilnahme an der göttlichen Lebendigkeit ist.So dem Leben zu vertrauen heißt:
fest damit rechnen,
dass jeder Tag uns genau das bringen wird,
was wir brauchen ‒
wenn es auch nicht immer das ist,
was wir uns wünschen.
Daher werden wir keine Energie an inneren Widerstand verschwenden oder an Wunschträume; dann haben wir mehr Energie verfügbar, um mit der gegebenen Lage umzugehen – genau dort, wo das Schicksal uns hingestellt hat.
Wir verlassen uns eben darauf, dass die Lebensquelle uns schon gibt, was für uns gut ist, ob wir es immer gleich erkennen oder nicht.
Menschen, die so leben, gleichen Schwimmern in einem reißenden Strom. Sie liefern sich der Strömung nicht willenlos aus, aber sie widerstehen ihr auch nicht; sie passen sich vielmehr mit jeder Bewegung dem Trift oder Sog an, und nützen den Lauf des Wassers zielstrebig und geschickt so aus, dass sie sich an dem Abenteuer richtig freuen können.
Was wäre für ein erfülltes, geglücktes Leben wichtiger als solch gläubiges Vertrauen? Je bewusster wir leben, umso klarer erkennen wir, was für ein unfassbares Geschenk es ist, überhaupt lebendig zu sein. Diese Einsicht löst mit jedem Atemzug tiefe Dankbarkeit aus und öffnet dadurch unser Herz für immer größere Lebensfreude.[2]
Die jeweilige Ausprägung, die unser religiöser Glaube annimmt, hängt völlig vom Ort und der Zeit und den gesellschaftlichen und kulturellen Umständen ab, in die wir hineingeboren werden, und davon gibt es eine unendliche Vielfalt. Aber die Essenz unseres Glaubens ist immer und überall dieselbe, nämlich ein mutiges Vertrauen in das Leben.
Glaube gegen Furcht ‒ das ist der Zentralpunkt der Religion. Das ist auch der Schlüssel zu unserem Verhältnis zur Wahrheit. Wir wissen wohl, dass Religion etwas mit Wahrheit zu tun hat, aber es ist keine Wahrheit, die wir an uns raffen und nach Hause tragen könnten. Wenn wir gewisse Wahrheiten an uns reißen und festhalten, dann geraten wir mit all denen in Konflikt, die diese Wahrheiten nicht besitzen. Wenn man es genau betrachtet, besitzt jeder eine andere Wahrheit; es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Wenn wir also darauf bestehen, dass Wahrheit etwas sei, was wir besitzen können, dann befinden wir uns im Widerspruch mit der ganzen Welt.
Aber die wirkliche Wahrheit,
um die es uns geht,
ist etwas, das uns besitzt;
sie besitzt uns,
wenn wir uns hingeben,
in jenen Augenblicken,
in denen wir uns wirklich öffnen.Es gibt nur eine Wahrheit,
und sie nimmt jeden
auf eigene Weise in Besitz.Es muss eine unendliche Vielfalt von Wegen geben,
auf denen die Wahrheit
jeden von uns in Besitz nimmt,
denn in dieser Vielfalt blüht die Einheit der Wahrheit auf.
Und das ist schön, und wir müssen es bejahen, und wir müssen es feiern. Das ist Leben, und das ist auch religiöses Leben. Es bedeutet, sich selbst der Wahrheit hinzugeben, nicht, die Wahrheit zu nehmen, nach ihr zu greifen, sie festzuhalten.
Nur die Wahrheit, der wir uns hingeben, wird uns frei machen.
Die eine Wahrheit, die für jeden von uns gilt, lautet, den Mut aufzubringen, uns der Wahrheit hinzugeben. Furcht klammert sich fest.[3]
Glaube ist Vertrauen und Mut.
Sein Gegenteil ist Furchtsamkeit.
Glaube ist der Mut loszulassen.
Furcht hält fest.[4]
Wenn wir in uns gehen und uns fragen, was uns auf dieser Ebene des An-etwas-Glaubens am schwersten fällt, dann werden wohl viele von uns zugeben müssen: Das Schwierigste ist es, an die Liebe eines anderen Menschen wirklich zu glauben. Ja, es gibt Liebesbeweise und Proben, an denen sich die Liebe eines Anderen zeigt, aber letztlich müssen wir uns doch darauf verlassen.
Es kommt alles auf dieses Sich-verlassen an.
Und damit weist die Sprache schon hin auf den entscheidenden Punkt:
Was wir verlassen müssen, ist unser kleines Ich, das sich in die Illusion des Abgetrenntseins verkapselt; und wir verlassen uns a u f
etwas ‒ bewegen uns a u f etwas anderes hin ‒, nämlich auf unser großes Selbst, in dem Du und Ich eins sind, obwohl sie unterschieden bleiben.[5]
«Ich bin durch dich so ich» (E. E. Cummings.)
Nur einem Du gegenüber hat es überhaupt Sinn, Ich zu sagen. Dass ein Du mir vertraut, macht mein Selbstvertrauen erst möglich. Die Begegnung von Ich und Du ist der Quellgrund, aus dem gläubiges Vertrauen entspringt.
Ich werde ich, indem ich dir vertraue.
Das Ich,
das diesem Vertrauen entstammt,
glaubt eben;
es ist unser wahres Selbst,
das Ich, das im Credo sagt:
Ich glaube.
Und du, Leserin oder Leser? Wann und wie bist du diesem Paradoxon begegnet? Krame nicht in deinen Erinnerungen nach äußerlich auffallenden Erlebnissen. Unter denen wirst du kaum finden, worum es hier geht. Vielleicht hat auch dich ein spielerischer Augenblick in deiner Kindheit jenen tiefen Glauben erleben lassen, den man nie vergisst, oft vernachlässigt, aber doch jederzeit neu erwecken kann.[6]
Vielleicht erinnerst du dich an einen Augenblick, in dem du das Gefühl hattest, wirklich du selber zu sein, gerade deshalb, weil du irgendwie über Dich hinausgehoben wurdest ‒ von Musik, vom hochgewölbten Himmel einer sternklaren Nacht, vom Anblick eines schlafenden Kindes, das an seinem Daumen saugt.
Plötzlich verblassen, verschwimmen, verschwinden die scharfen Grenzen zwischen dir und der Welt rundum, ja zwischen dir und dem Urgrund, aus dem alles aufsteigt und in den alles zurückfließt.
In solchen Augenblicken verkosten wir flüchtig, was Mystiker die Erfahrung des All-eins-seins nannten.
Es scheint fast unmöglich, solches auch nur einmal zu erleben, ohne fürs Leben dadurch bestimmt zu sein; unser innigstes Verlangen weist ja in dieser Richtung. Doch Gipfelerlebnisse gehen vorüber und verblassen in der Erinnerung; das lässt sich nicht aufhalten.
Wir haben dann aber die Wahl: Wir können das Erfahrene vergessen oder wir können danach handeln und das heißt, gläubig leben.
Je mehr unsere Haltung im täglichen Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen unserem Bewusstsein innerster Verbundenheit mit dem Urgrund allen Seins entspricht, umso höher entwickelt sich unsere Gottverbundenheit und umso klarer finden wir Sinn im Leben.
Solcher Glaube verlangt, wie die Pflege jeder persönlichen Beziehung wache Kreativität. Ohne sie sinkt unsere Gottesbeziehung zu einer Art Halbschlaf ab. Unsere existentielle Bezogenheit auf Gott kann sogar als eine lästige Abhängigkeit missverstanden werden, von der wir uns dann zu «befreien» suchen.
Im innersten Herzen vertrauend anzuerkennen
«ich bin Dein, Du bist mein»,
das ist der Glaube, der uns frei und lebendig macht.[7]
Mit anderen g e m e i n s a m diesen tiefsten, alle Menschen verbindenden Glauben zu bekennen, stärkt das Bewusstsein weltweiter Gemeinschaft.
Die Erfahrung unserer Zugehörigkeit zum gemeinsamen Seinsgrund (den freilich nicht alle Gott zu nennen brauchen) haben wir mit allen Menschen gemein. Sie ist auch die Grundlage für unsere gegenseitige Zusammengehörigkeit.
Nichts dürfte heute notwendiger sein als dieses weltweite Gemeinschaftsbewusstsein aller Menschen zu fördern, das sich dann auf Tiere, Pflanzen und selbst auf die unbelebte Natur ausweitet.
Es gibt viele Glaubensüberzeugungen, aber nur einen Glauben.
Wir müssen lernen, unsere Überzeugungen weniger wichtig zu nehmen als die Urgebärde gläubigen Vertrauens.
Glaubensüberzeugungen haben die Kraft,
uns zu entzweien,
Glaube aber hat die noch größere Kraft,
uns zu einen.[8]
[Die Quellenangaben zum obigen Text in Anm. 1-8]
[Ergänzend:
1. Audios
1.1. Anlässlich der Präsentation seines neuen Buches Credo: Ein Glaube, der alle verbindet in Freiburg, München und Wien hielt Bruder David die Vorträge in den Audios Credo ‒ Ein Glaube, der alle verbindet (2010); siehe auch die Mitschrift des Vortrags in Freiburg und die Mitschrift des Vortrags in Wien.
Bruder David im Vortrag in Wien am 27. Oktober 2010:
(11:31) «Credo: Das lateinische Wort kommt von zwei Wurzeln her; das eine ist Cor ‒ das Herz ‒, und das andere do, dare ‒ ‹ich gebe› ‒ ‹ich schenke mein Herz.› Wer also Credo sagt, der sagt nicht: ‹Ich glaube an etwas, was man glauben kann oder nicht glauben kann.›
Es heißt: ‹Ich drücke mein tiefstes Vertrauen aus. Ich setzte mein Herz auf das, was ich jetzt da aussprechen werde. Ich verlasse mich vollkommen darauf. Ich verlasse mich.›
Worauf kann ich mich denn wirklich letztlich verlassen? Das ist die Grundfrage, wenn es um den Glauben geht.»
(47:27) «Für uns ‒ ich nenne die drei Traditionen [Judentum, Christentum und den Islam] gerne die Amen-Traditionen, denn sie haben das Wort Amen gemeinsam, und das ist ja kein Zufall, denn Amen ist die Antwort auf die Amunah Gottes, und die Amunah ist die Verlässlichkeit Gottes. Wir verlassen uns auf die Verlässlichkeit Gottes:
In diesem einen Wort A m e n liegt schon der ganze Glaube drinnen:
Ich verlasse mich auf die Verlässlichkeit Gottes.»
1.2. Die Weisheit, die alle verbindet ‒ Wie die Religionen zusammenfinden können (Mitschrift) (2010), 9:
(43:06) «Die Glaubenssätze sind Sätze, in denen sich der Glaube ausdrückt, im Laufe der Tradition, zu verschiedenen Zeiten, ganz verschieden; die vertragen sich nicht miteinander, da sie sich ganz verschieden voneinander verhalten.
Wir können aber durch diese Glaubenssätze, weil sie eben Ausdrücke des Urglaubens sind, zu diesem Urglauben durchstoßen.
Und dieser Urglaube ist das Vertrauen auf das Leben.
Das ist uns eingegeben. Das haben wir als Menschen.
Wir vertrauen dem Leben. Ob wir jetzt Buddhisten, Christen, Hindus, Atheisten, Agnostiker sind, alle ‒ jeder Mensch ‒ hat dieses tiefe Vertrauen auf das Leben, als Mitgift.
Und dieses Lebensvertrauen, das ist der Urglaube.
Manchmal wird dieser sehr schwach, wenn wir enttäuscht sind, wenn unser Vertrauen enttäuscht wird, im Laufe des Lebens. Das kann große Schmerzen und Verhärtungen geben.
Aber tief im Innersten haben wir alle diesen Glauben. Und dieser Glaube hat Kraft und Wärme genug, um das Eis der ‹–ismen› (Dogmatismus, Ritualismus, Moralismus) zu schmelzen.»
1.3. Fragen, denen wir uns stellen müssen (2016)
Tag 2 ‒ Nachmittag: Im Selbst sein und im Jetzt sein ist identisch:
(27:54) Sich auf das große Geheimnis verlassen, heißt glauben
1.4. Im Eröffnungsvortrag ‹Stärke unsern Glauben› (Lk 17,5) in der Retreat-Woche in Assisi (1989) weist Bruder David hin, wie glauben innigst verbunden ist mit loben, geloben, bezeugen, tragen und getragen werden ‒ die Wahr-Empfangende Seite des Glaubens. Wir müssen diese Seite des Glaubens wieder entdecken und leben. Sie ist uns verloren gegangen durch die Überbetonung der Seite, die begreifen, wahr-nehmen, besprechen, versprechen, wahr-halten will.
2. Weitere Texte
2.1. Vertrauen; Lebensvertrauen; Lebensvertrauen und Dankbarkeit; Gottvertrauen im Leiden und Sterben; Gottvertrauen in Entbehrung und Unglück; Seien wir offen für das Unvorstellbare: Lebens- und Gottvertrauen als Quelle wahrer Hoffnung (2024); siehe auch Hoffnungsfroh leben
2.2. Bruder David im Gespräch mit Anselm Grün zu Glaubensfragen im Buch Das glauben wir (2015): ‹Spiritualität für unsere Zeit›; siehe auch das Gespräch von Johannes Kaup, der das Buch herausgegeben hat, mit Bruder David in den Audios Das glauben wir ‒ Spiritualität für unsere Zeit (2015)
2.3. Im Buch Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 82f., 88, [bzw. Fülle und Nichts (2015), 81, 86f.], im Kapitel «Glaube: Vertrauen auf den Geber»:
«Es mag überraschend sein, aber gerade diese Bedeutung von Glaube wird von der authentischen christlichen Tradition bezeugt.
In den Evangelien, so sagen uns die Sprachgelehrten, gibt es keine einzige Stelle, in der das griechische Wort für ‹Glaube› Überzeugungen bedeutet. Wenn Jesus beispielsweise den ‹Glauben› des römischen Beamten bewundert, dann heißt das, dass er beeindruckt ist von dem tiefen Vertrauen des Mannes, und nicht etwa von dessen religiösen Überzeugungen. Und als Jesus die Jünger für ihren ‹Mangel an Glauben› tadelt, da meint er ihren Mangel an mutigem Vertrauen; es war keine Rüge für den Abfall von einem oder dem anderen Glaubenssatz.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: ein Glaubensbekenntnis existierte noch gar nicht. Glaube bedeutete das mutige Vertrauen auf Jesus und die frohe Botschaft, die er lebte und predigte. Später zwar sollte sich dieses Vertrauen zu expliziten Glaubenssätzen kristallisieren. Der Ausgangspunkt aber ist vertrauender Mut, nicht ein für wahr halten, sondern Glaube schlechthin.
Ausgangspunkte sind in der Bibel von allergrößter Bedeutung. Der erste Vers, das erste Bild, der Anfang einer Geschichte drücken oft in Kurzform das Wesentliche der ganzen Geschichte aus. Diese Tatsache sollten wir beim Bibellesen nicht vergessen. Was ist beispielsweise der eigentliche Anfang der Geschichte unseres Glaubens, wie die Bibel sie erzählt? Es beginnt mit Abraham, den wir ‹unseren Vater im Glauben› nennen. Wenn Glaube zuallererst darin bestünde an i r g e n d e t w a s zu glauben, dann hätte Gott sicherlich damit begonnen, Abraham eine Reihe von Glaubenssätzen zu vermitteln. Glauben heißt aber in erster Linie, an j e m a n d e n
zu glauben. Gott gibt zwar Abraham Versprechungen, an die er glauben soll, aber zuerst fordert Gott sein Vertrauen heraus. Glaube ist am Anfang praktisch ohne jeden Inhalt. Es ist reines Vertrauen.» (82f., bzw. 81)
«Jener ursprüngliche Herzensmut, den wir aus Momenten aufrichtiger Dankbarkeit kennen, kommt vollendetem Glauben im biblischen Sinne näher, als wir erhofft hätten. Es ist jedoch eine Sache, jenen Glauben in einem enthusiastischen Augenblick zu erleben, eine ganz andere aber, unseren Mut im Wellengang des täglichen Lebens ‹seetüchtig› zu erhalten. Dies ist der Punkt, an dem unsere Glaubensüberzeugungen ins Spiel kommen. Sie sollen helfen, unseren Glauben über Wasser zu halten, sollen unseren Mut erneuern. Bedauerlicherweise erfüllen unsere Überzeugungen diese Funktion häufig nicht. Anstatt unseren Glauben wieder aufzurichten, ziehen sie ihn oft in die Tiefe.» (88, bzw. 86f.)]
____________________
[1] Der Mönch in uns, Beitrag von Bruder David im Buch Antwort der Erde (1978), 35. Das Zitat: «Glauben heißt nicht, einigen Dogmas oder Glaubensartikeln oder etwas Ähnlichem beizupflichten. Letztlich ist Glaube mutiges Vertrauen ins Leben.» ‒ in der Übersetzung von Eve Landis ‒ ist dem Buch entnommen: Einfach leben ‒ dankbar leben (2014): ‹365 Inspirationen›, hrsg. von Rudolf Walter, 90 (= 8. Juni).
[2] Credo: Ein Glaube, der alle verbindet (2015): «Ich glaube an den Heiligen Geist», 184; siehe auch in Einfach leben ‒ dankbar leben (2014), 95 (= 20. Juni): «Was wäre für ein erfülltes, geglücktes Leben wichtiger als gläubiges Vertrauen? …»
[3] Der Mönch in uns (1978), 35f., Forts. des Textes in Anm. 1
[4] Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 88, [bzw. Fülle und Nichts (2015), 87]; siehe auch Einfach leben ‒ dankbar leben (1978):
«Glauben ist der Mut loszulassen. Furcht hält fest.» (92, = 14. Juni)
«Glaube ist Loslassen. Sogar in religiösen Traditionen, welche den Ausdruck Glauben vielleicht nicht benützen, finden wir diese Grundlage, nämlich: das Loslassen.» (88, = 3. Juni, Quelle: Der Mönch in uns (1978), übersetzt von Eve Landis)
[5] Credo: Ein Glaube, der alle verbindet (2015): «Ich glaube», 22f.
[7] Ebd. «Ich glaube an Gott», 28f.
[8] Ebd. 30f.; siehe auch Einfach leben ‒ dankbar leben (2014): ‹365 Inspirationen›, 94 (= 19. Juni): «Es gibt viele Glaubensüberzeugungen, aber nur einen Glauben. …»