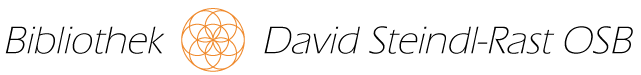Text und Audios von Br. David Steindl-Rast OSB
«Geheimnis, auch ‹großes Geheimnis› bezeichnet die letzte Wirklichkeit ‒ die Kraft, die in allem wirkt. Wir können diese Kraft nicht begrifflich erfassen, wohl aber erleben, wenn wir sie auf uns einwirken lassen.
Anders ausgedrückt: Wir können das Geheimnis nicht begreifen, aber verstehen.
Wir Menschen erfahren die Wirkkraft des Geheimnisses zunächst als Leben. Auch das Leben können wir nicht durch Begriffe in den Griff bekommen, wir können es aber verstehen lernen – einfach dadurch, dass wir leben.
Für das Geheimnis sowie für das Leben gilt auch dies: Das Leben ist in uns und wir sind im Leben, trotzdem aber sagen wir auch, dass das Leben uns entgegenkommt und uns gegenübersteht.
Wir sind ganz im Geheimnis und das Geheimnis ist in uns, trotzdem stehen wir mit dem Geheimnis in Beziehung. Hierher gehört auch das Wort Gott, das auf unsre persönliche Beziehung zum Geheimnis hinweist.» (138f.)
«Stille hängt nicht davon ab, ob die Umgebung ruhig oder lärmerfüllt ist. Das wird verständlicher, wenn wir die Vorstellung von Lärm und Ruhe durch den Gegensatz Tumult und Gelassenheit ersetzen.
Stille ist eine heiter gelöste, gelassene Haltung des Herzens.
Innere Stille, und um die geht es hier, kann sich auf zweifache Weise bekunden: durch Schweigen und Wort ‒ durch ein Wort, das nicht das Schweigen bricht, sondern ein Wort, in welchem das Schweigen zu Wort kommt.
In unserem ganzen Alltag sollte unser Schweigen sowie alles, was wir sagen, aus der Stille kommen.
Dies lässt sich üben und Menschen, denen es im täglichen Leben gelingt, strahlen Frieden aus.
Bisher haben wir von Wort und Schweigen gesprochen, die aus unserer eigenen Stille aufsteigen. Aber auch unsre Antwort auf ein Wort, das wir hören, wird nur dann durch gehorsames Tun zum Verstehen führen, wenn sie aus der Stille kommt.» (157f.)
«Ruhe wollen wir von Stille unterscheiden. Es gibt ja auch ruhelose Stille. Andererseits gibt es auch Ruhe die Stille nicht unbedingt voraussetzt. Diese innere Ruhe, auch inmitten eines bewegten und geräuschvollen Alltags beizubehalten, ist ein herausforderndes Ziel, das wir aber anstreben müssen.
Ruhe in diesem Sinne ist nicht eine Art Grabesruhe, sondern ganz im Gegenteil Ausdruck höchst dynamischer Lebendigkeit.
Sie entspringt dem Bewusstsein, jeden Augenblick dem Großen Geheimnis gegenüberzustehen, ja mehr: ihm mit jedem Atemzug zu begegnen.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153), der das Große Geheimnis Gott nennt, sagt über diese Begegnung:
Der ruhige Gott beruhigt alles
und wer sich in die Ruhe Gottes versenkt,
ruht.» (154)
«Schweigen ist eine der beiden Weisen, auf welche Stille sich bekundet.
Die zweite Weise ist das Wort. Im Wort äußert sich die Stille ‒ sie drückt sich aus, geht aus sich heraus, indem sie ‹zu Wort kommt›.
Im Schweigen bleibt die Stille bei sich selbst.
Ein Bild kann das veranschaulichen.
Ein Gong, den wir betrachten, bleibt bei sich; ein Gong, den wir anschlagen, ‹äußert sich› ‒ sein innerstes Wesen wird äußerlich offenbar.
Um Stille in ihrem Wesen zu erfahren, müssen wir mit ihr einswerden, dadurch, dass wir uns ins Schweigen versenken, uns ins Schweigen hinablassen.
Schweigen kann zu einem wirkungsvollen Mittel werden, um im Tumult des Alltags immer wieder stille Gelassenheit zu finden, indem wir Schweigepausen in unsren Tagesablauf einbauen.» (155)
«Wort als spirituelles Phänomen hat zugleich zwei verschiedene, einander entgegengesetzte Funktionen:
Es definiert einen Begriff und es offenbart eine unbegreifliche Wirklichkeit, die über Begriffe hinausgeht.
Dahinter stehen zwei gegensätzliche Bewegungen. Im Dienste der Wissenschaft fängt das Wort Begriffe ein, im Spiel der Dichtung aber setzt es Sinn frei.
In beiden Bereichen ‒ Verstand und Weisheit ‒ können wir unsre Empfänglichkeit üben. Dann erst werden wir die Macht des Wortes voll zu würdigen wissen.
Die Macht des Wortes zeigt sich aber auch auf einer andren Weise ganz handgreiflich und oft schmerzlich: Worte lassen sich nicht zurückrufen und was sie in Bewegung setzen, lässt sich nicht leicht rückgängig machen.
Darum ist es eine wichtige Aufgabe, schweigen zu lernen, bis für das rechte Wort der rechte Augenblick gekommen ist.» (164)
«Verstehen wird oft irrtümlich gleichbedeutend mit dem Wort ‹begreifen› verwendet.
Diese beiden Formen intellektuellen Erfassens ergänzen einander, entspringen aber zwei unterschiedlichen Haltungen.
Beim Begreifen greifen wir willkürlich und einseitig nach dem zu Erfassenden, beim Verstehen gehen wir aber darüber hinaus und lassen uns selber unwillkürlich ergreifen ‒ in jener gegenseitigen Umarmung, die wir Ergriffenheit nennen.
Beim Begreifen bekommen wir immer nur einen Teil dessen in den Griff, was wir erfassen wollen.
Was uns aber in Ergriffenheit ergreift, ist das Ganze ‒ letztlich das große Geheimnis.» (162)
«Ergriffenheit ist zunächst ein Zustand, den wir fühlen.
Das schließt aber nicht aus, dass sie auch eine höchst wichtige intellektuelle Komponente hat.
Begreifen und ergriffen werden sind einander entgegengesetzte Bewegungen.
Wie Begriffe zum Begreifen führen, so führt Ergriffenheit zum Verstehen.
‹Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise›, schreibt Bernhard von Clairvaux (1090-1153) in seinem Kommentar zum Hohen Lied.
Ergriffenheit geht über das Begreifliche hinaus, indem sie auch das Unbegreifliche versteht.
Darin besteht Weisheit.
Ergriffenheit und Begreifen dürfen keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden.
Sie ergänzen einander, so wie Emotionen und Intellekt nur gemeinsam unsrer Welterfahrung gerecht werden.
Wo eine anti-intellektuelle Atmosphäre vorherrscht, besteht immer die Gefahr, klares Denken durch sentimentale Schwärmerei ersetzen zu wollen.
Ergriffenheit aber ist, auch wenn sie bis zum Gefühlssturm ansteigen kann, klar und nüchtern.» (135)
[Schlüsselbegriffe Geheimnis, Stille, Ruhe, Schweigen, Wort, Verstehen, Ergriffenheit im Buch Das ABC der Schlüsselworte, im Buch Orientierung finden (2021), 135-158]
[Ergänzend:
1. Die interreligiöse Spannweite von Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen
1.1. Audio-Vortrag Interreligiöser Dialog (2014):
(19:57) Wir sind auf Gemeinschaft angewiesen: Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen durch Tun in den verschiedenen Religionen: Der Buddhismus und das Schweigen: Die Blumenpredigt des Buddha / (23:50) Die Wort- oder Amen-Traditionen Judentum, Christentum und der Glaube: Das Vertrauen auf die ‹amunah›, die Verlässlichkeit Gottes: ‹Im Herzen aller Dinge ist Verlässlichkeit› (Reinhold Niebuhr) ‒ Das Wort aus dem Schweigen oder das Gespräch im Unterschied zum Wortwechsel / (26:08) Der Hinduismus und das Verstehen durch Tun: ‹Yoga ist Verstehen› (Swami Venkatesananda) / (27:13) Der Rund- oder Reigentanz der Trinität ‒ Religion von ‹religare›: Wieder verbinden, was zerrissen und abgebrochen ist / (29:24) Die Methode: Stop ‒ Look ‒ Go, Innehalten ‒ Innewerden ‒ Tun: Unsere täglichen buddhistischen Augenblicke, unsere ‹amunah›-Spiritualität und unser Yoga
1.2. Audio-Vortrag Das Gottesbild der modernen Menschen (2009)
Teil 2;
(33:10) Die drei Bereiche der Sinnsuche, die drei Ausformungen der Religionen und die drei Gebetsformen eröffnen ein nachvollziehbares Verständnis des dreifaltigen Gottes in der Praxis dankbaren Lebens im Unterschied zum Pantheismus;
dieser Vortrag in der Basilika Graz-Mariatrost folgt weitgehend dem früheren Vortrag in Wien: An welchen Gott können wir noch glauben? (2008), siehe oben unter 3.2.; siehe auch Religionen ‒ drei Innenwelten: Ergänzend: 1.2.
2. Die Erfahrung der Dreieinheit von Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen
Bruder David bietet in seinem Vortrag anlässlich der Salzburger Hochschulwochen 1972 Jesus als Wort Gottes, abgedruckt im Buch Die Frage nach Jesus (1973), 9-67, eine Gesamtschau auf die Bibel, die christliche Lehre mit Blick auf die primitiven Religionen, den Buddhismus und Hinduismus, aus der Erfahrung unseres eigenen Strebens nach Sinn.
In diesem Vortrag ist die dynamische Dreiheit von Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen nicht nur ein Schlüssel zur Deutung unseres Sinnstrebens, sondern Erfahrung des großen Geheimnisses selbst, das sich in den Hochreligionen mit verschiedenen Schwerpunkten manifestiert und uns erlaubt, unser Leben als Teilnahme am dreifaltigen Leben Gottes selbst zu verstehen in drei Formen der Begegnung mit dem großen Geheimnis im Gebet.
Deshalb enden auch die wegweisenden Vorträge von Bruder David zum Thema Glaube, der alle verbindet, mit dem Sinnbild des Reigentanzes der Dreifaltigkeit, der sich manifestiert im Reigentanz der religiösen Traditionen, eingebettet im kosmischen Tanz des ganzen Universums:
«Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dieser Reigentanz geht hier vor, und Sie stehen außerhalb dieses Reigentanzes wie die Religionswissenschaftler, und wollen das also von a u ß e n betrachten, dann sehen Sie immer, dass die Ihnen am nächsten in einer Richtung gehen, und die Ihnen am fernsten in genau der entgegengesetzten Richtung gehen. Und wo immer Sie außerhalb des Kreises stehen, ist genau das richtige Bild, lässt sich nicht bestreiten:
Die einen gehen in einer Richtung, die andern, die entfernteren, gehen in der entgegengesetzten Richtung. Im Augenblick, wo Sie nicht mehr das von außen sehen wollen, sondern die Hände halten und s e l b e r in den Kreis eintreten ‒ und dazu sind wir aufgefordert durch unsere Gläubigkeit ‒, auf einmal sehen wir, dass alle in einer Richtung gehen.»[1]
Wenn wir uns auf die Interdimensionalität[2] dieser drei Schlüsselworte einlassen, dann fassen wir Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen als Komponenten, Innenwelten, Dimensionen dieser Ganzheit auf, die einander bedingen, freilich mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, Betonungen oder Schwerpunkten. Und wir können so die Unterschiede ‒ zum Beispiel der religiösen Traditionen ‒ nicht nur nachvollziehen, sondern zustimmen, «dass die einander brauchen»[3]
Die Dreieinheit von Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen erschließt folgende Themenbereiche:
1) Das menschliche Sinnstreben ‒ 2) Drei Grundfragen ‒ 3) Mystische Erfahrung und Wendezeit ‒ 4) Gebet ‒
5) Kreislauf der Dankbarkeit ‒ 6) Ur- und Hochreligionen ‒ 7) Dreifaltigkeit ‒ das Zentralgeheimnis im Christentum
1) Im Buch Orientierung finden (2021), 45:
«Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen durch Tun sind grundlegende Schlüsselwörter, die wir unbedingt brauchen, um Sinn zu finden.»
Siehe auch Sinn ‒ dreifaltiges Mysterium: Haupttext und Ergänzend: 2.1.
2) Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen in der Begegnung mit dem Geheimnis mit drei Grundfragen: Warum? Was? Wie?
Wegleitend dafür ist das Buch Orientierung finden (2021): ‹Geheimnis ‒ wenn uns die Wirklichkeit ergreift›, 42-49; siehe auch Geheimnis: Haupttext und in Ergänzend: Film, Audios und 3.1.:
«Es gibt drei existenzielle Fragen, um die wir Menschen nicht herumkommen. Früher oder später müssen wir uns ihnen stellen: Warum? Was? und Wie?» (43)
«Alle drei werden uns also, wenn wir beharrlich genug fragen, ins Geheimnis hineinführen, aber auf drei verschiedenen Wegen. Das Warum fragt nach den Wurzeln, dem Ursprung von allem und führt uns so hinunter in den unaussprechlichen Abgrund des Seins ‒ ins Geheimnis als Schweigen.
Das Was fragt nach dem innersten Wesen der Dinge und hört es am Ende heraus aus der geheimnisvollen Art und Weise, in der jedes Ding seine Einmaligkeit ausspricht, indem es ‹selbstet›[4]‒ Geheimnis als Wort.
Das Wie fragt nach dem dynamischen Aspekt, nach der Kraft, die das Leben antreibt. Aber diese Kraft lässt sich von außen nur beobachten. Verstehen können wir sie nur, indem wir sie in uns selbst erfahren, indem wir ‹das Leben leben› ‒ Geheimnis als Verstehen durch Tun.
Diese drei Zugangswege zum Geheimnis werden aufmerksame LeserInnen in diesem Buch in immer neuen Abwandlungen wiederfinden.» (45)
Diese drei Grundfragen sind auch Ausgangspunkt der Vorträge im Flüeli-Retreat Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), siehe Titelblatt: Schweigen (Montagmorgen), Wort (Montagnachmittag), Verstehen durch Tun (Dienstagmorgen)
Siehe auch das Felsentor-Retreat mit Vanja Palmers (2016) in Fragen, denen wir uns stellen müssen
3) Mystische Erfahrung und Wendezeit:
Audio-Vortrag Gottesbild und Glaubenszweifel (2003):
(36:45) Jeder Mensch erlebt in seiner mystischen Erfahrung Gott als das Schweigen, als das Wort und als das Verstehen
Vortrag An welchen Gott können wir noch glauben? (2008):
«Worum handelt es sich bei diesem Bewusstseinswandel? Es handelt sich um einen Übergang von einem analytischen zu einem integrierenden Bewusstsein, von einem anthropozentrischen zu einem kosmozentrischen Bewusstsein, von einem Bewusstsein, das aufspaltet und trennt, zu einem Bewusstsein, das sich völlig eingebunden weiß und Trennungen leicht nimmt, eigentlich ein ganzheitliches Weltverständnis. Und ganz entscheidend für diesen Übergang, für dieses neue Bewusstsein, ist auch, dass es große Betonung legt auf die Erfahrung, auf die persönliche Erfahrung.»
Audio-Vortrag Kirche und Spiritualität heute (1994):
(09:12) Spiritualität beginnt in der mystischen Erfahrung
(40:30) Wir stehen in der Wendezeit
(54:49) Der Vortrag schließt mit dem Hinweis auf
4) Drei Innenwelten des Gebetes:
Gebet ‒ drei Innenwelten: Haupttext und Ergänzend: 3.4.
Video Wort & Schweigen ‒ Über den Sinn des Gebets (1992), sowie die Transkription von Werner Binder † in Wort und Schweigen ‒ über den Sinn des Gebets (1992):
«Die drei Bereiche: Wort, Schweigen und Verstehen machen die Welten des Gebetes aus. Und das hängt zusammen mit dem, was Christen die Dreieinigkeit Gottes nennen.»
Weitere Links: die Übersicht in Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil I (2014), S. 80 und die Texte:
- ‹Schweigen›: Stille leben, Verstehen im Raum der Stille; Schweigen und Wort
- ‹Wort›: Vom Worte Gottes leben (2021)
- ‹Verstehen›: Kontemplation im Handeln (‹meditatio i n actione›; Verstehen durch Tun
5) Kreis- und Spiralbewegung der Dankbarkeit in «Leben aus der Stille», das vorletzte Kapitel in Die Achtsamkeit des Herzens (2021), 152-159, siehe den Text in Stille leben und den Auszug davon in Verstehen im Raum der Stille:
«Der Kreislauf in dem alles Gegebene als Dank zum Ursprung zurückkehrt ‒ der Kreislauf, in dem das Schweigen Wort wird und im Verstehen zurückkehrt ins Schweigen ‒ findet ein dichterisches Bild in den Marmorschalen von Conrad Ferdinand Meyers römischem Brunnen:
… und jede nimmt und gibt zugleich
und strömt und ruht.»
Der Beitrag «Leben in Stille» erschien zuerst unter dem Titel Lebenskunst ‒ Leben aus der Stille im Buch der Ruhe und der Stille (2005), 7-8, 179-184; Auszüge davon in Alles in uns schweige (2013) und Finde die Stille (2010)
6) Sinnsuche in den Ur- und Hochreligionen; siehe Religionen ‒ drei Innenwelten: Haupttext und in Ergänzend: 2.4.: Jesus als Wort Gottes (1972), 16f.:
«Wir werden uns also bemühen müssen um ein tieferes Verständnis des menschlichen Sinnstrebens in dem dreifachen Zusammenhang von Wort, Schweigen und [Verstehen in] Ergriffenheit [im Unterschied zum Begreifen].
Wir werden dadurch sehen, wie alles das hinzielt auf das innerste Geheimnis des Christentums, nämlich das Geheimnis der Trinität. Und erst von dort, von unserem eigensten Zentralgeheimnis aus können wir hoffen, irgendwie zu verstehen, dass andere Traditionen der Menschheitsgeschichte ebenso sehr im Schweigen das Zentrum ihrer Sinnsuche finden oder in der Ergriffenheit, wie wir es im Wort finden.»
7) Dreifaltigkeit ‒ das Zentralgeheimnis im Christentum:
Immer wieder macht uns Bruder David bewusst, dass die Dreieinheit von Schweigen ‒ Wort ‒ Verstehen nicht nur vom Geheimnis der Dreifaltigkeit inspiriert ist, sondern diese drei Schlüsselworte in diesem Geheimnis verankert sind und eine nachvollziehbare Deutung dieses Geheimnisses ermöglichen.[5]
Im Buch Das glauben wir (2015): ‹Spiritualität für unsere Zeit›: Bruder David im Gespräch mit Pater Anselm Grün: ‹Drei und einer? ‒ oder: ‹Eine kleine Gebrauchsanweisung für die Trinität›, 88f.:
Bruder David: «Bei Augustinus findet man den schönen Vergleich von Vater, Logos und Heiligem Geist mit Schweigen, Wort und Verstehen. Aus dem Schweigen kommt das Wort. Alles, was es gibt, ist Wort und geht durch das Verstehen wieder in das Schweigen zurück. Verstehen ist der Prozess, in dem wir auf ein Wort so hinhorchen, dass es uns ergreift und dorthin führt, wo es herkommt.»
Pater Anselm Grün: «Das Verstehen ist der Heilige Geist. Das Wort ist der Sohn. Und der Ursprung des Wortes, der Vater spricht aus dem Schweigen. Das sind Bilder, die das Geheimnis erahnen lassen. Dogmatik legt nicht fest. Sie weiß nicht alles ganz genau. Durch ihre paradoxe Sprache bringt sie etwas zum Klingen, das wir nur erahnen können.»
Bruder David: «Darum sprechen auch die Kappadokischen Väter[6] vom Reigentanz der Trinität. Der Anführer des Reigens ist der Logos, der aus dem Schweigen hervorkommt. Das Tanzen ist der Heilige Geist. Im Heiligen Geist tanzen wir zurück zum Ursprung, dem Vater. Ich finde dieses Bild begeisternd schön.»
In Jesus als Wort Gottes (1972), 65 und 66f.; siehe auch Dreifaltigkeit: Ergänzend: 2.10. und Tanz ‒ der Sinn des Ganzen: Ergänzend: 3.5.:
«Unser Glaube sieht all dies im Lichte der Dreifaltigkeit. Für uns Christen sind die Wege des Menschen auf der Suche nach dem tiefsten Sinn nur im Lichte des trinitarischen Geheimnisses verständlich.» (65)
«Das ist es, was die griechischen Kirchenväter den großen Reigentanz der Dreifaltigkeit nannten.» (66)
Der Vortrag schließt S. 66f. mit dem Reigentanz der Dreifaltigkeit, wie auch die Vorträge von Bruder David Credo ‒ Ein Glaube, der alle verbindet in Freiburg i. Br., München und Wien anlässlich der Vorstellung seines Buches Credo: Ein Glaube, der alle verbindet, und die beiden früheren Vorträge, ebenfalls in Salzburg: Die Weisheit, die alle verbindet ‒ Wie die Religionen zueinander finden können (2010) und Begegnung der Religionen (1993).
3. Zwei Schlüsselerlebnisse von Bruder David
3.1. Bruder David im buddhistischen Bergkloster Tassajara:
Im Kapitel 5 ‹Interreligiöser Dialog› im Buch Ich bin durch dich so ich (2016), 94f.; siehe auch Christuswirklichkeit: Ergänzend: 3.:
«Immer wieder steigt in diesen Sommerwochen die Frage in mir auf, warum ich mich als Mönch hier so zu Hause fühle. Ja, der Tagesablauf ist sehr ähnlich wie auf Mount Saviour, aber statt des Chorgebetes sitzen wir auf unseren Kissen im Meditationsraum und versenken uns in was wir Christen das Gebet der Stille nennen. Wir lassen uns in das abgründige Schweigen des Großen Geheimnisses hinunter. Schweigen verbindet: Sehr schnell sind wir hier zu einer echten Gemeinschaft geworden. So wie auf Mount Saviour unser Chorgebet die gemeinschaftsbildende Mitte ist, so ist es hier die schweigende Meditation. Dort rühmt in uns ‒ christlich ausgedrückt ‒ der Heilige Geist durch das ewige Wort den Vater, hier dagegen kehrt das Wort ins Schweigen zurück, also Christus zum Vater. Hier wie dort führt uns die innere Bewegung hinein in ein und dasselbe unergründliche Geheimnis. Ein begriffliches Brückenbauen wird mich noch jahrelange Gedankenarbeit kosten, aber jetzt schon erlebe ich diese Gemeinsamkeit und das fasziniert mich. Was Thich Nhat Hanh in Vietnam erlebte, wird mir in Tassajara bewusst: dass wir durch unser Mönchsein zutiefst verbunden sind ‒ über alle äußeren Unterschiede hinweg. Und diese Gemeinsamkeit ist ein tragender Grund ‒ überzeugender als alle scheinbaren Widersprüche.»
3.2. Auf dem Weg der Stille (2023), 20f.:[7]
«Während einer Predigt unseres Dominikaner-Studentenpfarrers Father Diego hob ich einmal geradezu ab. Mich erfasste ekstatisch die Wahrnehmung, dass wir Gott als den Dreieinen genau deshalb erkennen können, weil wir in den ewigen Tanz von Vater, Sohn und Heiligem Geist mit hineingezogen werden. Für Studenten in Wien ist es nicht albern, von Gott zu sagen, dass er tanze. Tanzen ist etwas Ernsthaftes ‒ natürlich nichts Todernstes, aber etwas Lebenswichtiges. Viel später lernte ich den Hymnus über Christus als ‹Lord of the Dance› ‒ ‹Tanzmeister› ‒ kennen, der auf eine alte Shaker-Melodie gesungen wurde.[8]
Ich erfuhr auch, dass der heilige Gregor von Nyssa im 4. Jahrhundert die Beziehung der drei göttlichen Personen zueinander als eine Art Kreistanz beschrieben hatte: Der ewige Sohn kommt aus dem Vater hervor und führt uns im Heiligen Geist zusammen mit der ganzen Schöpfung zum Vater zurück.
Wir können von diesem Großen Tanz auch mit den Begriffen Wort, Schweigen und Handeln sprechen: Der Logos, das Wort Gottes, kommt aus dem unergründlichen Schweigen Gottes hervor und kehrt wieder zu Gott zurück, schwer beladen mit der Ernte des zum liebevollen Handeln inspirierenden Geistes. Diese trinitarische Sicht hilft mir auf immer neue Weisen die ‹Kommunikation mit Gott› zu verstehen, die wir als Beten bezeichnen ‒ nicht als eine Art Ferngespräch bis zum Himmel, sondern als das Geschenk, dank der Teilhabe an Gottes Leben immer mehr von Leben erfüllt und lebendiger zu werden.»]
____________________
[1] Bruder David am Schluss seines VortragesVortrages in Wien anlässlich der Vorstellung seines Buches Credo: Ein Glaube, der alle verbindet; siehe das Audio in Credo ‒ Ein Glaube, der alle verbindet (27. Oktober 2010)
[2] Bruder David im Eröffnungsvortrag anlässlich der Salzburger Hochschulwochen Jesus als Wort Gottes (1972), abgedruckt im Buch Die Frage nach Jesus (1973), 49f.:
«Wir haben hier eben die drei Dimensionen des Sinnerlebnisses. … Man kann nicht einmal sagen, dass die drei sich gegenseitig ergänzen, sie sind vielmehr interdimensional miteinander. Wenn man die eine hat, hat man auch schon die anderen.» (50)
«Im religiösen Streben des Menschen, das wir als Suche nach dem letzten Sinn verstehen, zeigt sich einerseits in der jüdisch-christlichen Tradition ein Vom-Worte-her-Leben, anderseits in der buddhistischen Tradition ein Auf-das-Schweigen-hin-Leben. Die beiden sind aber keineswegs unvereinbar, im Gegenteil, sie sind interdimensional, freilich mit ganz verschiedener Setzung des Akzentes.» (49)
«Nun kommt alles darauf an, dass wir diese beiden Dimensionen aller Realität, das Wort und das Schweigen, nicht als nebeneinander stehen, sondern als verbunden sehen. Wir müssen Wort und Schweigen wirklich als total voneinander abhängig verstehen wie etwa zwei mathematische Dimensionen; wie eine Kugel z. B. und die Kreise, die diese Kugel bilden. Da ist e i n e Kugel und zugleich eine unendliche Vielzahl von Kreisen, die diese Kugel formen. Wir können nun nicht sagen, dass die Kreise um der Kugel willen bestehen, noch dass die Kugel um der Kreise willen besteht. ‒ Das ist ein sehr statisches Bild; wo es sich um Wort und Schweigen handelt, müssen wir eine dynamische Komponente einführen, und das ist nun eben das Verstehen.» (49)
[3] Bruder David (47:32) im Vortrag in Freiburg i. Br. anlässlich der Vorstellung seines Buches Credo: Ein Glaube, der alle verbindet; siehe das Audio in Credo ‒ Ein Glaube, der alle verbindet (20. Oktober 2010)
[4] Bruder David bezieht sich in seinem Buch Credo: ‹Ein Glaube, der alle verbindet› (2015), 66, auf das berühmte Eis-Vogel-Sonett von Gerhard Manley Hopkins (1844-1889),
«in welchem der Dichter für das Selbst-Werden ein neues Wort in der englischen Sprache prägt ‒ ‹to selve›, was man Deutsch mit ‹selbsten› wiedergeben kann. Etwas ‹selbstet›, indem es durch sei Tun aussagt, was es ist. Jede Glocke, jede angezupfte Saite ‹selbstet› so durch ihren ganz eigenen Ton.»
[5] Bruder David im Vortrag Jesus als Wort Gottes (1972), 48:
«Ich kann nur hoffen, dass das Gesagte genügt, um anzudeuten, wie tief diese Interdimensionalität im Geheimnis der Trinität verankert ist.»
[6] Die sogenannten Kappadokischen Väter Basilius von Caesarea Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz sind bedeutende Kirchenlehrer aus dem vierten Jahrhundert nach Christus, die aus Kappadokien (heutiges Zentralanatolien, Türkei) stammen.
[7] Den gleichen Originaltext hat auch Eve Landis übersetzt in Den großen Tanz beten (1998), siehe auch diese Passage in Christuswirklichkeit: Ergänzend: 4.: ‹Christus als Choryphaeos, als Anführer des Reigentanzes›, und in Dreifaltigkeit: Ergänzend: 2.4.
[8] Anmerkung von Bernard Schellenberger: Die Shaker («Schüttler») waren eine im 18. Jahrhundert aus den Quäkern hervorgegangene Freikirche in den USA, in der man ekstatische Schütteltänze pflegte.