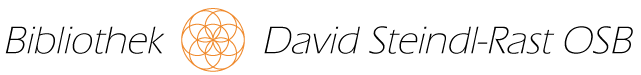Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 4, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
In die Antwort hineinwachsen
Willensfreiheit
Verzögerte Bedürfnisbefriedigung
Blitzentscheidungen
Das Jetzt ‒ im Schnittpunkt
von Zeit und Ewigkeit
Ent-scheidung:
Die Weisheit des Selbst
gewaltfrei durch uns fließen lassen
Entwicklung auf zwei Ebenen
Sterben und Tod
Weiterführende Fragen
Unsere Berufung
Drei Innenwelten des Gebets
Tag 4: Freitagvormittag: 7. Impulsvortrag (Bruder David):
In die Antwort hineinwachsen
Was ich versuche zu geben sind nicht Antworten auf Fragen, sondern sind nur Anregungen zu klarerer Fragestellung, das ist schon wichtig. Und die Antworten werden ja immer nur durch die Erfahrung gefunden.
Wir stellen die Fragen klar,
und wie Rilke sagt:
leben die Fragen in die Antworten hinein:
Wir l e b e n die Fragen: Wir machen sie zu einer Lebensfrage. Und wachsen so in die Antworten hinein. Die Antworten sind meist wieder nicht, was man so klar ausdrücken könnte, sondern sie sind bereichert mit unserem Leben.
[Rilke in seinem Brief 1903 an Franz Xaver Kappus in ‹Briefe an einen jungen Dichter›:
«Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben.
Leben Sie jetzt die Fragen.
Vielleicht leben Sie dann allmählich,
ohne es zu merken,
eines fernen Tages in die Antwort hinein.»]
Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir uns immer dieses Doppelbereiches bewusst sind.
Am Dienstagmorgen, Tag 1 haben wir Orientierungsachsen festgelegt, und da gleich gefunden, dass diese Achsen immer einerseits vom Raum-Zeitlichen kommen und dann doch immer in das Geheimnis führen.
Wir sind hineingestellt in diesen Doppelbereich, in das Raum-Zeitliche und das Überzeitliche, in das Materielle und das Geistige.
Am Mittwochmorgen, Tag 2, haben wir versucht, mehr über dieses Geheimnis auszusagen, unser Verhältnis zu diesem Geheimnis, das Unbegreifliche, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen im Leben. Und dass wir verstehen können, ohne es begreifen zu können.
«Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.»
(Bernhard von Clairvaux)
Gestern, am Donnerstagmorgen, Tag 3, haben wir wieder überlegt: Wer bin ich? Was meine ich, wenn ich Ich sage, nicht nur in meiner Beziehung zum Du? Es ist ein Unterschied, ob ich Ich-Selbst sage oder nur Ich. Das Ich kann zusammenschrumpfen zum Ego. Der entscheidende Unterschied ist Vertrauen, was im religiösen Vokabular Glaube heißt, oder Furcht. Das ist die große Entscheidung. Und durch mutiges Vertrauen werde ich Ich s e l b s t .
Willensfreiheit
Aber wie Vanja immer betont: In unseren Versuchen uns zu orientieren, geht es ja letztlich um die Frage: Was soll ich jetzt tun? Welche Handlungsweise, welche Haltung beim Handeln entspringt dieser Orientierung?
Und da sind wir gestern Nachmittag auf die Frage gestoßen:
Wie frei bin ich denn überhaupt im Handeln?
Und das ist heute so unser Ansatzpunkt: Wie frei bin ich?
Dazu gehört das Stichwort ‹Willensfreiheit› und ein anderes Stichwort, das ich vorziehe: ‹freie Entscheidung›, also die Begriffe ‹Wille› und ‹Freiheit›.
Was will der Wille im Zusammenhang von
Denken ‒ Fühlen / Empfinden ‒ Wollen?
Der Begriff ‹Wille› kommt daher, dass wir uns über unsere Handlungsweisen und unsere innere Beziehung zur Umwelt und Mitwelt irgendwie klar werden wollten, und da haben wir einerseits den Intellekt, die Einsicht, Verstehen, Begreifen, also intellektuelle Auseinandersetzung mit der Umwelt und Mitwelt: das Denken.
Dann haben wir das Fühlen. Das ist anders als das Denken. Das Denken analysiert, zerlegt, setzt zusammen, arbeitet mit Begriffen, das Gefühl schwingt mit: Im Gefühl ist viel mehr Körperlichkeit als im Denken, auch unsere Sinne schwingen mit.
Und die dritte Art, uns auf unsere Um- und Mitwelt einzustellen ist das Wollen und das ist ein ‹nach etwas streben›, ‹etwas anstreben›. Das ist etwas, was sich schon im allerersten Beginn des Lebens äußerlich beobachten lässt: Die einfachsten Formen des Lebens, die einfachsten Einzeller streben nach etwas und fliehen vor etwas. Sie wissen genau ‒ da muss auch das ‹Wissen› irgendwie drin sein ‒
So sehr wir uns von diesen einfachsten Lebewesen unterscheiden, es gibt trotzdem einen Zusammenhang: Unser Wissen ist eine Weiterentwicklung von dem, was schon Einzeller auszeichnet und die einzelnen Zellen in unserem Körper: Sie wissen, was sie wollen, was ihnen guttut, und sie wissen irgendwie, wovor sie flüchten sollen ‒ diese Polarität ist schon drinnen ‒, und sie wollen auch etwas: Sie wollen, was ihnen guttut. Und dass sie etwas fühlen, das kann man annehmen, aber nicht beobachten.
Und in diesem Sinne, auf dieser Ebene und in diesem Verständnis
ist der Wille eigentlich nie frei.
Denn wir können nicht etwas wollen, was unser Verstand nicht als gut zeigt. Das ist sehr fest verankert in der westlichen Philosophie: Wille und Intellekt gehören engstens zusammen, und was das Denken uns als erstrebenswert zeigt, das erstrebt der Wille und kann nichts anderes wollen. Der Wille will immer das Gute im Sinn: was mir guttut oder was für mich gut ist.
Mephistopheles in Goethes Faust:
«Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will
und stets das Gute schafft.»
Man kann das Böse, was uns zerstörerisch und böse erscheint, wollen, aber nur unter dem Gesichtspunkt, dass es für mich gut ist. Das Böse wird dann von außen gesehen. Von innen gesehen kann niemand das Böse wollen. Das ist ein Widerspruch. Das kann man nicht wollen. Wir wollen immer das Gute, immer das, was uns gut erscheint.
Und man kann sich vorstellen, dass jemand sich zu etwas entschließt, was offensichtlich auch für einen Massenmörder schlecht und zerstörerisch vorkommen muss: Ich werde jetzt halt da hineingehen und diese Kinder im Klassenzimmer erschießen mit einem Maschinengewehr ‒ das kommt ja vor: Ein solcher Täter kann auch das nur wollen, weil es ihm gut erscheint, etwa: Dadurch zeige ich jetzt, wer ich bin.
Also auf dieser Ebene ist der Wille nie frei, weil er immer das tut, was das Denken ihm als wünschenswert vorstellt: Das kann ein ganz verdrehtes und ganz versponnenes Denken sein.
Weil der Wille in dieser Hinsicht nicht frei ist, sondern immer tun muss, was uns gut erscheint, spreche ich nicht gerne von Willensfreiheit, sondern lieber von freier Entscheidung.
Frage zum verzweifelten Ausruf des hl. Paulus in Röm 7,19.
Der Vers wird meist so übersetzt:
«Denn ich tue nicht das Gute, das ich will,
sondern das Böse, das ich nicht will.»
Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt:
«Denn das Gute, das ich will, verwirkliche ich nicht.
Aber das Schlechte, das ich nicht will, das vollbringe ich.»
Da kommt wieder herein, was wir gestern angesprochen haben mit dem Schlüsselwort Verzögerte Bedürfnisbefriedigung:
Wir wollen etwas, das verzögerte Befriedigung verlangt, aber wir wollen lieber eine sofortige Befriedigung.
Der Intellekt ist vielschichtig: Er stellt mir etwas dar, das sehr naheliegend ist und sagt mir unter Umständen, wenn er gebildet ist, dass es darüber hinaus ein größeres Gut gibt.
Das Pauluswort vielleicht besser übersetzt:
«Das, was ich möchte, tue ich nicht»,
können wir so verstehen: Ich will die nächstbeste Befriedigung, obwohl ich eigentlich etwas Besseres möchte. Ich weiß z.B., dass für mich am besten ist, was für alle gut ist. Aber naheliegend ist, was vielen Menschen schadet, aber für mich jetzt sehr günstig ist. Wir sind die, die recht genau wissen, was wir eigentlich möchten, und doch das naheliegende wollen anstatt das wirklich Befriedigende.
[Ergänzend dazu, was Bruder David in seinem Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021) im Kapitel: ‹Berufung ‒ Folge deinem Stern›, 96f., schreibt:
Was nun die psychische Unrast betrifft, die es uns heute so schwer macht, uns auf Dauer zu etwas zu verpflichten, so ist sie kaum zu übersehen. Die Medien müssen sich auf Schnellfeuerberichterstattung umstellen, um mit unsrer Begierde nach immer neuer Aufreizung Schritt zu halten. Kaum jemand liest noch Texte, die lang genug sind, einem Thema gerecht zu werden. Der Inhalt muss wegen unsrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die immer kürzer wird, auf ‹Soundbites› reduziert werden. Wer eine Nachricht sendet, will eine sofortige Antwort.
Alles, was Zeit braucht,
macht uns ungeduldig.
Wir haben verlernt, die Vorfreude auszukosten,
die uns geschenkt wird,
wenn wir auf etwas warten müssen ‒
die Fähigkeit zu Impulskontrolle
und Belohnungsaufschub,
wie Psychologen sie nennen. Ihr Fehlen ist ein ernster Persönlichkeitsmangel und weist auch auf ein gestörtes Verhältnis zur Zeit hin: auf eine dauernde Angst, Zeit zu verlieren, mehr Zeit zu brauchen, keine Zeit zu haben. Wir fühlen, dass die Zeit verrinnt und wir mit ihr.]
Blitzentscheidungen
Ein günstiger Ansatzpunkt zum Thema ‹frei entscheiden›, sind Erinnerungen an Augenblicke, meist sehr dramatische Augenblicke, in denen wir etwas tun, ohne darüber nachdenken zu können, ob wir es wollen oder nicht.
Ein Schnellzug fährt heran und das Kind steht auf den Schienen und die Mutter reißt es weg. Es scheint fast unmöglich so etwas zu leisten, aber sie leistet es, ohne überhaupt daran zu denken.
Oder ein Feuerwehrmann geht in ein Haus hinein und setzt sich der größten Gefahr aus, rettet diesen erstickenden Hund oder dieses erstickende Kind, und nachher fragt man die Mutter oder den Feuerwehrmann: ‹Wie haben Sie sich das zugetraut, den Mut dazu gehabt›? Und die sagen immer:
‹Das habe ich schon getan,
bevor ich überhaupt Zeit hatte,
darüber nachzudenken.›
Und wir kennen ‒ vielleicht weniger dramatisch ‒, Augenblicke, in den wir die rechte Entscheidung treffen, ohne Zeit zu haben, darüber nachzudenken.
Und manchmal sogar, wenn wir uns mühen müssen und lange Zeit brauchen, um eine Entscheidung zu treffen: Das kommt bei mir öfters vor, dass ich einen Strich über ein Blatt mache und links alles hinschreibe, was dagegenspricht, und rechts, was dafürspricht, das dauert lang, wochenlang, aber die Entscheidung kommt dann plötzlich im Schlaf sozusagen. Wenn man gar nicht darüber nachdenkt: Man weiß es plötzlich.
Das Jetzt ‒ im Schnittpunkt von Zeit und Ewigkeit
Im Nachhinein, beim Erzählen eines solchen Erlebnisses, weisen wir immer auf einen Punkt hin: Keine Zeit:
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken!
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Sprache uns da auch wieder nahelegt: Genau verstanden heißt das eigentlich: Ich war nicht in der Zeit befangen, sondern ich war völlig im Jetzt. Und wenn wir völlig im Jetzt sind, dann entscheiden wir frei.
Blitzentscheidungen treffen wir immer im Jetzt.
Und da möchte ich Impulse geben, damit wir klarer sehen, was wir mit dem Jetzt meinen und was wir mit Entscheidung meinen.
Ich habe das schon so oft gemacht, dass manche von euch das sicher schon von mir gehört haben, weil es immer wichtig ist, das zu machen:
Wir stellen uns spontan meistens die Zeit so als eine lange Linie vor in der die Zeit verfließt ‒ so ein Strom ‒, die lange, lange Strecke der Vergangenheit und die unbestimmte Strecke der Zukunft und dazwischen dieser kleine Augenblick, diese kleine Strecke der Zeit, die wir ‹Jetzt› nennen.
Und jetzt können wir ohne große Schwierigkeit ein Gedankenexperiment machen, indem uns klar wird, dass das Jetzt n i c h t eine Strecke der Zeit ist, ganz gleich wie kurz. Denn nehmen wir mal diese kurze Strecke der Zeit und unterteilen wir sie, dann ist der eine Teil nicht mehr, weil er schon vergangen ist, und der andere Teil ist auch nicht, weil er noch nicht ist. Da bleibt diese kleine noch dünnere, noch kürzere Strecke, die ist. Aber solange es eine Strecke ist, solange können wir sie noch teilen, und die eine Hälfte ist nicht, weil sie nicht mehr ist, und die andere Hälfte ist nicht, weil sie noch nicht ist. Und das kann man dann ad Infinitum fortsetzen. Und das zeigt uns schon, einfach intellektuell, dass das Jetzt, das wir meinen, nicht in der Zeit ist.
Aber wir wissen, was Jetzt heißt. Und jetzt können wir darüber nachdenken, dass irgendein Punkt in der Vergangenheit, an den wir uns erinnern, immer jetzt ist. Wir können uns an viele vergangene Punkte erinnern, wir wissen, sie sind vergangen, aber im Augenblick, in dem wir uns erinnern, sind sie jetzt, und das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn wir uns die Zukunft vorstellen, können wir sie immer nur als Jetzt vorstellen. Und dieser Augenblick, dieser gegenwärtige Augenblick ist auch Jetzt.
Und wenn es i s t ,
nicht war oder sein wird,
sondern i s t ,
ist es immer Jetzt.
T. S. Eliot in einem seiner großen Dichtungen: ‹Four Quartets: Burnt Norton, V›:
«All is always now.» ‒
«Alles ist immer jetzt.»
Das klingt so wie eine Binsenweisheit, aber es ist eine ganz tiefe Einsicht.
Wenn es nicht Jetzt ist, ist es nicht. Da können wir also dann mit Berechtigung sagen:
Das Jetzt ist nicht in der Zeit,
sondern die Zeit ist im Jetzt.
Das muss man sich wirklich einprägen.
Das Jetzt ist der Gegensatz zur Zeit.
Zeit und Jetzt: Wir sagen gewöhnlich Zeit und Ewigkeit. Aber das ist das gleiche. Ewigkeit, richtig verstanden, ist nicht eine lange, lange Zeit. Und dieser Ausdruck ‹von Ewigkeit zu Ewigkeit› ist ungeschickt.
Bruder David erzählt, wie man ihm im Religionsunterricht Ewigkeit erklärte mit der Geschichte eines Vogels, der alle tausend Jahre auf der Spitze des größten diamantenen Berges der Welt sich den Schnabel wetzt. Wenn das Kratzen des Vogels den ganzen Berg abgetragen hat, wird eine Sekunde der Ewigkeit vorbei sein.
Augustinus (354-430) definiert Ewigkeit zutreffend als «nunc stans», «das Jetzt, das bleibt, das besteht.»
Und die Zeit ist in dieser Ewigkeit aufgehoben.
[Das Wort ‹aufheben› im dreifachen Sinn von G. W. F. Hegel ist ein Schlüsselbegriff im späteren Abschnitt ‹Sterben und Tod›.]
Ent-Scheidung:
die Weisheit des Selbst gewaltfrei
durch uns fließen lassen
[An dieser Stelle sei ausdrücklich hingewiesen auf die Seiten 86-88 im Kapitel ‹Entscheidung ‒ Was will das Leben jetzt von mir?› im Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021).]
Was bedeutet das Wort ‹Entscheidung›?
Es bedeutet die Überwindung der Scheidung
zwischen dem Ich,
das in Zeit und Raum handelt
und dem Selbst, das über Zeit und Raum erhaben ist.
Also die Entscheidung, die ich treffe ‒ wieder auch schön ausgedrückt, ‹ich treffe sie, wie ein Pfeil trifft› ‒, diese Entscheidung treffe ich, wenn ich im Jetzt bin. Und das ist immer die rechte Entscheidung.
Denn wenn ich im Jetzt lebe,
fließt die Freiheit des Selbst
ganz frei ‒ gewaltfrei ‒
durch das Ich durch.
Was immer das Ich tut, mit der besten Absicht, ist immer in Gefahr, der Wirklichkeit Gewalt anzutun.
Wenn ich aber aus der Entscheidung im Jetzt handle,
dann fließt die Weisheit des Selbst
gewaltfrei ‒ das ist die einzige Freiheit, die es gibt ‒,
in die mitfühlende Handlung des Ich.
Entscheidung und die Ent-Scheidung, die Aufhebung der Scheidung von Ich und Selbst, ist ein und derselbe Akt.
Und das erleben wir in unsern Blitzentscheidungen. Daher haben wir immer so einen Vorgeschmack und ein Modell und können uns sagen:
Was du in solchen Blitzentscheidungen machst, das sollte das Modell sein für jede Entscheidung, für jedes Handeln. Und das ist dann freie, gewaltfreie Entscheidung.
Und da sind wir dann wieder in diesem
Doppelbereich von Außen und Innen:
Außen handeln wir in der Zeit, innen ist, was Rilke in der Elegie an Marina in einem wunderbaren Satz sagt: Innen ist die
«Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst» ‒
das ist unsere Innerlichkeit.
Die letzte Weisheit liegt im Selbst. Man kann sogar sagen:
Das Selbst i s t die Weisheit.
In der christlichen Tradition ist die Weisheit, was wir den kosmischen Christus nennen. Deshalb sagt Paulus in Gal 2,20:
«Ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir.»
Und zugleich sagen wir: Christus: die Christuswirklichkeit ‒ nicht: Jesus Christus ‒ i s t die Sophia, die alttestamentliche Weisheit (Spr 8,23-31) und Jesus Christus nimmt Teil an dieser Christuswirklichkeit.
Und diese Weisheit drückt sich in unsern körperlichen Spontanreaktionen sehr gut aus. Da können wir es auch sehr gut beobachten, z.B. wie sich die Hand zurückzieht vom Feuer. Das geht aber durch alle Bereiche und man könnte dann sagen:
Eine freie Entscheidung zu treffen,
heißt auf der höchsten inneren Ebene,
das durchfließen zu lassen,
was wir in unseren Spontanreaktionen
auf der materiellen Ebene
immer ganz richtig tun.
Das ist ein und dasselbe, aber auf ganz verschiedenen Ebenen des Bewusstseins.
Frage: In welchem Zustand war Buddha nach seiner Erleuchtung?
Bruder David: Vielleicht war dieser erste Zustand nach der Erleuchtung reine Präsenz des Selbst, noch kein Ich-Selbst. Aber solange ich hier auf der Erde bin, muss ich beides, Ich und Selbst, zusammenhalten.
Entwicklung auf zwei Ebenen
Worum geht es im Leben?
Es geht um Entwicklung.
[Zum Schlüsselbegriff ‹Entwicklung› sei auf die Seiten 52f. und 134 hingewiesen im Buch Orientierung finden: Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021) im Kapitel ‹Das Leben ‒ Ort der Begegnung mit dem Geheimnis›. In diesem Buch nennt Bruder David drei Bedeutungen des Wortes Entwicklung.
Im Vortrag Dankbarkeit als Achtsamkeit im Dialog im Juni 2014, transkribiert in Mitschrift und Sterben, sowie im Retreat im September 2014 in Flüeli-Ranft Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II, 105-107, hatte Bruder David den Begriff ‹Entwicklung› noch scharf vom Begriff ‹Anreicherung› abgegrenzt: ‹Bereicherung, ganz was anderes wie Entwicklung. Bereicherung geht in einer Linie, Entwicklung ist kreisförmig›.]
Dieses Schlüsselwort Entwicklung stellt sich ganz verschieden dar auf den zwei Ebenen des Doppelbereichs. Bezogen auf Raum und Zeit ist Entwicklung der Ablauf von Empfängnis, wachsen, reifen, sterben.
Im Bereich des Nichtzeitlichen gibt es auch Entwicklung. So sprechen wir davon, dass jemand einen Sprachschatz entwickelt. Diese Art der Entwicklung ist mehr ein Anreichern. Bezogen auf unser Leben ist die Entwicklung auf überzeitlicher Ebene ein Einsammeln der ganzen Fülle des im Jetzt Erlebten in das große Selbst.
Nur ich, der ich so verschieden von allen anderen bin,
kann diesen, meinen besonderen Beitrag leisten.
Wir bringen unser einzigartiges Erleben in das Selbst ein
und bereichern dadurch das Selbst.
Rilke im Brief vom 13. November 1925 an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz:
«Wir sind die Bienen des Unsichtbaren
und wir heimsen den Nektar des Sichtbaren
in die goldene große Honigwabe des Unsichtbaren ein.»
Diese beiden Entwicklungen geschehen nebeneinander.
Sterben und Tod
Was ereignet sich im Sterben? Ein Loslassen. Das Loslassen übe ich in der Bemühung, im Jetzt zu leben.
Tod bedeutet, dass unsere Zeit um ist.
Es ist nicht hilfreich,
von einem Leben n a c h dem Tod zu sprechen,
denn das geht nicht, weil die Zeit um ist.
Wir können sagen ‹über den Tod hinaus›, dann sprechen wir den überzeitlichen Bereich an:
Was bleibt über den Tod hinaus?
Meine Identität wird aufgehoben im Tod.
Der Schlüsselbegriff ‹aufheben› hat nach G. F. W. Hegel drei Bedeutungen:
1. außer Kraft setzen, wie ein Bahnhof, der aufgehoben wird
2. auf eine höhere Ebene hinaufheben, erhöhen
3. bewahren, verwahren
Das Selbst bleibt und auch meine Seele bleibt.
Meine Seele ‒ meine Identität ‒, die zum Selbst gehört,
nimmt zugleich am Überzeitlichen teil
und diese Identität bleibt.
Die Identität von Verstorbenen kann uns nahe sein.
Frage: Was geschieht, wenn ein Lebensprozess, wenn Entwicklung nicht abgeschlossen ist? Kommt dann Reinkarnation?
Bruder David: Reinkarnation und Fegefeuer sind beides dichterische Bilder. Wir dürfen sie nicht wörtlich nehmen.
Weitere Themen mit Bruder David im anschließenden Gespräch: Die starke Tendenz, das Selbst zu vergessen ‒ Blitzentscheidungen im Spannungsfeld von Innen- und Außenperspektive ‒ Wollen im Sinn von Wu wei: Handeln im Nicht-Handeln (Der Fließweg).
Freitagnachmittag: 8. Impulsvortrag (Vanja):
Ergänzung zum Wort Entwicklung: Neben dem reifer werden und wachsen kann Entwicklung auch die Auflösung von inneren und äußeren Verwicklungen bedeuten. Dadurch kommen wir mehr zum eigenen Selbst.
Der Lotus, das Symbol der Reinheit,
blüht im trüben Wasser.
Er braucht diese trübe Welt.
Frage: Braucht das Selbst das Ich, um sich selbst seiner bewusst zu sein?
Bruder David: Das scheint mir sehr einleuchtend zu sein. Warum gäbe es sonst so viele Ichs.
Durch das Ich wird sich das Selbst seiner bewusst.
Vanja ergänzt zu Freiheit innen und außen: Wir in Mitteleuropa haben eine enorme äußere Freiheit, soweit das möglich ist in dieser Welt. Die innere Freiheit versuchen wir zu kultivieren, wie wir das hier im Felsentor versuchen.
Sie besteht darin, zu w o l l e n , was wir tun und lassen.
Wenn du wissen willst, was du willst,
schau, was du tust,
und dazu Ja zu sagen ist innere Freiheit.
Bei der Frage, wohin geht es, schaue ich von Tag zu Tag. Aber wir brauchen eine allgemeine Richtung, in der wir gehen wollen: Wir wollen dieser Welt dienen, für uns selber und für alle anderen die Freude mehren und Leid mindern. Was das konkret jeden Tag heißt, weiß ich nicht. Wenn ich zu sehr fixiert bin auf etwas, kann es sein, dass ich Möglichkeiten verpasse.
So wichtig Konzepte und Verständnis sind, wenn es darauf ankommt, kann es sein, dass sie nicht hilfreich sind. In einer lebensbedrohlichen Situation liegt uns ein Stoßgebet wie ‹O Maria hilf› vielleicht näher.
Früher war es selbstverständlich, dass eine Spezies gemeinsam handelte. Wir müssen uns heute als Spezies bewusst werden, dass wir ein Krebsgeschwür geworden sind. Während meiner Lebenszeit haben wir Menschen uns verdreifacht. Täglich sind wir 200’000 mehr.
Unsere Berufung
Bruder David: Oft wird mir die Frage gestellt, was soll ich tun? Wie kann ich dienlich sein?
Jeder Mensch hat eine Berufung,
nämlich die Aufgabe,
zu der das Leben uns aufruft.
Wie kann ich so hellhörig und bereitwillig antworten, dass der Beruf, den ich wähle, meiner Berufung entspricht?
Stell dir dazu drei Fragen:
1. Was freut mich? Man muss eine ganz klare Antwort darauf finden. Als ein Student Howard Thurman (1899-1981) die Frage stellte: «Was kann ich nur tun, um der Welt zu helfen»? Da antwortete dieser weise Meister: «Tu‘, was dir am meisten Freude macht. Die Welt braucht nichts dringender als Menschen, die alles, was sie tun, mit Freude tun.»
2. Was liegt mir? Wozu bin ich begabt und was kann ich lernen?
3. Welche Gelegenheiten bietet mir das Leben, meinem Ziel näher zu kommen? Gehe darauf ein. Das ist ausschlaggebend.
Das Selbst schwebt nicht.
Es ist die Wirklichkeit, die wirkt.
Wir lernen das Selbst, den immateriellen Bereich
über unsere eigenen Erfahrungen kennen.
Es ist unsere Innerlichkeit.
Nikolaus von Kues (1401-1464) sagte:
«Gottes Geheimnis ist das Zusammentreffen der Widersprüche.»
Drei Innenwelten des Gebets
Frage: Bruder David, was heißt für dich ‹beten›?
Beten heißt, sich mit Gott einlassen. Es gibt drei Formen, drei Innenwelten des Gebets im Christentum; siehe auch die Dreieinheit von SCHWEIGEN ‒ WORT ‒ VERSTEHEN.
1. Gebet der Stille: ‹Ich lasse mich in Dich hinunter› (Gerhard Tersteegen: ‹Gott ist gegenwärtig›), ins SCHWEIGEN, wie im Zazen; siehe auch Stille zulassen.
«Die meisten von uns sind an ein solches Übermaß
von Wortgeräusch gewöhnt,
dass Stille uns leicht Furcht einflößt.Sie kommt uns wie ein unendlicher leerer Rum vor.
Wir blicken in seine Weite hinab
und uns wird schwindlig.
Oder aber wir fühlen uns von ihr
auf geheimnisvolle Weise
zugleich angezogen und verblüfft.‹Ich weiß nicht, was mit mir geschehen ist›,
sagt da etwa jemand:
‹Ich habe mich immer mit meinen Gebeten wohlgefühlt,
aber seit kurzem möchte ich ganz einfach
in Gottes Gegenwart sein.
Weder möchte ich im Gebet etwas sagen,
noch etwas tun oder denken.
Und selbst die Gegenwart Gottes
kommt mir eher vor wie die völlige Abwesenheit
von allem, was ich mir vorstellen kann.
Es muss mit mir etwas nicht in Ordnung sein›!Nicht in Ordnung? Im Gegenteil!
Auch diese Stille ist Geschenk Gottes.
Und wenn wir sie als Ausdruck
unserer Offenheit für Überraschung annehmen
dann werden wir entdecken,
dass diese große Leere schon bis an den Rand
mit dem Unvorstellbaren gefüllt ist.Das muss paradox sein,
denn es bringt uns zurück
zu dem Paradox von Gottes Leben in uns:Im stillen Zentrum unseres Herzens
begegnen wir der Fülle des Lebens
als einer großen Leere.Es muss so sein. Denn diese Fülle ist größer als alles,
was das Auge gesehen und das Ohr gehört hat.Nur Dankbarkeit in Form
einer grenzenlosen Offenheit für Überraschung
kann die Fülle des Lebens in Hoffnung erahnen.»
Bruder David in seinem Buch: Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 141
- Vom Worte Gottes leben: alles, was es gibt, ist WORT Gottes. Ich horche hin auf jedes WORT und lebe davon; siehe auch Vom Worte Gottes leben ‒ die Versuchung im Garten.
- Contemplation in actione: Gemeint ist nicht, dass wir innerlich Gebete sprechen, während wir etwas tun ‒ das kann sehr gefährlich werden, wenn es etwas Heikles ist, was wir tun, und unsere Gedanken nicht voll dabei sind ‒, sondern unser Tun ist selber Gebet. Meine Mutter hat mir immer Socken gestrickt und die Liebe Gottes ist da in die Socken gegangen. Gottes Liebe in und durch unser eigenes Handeln VERSTEHEN (‹to understand›: ganz hineingehen): das ist Kontemplation i m Handeln , nicht nur w ä h r e n d des Handelns.