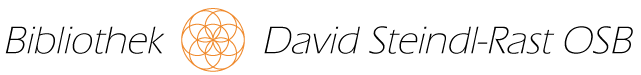Text, und Audios von Br. David Steindl-Rast OSB
Möge ich immer bereit sein Abschied zu nehmen, immer bewusst, dass jede Ankunft ein Auftakt zur Abreise ist, jede Geburt ein Schritt hin zum Sterben und möge ich dadurch den Segen kosten, voll im Jetzt zu sein, da, wo ich bin.[1]
Weil alle Askese auf Bleibendes gerichtet ist, wir aber nur allzu gut um den Wandel wissen, der allem Sinnlichen eignet, ist das Wesensmerkmal sinnenfreudiger Askese ein freudig gehorsames Loslassen.
Jeden Augenblick des Lebens gilt es, sich daran zu freuen und ‒ loszulassen.
Wir aber haben Angst und fürchten uns davor.
Wir wollen uns im Bleiben verschließen. Das aber widerspricht dem großen Weltplan.
Die Choreographie des kosmischen Tanzes verlangt von uns den Willen zur Wandlung.
Das Planmäßige an der Askese entspringt ja nicht der Willkür menschlichen Planens, sondern letztlich dem Bauplan des Kosmos, der sich wandelnd entfaltet.
«Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert,
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt;
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert,
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.»(Rilke: Sonette an Orpheus 2. Teil, XII)
Das Herz, das wirklich gehorsam hinhorcht auf den Rhythmus des großen Tanzes, steht immer am Wendepunkt, lässt leicht los, nimmt Abschied vorweg.
«Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
dass, überwinternd, dein Herz überhaupt übersteht.»(Rilke: Sonette an Orpheus 2. Teil, XIII)
Wir können hier nur die erste Strophe anführen. Man sollte aber in diesem Zusammenhang das ganze Sonett sorgfältig lesen. Worum es sich dreht ‒ in doppeltem Sinn ‒ ist der wendende Punkt.
Vergil stand an diesem Wendepunkt des Herzens. Er wusste, was Abschiednehmen heißt. Er konnte, Rachel Varnhagen sagt es so schön:
«durch Tränen des Abschieds die Welt anschauen.»
Durch diese Tränen hindurch glänzt jedes Lächeln «ewiger»; (Rilke wusste das).
Wer so die Welt anschaut, sieht im Bleibenden Wandel und im Wandel das Bleibende.
Dazu aber gehört jener zarte Humor der trotzdem lächelt, wenn er auch vielleicht nicht lacht.
«Am letzten Tag noch wird sie lachen,»
heißt es von der weisen Frau in der Bibel, wohl deshalb, weil sie gelernt hatte, immer wieder loszulassen. Uns weniger Weisen hilft Gott ein bisschen nach. Darum entfaltet sich die letzte Strophe von Eichendorffs Gedicht aus seiner ersten Zeile, wie aus einem Samen:
«Es wandelt, was wir schauen …
...
Du bist's, der, was wir bauen,
mild über uns zerbricht,
dass wir den Himmel schauen ‒
darum so klag' ich nicht.»
«Himmel» steht hier für das immer Bleibende, so wie der Mond (der Wandel und Bleiben vereint) in Ryokans Haiku.
Der Humor ist in beiden Gedichten gleich zart. Selbst die angedeutete Situation ist nicht unähnlich.
«DER DIEB VERGASS IHN.
ER HÄNGT JA NOCH IM FENSTER
VOLL UND SCHÖN, DER MOND.»
Ein anderer fernöstlicher Dichter schreibt im Alter ein Gedicht über das Ausfallen der Zähne ‒ auch das voll Humor.
Aber selbst Galgenhumor kann unversehens zur Rühmung werden, Rühmung, die umso reiner klingt, weil sie sich des Rühmens selbst kaum bewusst ist.
Christian Morgenstern beweist dies in seinen «Galgenliedern».
Angesichts der Aufhebung unserer Sinnlichkeit ist Humor deshalb trotzdem noch möglich, weil «nichts vergänglich ist, als die Vergänglichkeit.» ‒
«Trunken von Beständigkeit,»
stößt Werner Bergengruen mit dieser Einsicht tief in den Sinn des Sinnlichen vor.[2]
Damit stehen wir aber schon völlig
«im Raum der Rühmung,»
wie Rilke ihn nennt.
Rühmend hebt der Dichter das Sinnliche auf, indem er es erhöht, überhöht, übertrifft.
«Rühmen, das ist's! Ein zum Rühmen Bestellter,
ging er hervor wie das Erz aus des Steins
Schweigen. Sein Herz, o vergänglicher Kelter
eines den Menschen unendlichen Weins.»(Rilke: Sonette an Orpheus 1. Teil, VII)
Das ist der Dichter, der das Sinnliche aufhebt und über den Wandel hinaushebt, indem er es zu Sinn verdichtet.
Wir dürfen aber den Begriff Dichter nicht zu eng fassen. Es gibt den Dichter in jedem von uns. Wir alle sind dazu berufen, das, was wir durch unsere Sinne empfangen, im Herzen aufzuheben.
Menschliche Berufung ist es, das Nur-Sinnliche ungültig zu machen, indem wir es rühmend über sich hinausheben, es aber zugleich in seiner ganzen vergänglichen Einmaligkeit im immer Bleibenden geborgen halten und verwahren.
Erinnerung ist es, die diese Aufgabe letztlich vollendet. Das Sinnliche, das im Humor gärt, klärt sich in der Dichtung und gewinnt seine volle Süße im Erinnern.
Wir müssen dem Wort «Erinnerung» hier seine volle Bedeutung zurückgeben. Er-innerung ist Ver-innelichung, Sinnernte unserer Sinnlichkeit ‒ Einbringung, Verwandlung.
«So gilt es, alles Hiesige nicht nur nicht schlecht zu machen und herabzusetzen, sondern gerade, um seiner Vorläufigkeit willen, die es mit uns teilt, sollen diese Erscheinungen und Dinge von uns in einem innigsten Verstande begriffen und verwandelt werden. Verwandelt? Ja, denn unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde uns so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, dass ihr Wesen in uns ‹unsichtbar› wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'Invisible.»
(R. M. Rilke am 13. November 1925 in einem Brief an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz)
Kennen wir nicht dieses selbstvergessene Blütensaftsaugen aus der tiefsten Erfahrung unseres eigenen Lebens? So verwandelt unser Herz das Sinnliche unseres wachsten Erlebens und birgt es in seiner großen, goldenen Honigwabe als Sinn.
Darum wird beim Altwerden jedes Weihnachtsfest reicher, gewichtiger, schwerer und süßer, weil Freude und Traurigkeit aller vergangenen Weihnachtsfeste von frühester Kindheit an im Erleben mitschwingt; weil in der Erinnerung Altes und Neues einander bereichern. «Alles Vollendete fällt heim zum Uralten.»
«Wandelt sich rasch auch die Welt
wie Wolkengestalten,
alles Vollendete fällt
heim zum Uralten.Über dem Wandel und Gang,
weiter und freier,
währt noch dein Vor-Gesang,
Gott mit der Leier.Nicht sind die Leiden erkannt,
nicht ist die Liebe gelernt,
und was im Tod uns entfernt,ist nicht entschleiert.
Einzig das Lied überm Land
heiligt und feiert.»(R. M. Rilke: Sonette an Orpheus Teil 1, XIX)
In diesem «Lied überm Land» liegt der bleibende Sinn, in den das horchende Herz allen Wandel führt. Unter Tränen lächelnd, willig dieses Lied singen, das heißt durch die Sinne Sinn finden.[3]
[Die Quellenangaben zum obigen Text in Anm. 1 und 3]
[Ergänzend:
1. «Aufheben» hat für Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) einen dreifachen Sinn: negieren (tollere) ‒ emporheben (elevare) ‒ bewahren (conservare). Der hegelsche Begriff ‹aufheben› ist für Bruder David ein wichtiger Schlüssel im Zusammenhang mit Fragen, denen wir uns stellen müssen (2016): Tag 1 ‒ Vormittag: (08:27) und dem Thema Jetzt und ewiges Leben:
«Von dieser Mitte her können wir ‹in Fülle› leben, weil Zeit für uns auf eine höhere Ebene hinaufgehoben ist. Wir brauchen uns nicht länger darüber Sorgen zu machen, dass unsere Zeit unaufhaltsam abläuft. Die Zeit, die so abläuft, ist für uns schon jetzt aufgehoben, sie ist außer Kraft gesetzt, abgeschafft. Aber gerade deshalb dürfen wir jeden Augenblick als Gabe und Aufgabe voll ausschöpfen. Das Jetzt in der Zeit gibt uns ja Zugang zum Jetzt, das über Zeit erhaben ist.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass alles, was schön und gut und echt ist an der Zeit, aufgehoben und geborgen ist im ewigen Jetzt; mit jeder für uns bedeutsamen Einzelheit ist es liebend aufbewahrt dort, wo wir letztlich zuhause sind ‒ in Gott.»
Im Vortrag So leben wir und nehmen immer Abschied (2009) trägt Bruder David ‹Sei allem Abschied voran› und ‹Wolle die Wandlung› (Rilke: Die Sonette an Orpheus 2. Teil, XIII und XII) vor und spricht, wie jeder Augenblick aufgehoben ist: ausgelöscht, bewahrt, in das Bleibende hinaufgehoben.
2. ‹Aufheben› ist auch das Schlüsselwort im Kapitel ‹Sinnlichkeit und christliche Askese› im Buch Die Achtsamkeit des Herzens (2021), 80-99, dem der obige Text entnommen ist, wie auch Rühmen, Er-innern, Aufheben; Sterben und Wandlung; Altern: Ergänzend: 4.
3. Links zu weiteren Audios und Texten mit den Sonetten ‹Sei allem Abschied voran› und ‹Wolle die Wandlung› in Abschied, der Klang des Lebens: Ergänzend: 3.-4. und Anm. 3 und 6
4. Links zu Audios und Texten mit dem Sonett ‹Rühmen, das ist’s› und ‹Wir sind die Bienen des Unsichtbaren› in Rühmen, Er-innern, Aufheben: Ergänzend: 2.: Audios
5. Links zum Video und Audios mit dem Sonett ‹Wandelt sich rasch auch die Welt› in Sterben und Wandlung: Ergänzend: 3.
6. Links zu Audios und Texten mit Joseph von Eichendorff: ‹Es wandelt, was wir schauen› (Der Umkehrende, 4) in Fragen des Lebens: Haupttext und Ergänzend: 3.; Sterben und Wandlung: Haupttext und Ergänzend: 2. mit Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 93]
_______________
[1] Blessings ‒ Segenswünsche deutscher Text zum Video Blessings ‒ Segenswünsche von Bruder David (2019)
[2] Werner Bergengruen: ‹Nichts Vergängliches vergeht› und ‹Magische Nacht›, in Die den Kurs begleitenden Gedichte, 37f. und Einsichten aus Rilkes Dichtung, Teil II (2014), 110f.
[3] Die Achtsamkeit des Herzens (2021): ‹Sinnlichkeit und christliche Askese›, 93-99