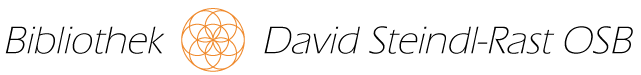Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 5, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
Dankbarkeit: eine spirituelle Praxis
mit der Methode Stop ‒ Look ‒ Go,
verortet in den Schöpfungs- und Heldenmythen
und gefeiert in Anfangsritualen
und Übergangsriten,
engstens verbunden mit einem Opferritual
Tag 5: Samstagvormittag: 9. Impulsvortrag (Bruder David):
Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Orientierungshilfe im Leben, die alles zusammenfasst, was wir besprochen haben.
Dankbarkeit: eine spirituelle Praxis
Dankbarkeit als Lebenshaltung umfasst den Intellekt (danken und denken sind sehr nahe beieinander), den Willen und das Gefühl.
Dankbarkeit ist eine Haltung,
die spontan in uns aufsteigt,
wenn zweierlei zusammenkommt:
Es muss ein freies Geschenk sein
und das Geschenk muss für uns wertvoll sein.
Frei geschenkt im Unterschied von halb geschenkt: Wir müssen es nicht kaufen und es sind auch keine Erwartungen daran geknüpft.
Dankbarkeit kann gesteigert werden:
Je unverdienter und je wertvoller ein Geschenk für uns ist,
desto dankbarer werden wir.
Dankbarkeit hat den Vorzug, dass sie eine allgemeinmenschliche Begebenheit ist. Jeder Mensch, auch Kinder können sie nachvollziehen.
Dankbarkeit ist das Herzstück jeder spirituellen Praxis.
Auch im buddhistischen Kloster verneigt man sich beständig.
Dankbarkeit wird nicht nur personifiziert jemandem gegenüber ausgedrückt, sie ist auch eine Lebenshaltung und eine methodisch geübte spirituelle Praxis.
Dankbar leben ist ein Schlüssel zur Freude,
den wir in den eigenen Händen halten.
Dankbarkeit war seit Jahrhunderten die Spiritualität unserer Vorfahren, auch wenn sie das Wort Spiritualität nicht kannten.
Wir alle kennen Menschen, die alles haben, aber nicht freudig sind, weil sie nicht dankbar sind. Umgekehrt kennen wir Menschen mit vielen Problemen, die Freude ausstrahlen, weil sie dankbar sind.
Dankbarkeit ist eine spirituelle Praxis, die gleichwertig mit jeder anderen spirituellen Praxis ist, weil sie wie jede spirituelle Praxis zum Ziel hat, uns aus der Zeit ins Jetzt und von außen ins Innen zu bringen.
C. G. Jung sagt:
«Wer nach außen schaut, träumt,
wer nach innen schaut, wacht auf.»
Dankbar leben bedenkt, dass jeder Augenblick total frei geschenkt ist und von höchstem Wert ist. Jeden Augenblick kann man dies bedenken, und das gibt uns Freude.
Freude ist eine besondere Art von Glück.
Sie ist ein Glück, das unabhängig ist
von dem, was uns geschieht.Es gibt vieles, wofür wir nicht dankbar sein können.
Aber in jedem Augenblick gibt es etwas,
wofür wir dankbar sein können.
Das eigentliche Geschenk ist
die Gelegenheit jeden Augenblicks.
Wenn wir das üben, dann bemerken wir, dass 90% aller Augenblicke unseres Lebens Gelegenheiten sind zu genießen, sich zu freuen. Wir sind hier im Leben, um das Leben zu genießen. Dankbarkeit macht z.B. Teetrinken zum Genuss, wodurch dieses lebensfördernd wird.
Die anderen Gelegenheiten, in denen wir uns nicht freuen können, können Gelegenheiten sein zu lernen, an etwas zu wachsen (was nicht immer angenehm ist), zu protestieren (z.B. mit Petitionen). Das verändert die Gesellschaft. Auch im Privaten kann ich Stop sagen, ich muss mir nicht alles gefallen lassen.
Die Gelegenheit ist das größte Geschenk.
Wie sieht jetzt ganz konkret die Praxis aus? Welche Methode führt in die Dankbarkeit?
Die Methode, die sich herauskristallisiert hat, ist in drei Worten gesagt, wie es Kinder lernen beim Überqueren einer Straße:
Die Methode Stop ‒ Look ‒ Go
1. Stop ‒ Innehalten: Der erste Lernschritt ist: immer wieder innezuhalten. Das braucht weniger als eine Sekunde zu sein.
2. Look ‒ Innewerden: Sei offen mit allen Sinnen, auch mit der inneren Aufmerksamkeit! Was will die Situation von mir?
3. Go ‒ Tu etwas: Mach etwas aus der Gelegenheit! Das ist das Unerschöpfliche des Lebens, dass es immer wieder eine neue Gelegenheit gibt. Wir sind wie die Maden im Speck, umgeben von Gelegenheiten zu genießen.
Mit Dankbarkeit wach im Jetzt
Im Wort dankbar steckt das Wort denken und die Silbe -bar, in der Bedeutung von ‹gebären›, ‹hervorbringen›.
Dankbarkeit ist ein Bedenken, das etwas hervorbringt.
Dankbarkeit bringt Freude hervor
und ist ansteckend.
Jeder Moment der Dankbarkeit verändert die Gesellschaft: Dankbarkeit führt weg vom Ego zum Ich-Selbst, da sie in den Augenblick wach im Jetzt führt.
Wenn wir im Jetzt sind, sind wir im Selbst,
und wenn wir im Selbst sind, sind wir im Jetzt.
Das kann man nicht genug bedenken.Durch die Dankbarkeit sind wir im Augenblick,
man kann ja nur im Jetzt dankbar sein.
Das weckt alles auf.
Man kann sich vorstellen, wie anders die Gesellschaft aussehen würde, wenn die Dankbarkeit vorrangig wäre.
Es wäre eine Gesellschaft der Gewaltfreiheit,
der Zusammenarbeit und des Teilens.
Dankbare Menschen sind immer bereit zu teilen. Sie haben immer das Gefühl, es ist genug da.
Eichendorff dichtet: «Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.» Das Zauberwort ist: dankbar leben.
Wir brauchen nicht auf ganz besondere Gelegenheiten warten,
sondern wir können dankbar sein für die Gelegenheiten,
die immer da sind.
Zum Abschluss möchte ich die Dankbarkeit verbinden mit den großen Mythen der Menschheit:
Menschen haben immer nach Orientierung gesucht
und sie in Mythen ausgedrückt.
Mythen sind dichterische Antworten
auf die großen Fragen des menschlichen Herzens.
Im Grunde gibt es nur zwei große Fragen:
Wer bin ich? Und die Antwort der Ursprungs- / Schöpfungsmythen
Worum geht es im Leben? Und die Antwort der Heldenmythen
Auf diese Fragen antworten zwei entsprechende Mythen.
Die Frage: Wer bin ich? Woher komme ich? Warum ist etwas und nicht nichts? beantworten die Schöpfungs- oder besser gesagt: die Ursprungsmythen.
Die Frage: Worum geht es im Leben? beantworten die Heldenmythen. Der Held stellt durch seine Geschichte dar, wohin es geht.
Drei Elemente in den Schöpfungsmythen
Es gibt zwei Modelle für die Ursprungs-, bzw. Schöpfungsmythen: Die Paarung von Himmel und Erde und die Vorstellung, dass etwas da ist, weil jemand es gemacht hat.
So verschieden die Schöpfungsmythen sind, sie folgen einer inneren Logik, in denen drei Elemente zusammenspielen:
1. Der Urheber oder die Urheberin, die aus dem Nichts alles hervorbringt: das Geheimnis, das nie hinterfragt wird, ein Bild für das Uralte, das immer Seiende, die ‹Mitte des Immer› (Rilke), das Übermaterielle, in der dichterischen Sprache der Märchen etwa die Urgroßmutter, Tiere: ein Hund oder auch eine Ente.
2. Das Material, aus dem alles gemacht ist. Die Mythendichter bemühen sich, das Material so unbedeutend wie möglich zu machen, in der Schilderung des Materials so weit wie möglich an das Nichts heranzukommen. In der Bibel ist es eine Puppe aus Tonerde oder bei den Indianern in Nord- oder Südamerika sind es kleine Steinchen und Stöckchen, in Polynesien ein Traum.
3. Der eigentliche Schöpfungsakt: Das untrennbare Einswerden des Materials mit dem Schöpfer, des Nichts mit dem All-Seienden. Im biblischen Schöpfungsbericht gibt der Schöpfer dieser kleinen Puppe aus Tonerde, die aussieht wie ein Mensch, sein eigenes Leben, indem er ihr seinen Atem einhaucht.
Mythen wollen nicht nur erzählt, sondern auch rituell gefeiert werden im Alltag.
Von den Ursprungs- und Schöpfungsmythen
zu den Ursprungs- und Anfangsritualen
Die Vergegenwärtigung von Mythen in wiederholbaren Ritualen heißt in der Fachsprache ‹Entmythologisierung›, der Begriff in einer völlig anderen Bedeutung als im deutschen Sprachraum seit Rudolf Bultmann (1884-1976) üblich.
Wir müssen immer wieder ein Ritual finden,
durch das der Ursprungsmythos in unseren Alltag einfließt.
Bei den Urvölkern wurde beim ersten Fischfang des Jahres der Ursprungsmythos erzählt und dramatisch dargestellt, wie ihre Vorfahren zum ersten Fischfang ausfuhren.
Wir haben heutzutage noch das Richtfest ‒ in Österreich die Dachgleiche genannt. Seit unvordenklichen Zeiten haben die Menschen beim Bau eines Hauses, wenn der Mittelpfosten steht, die Neuschöpfung der ganzen Welt erzählt, besungen und getanzt: Der kleine Baum auf dem Dach ist der Weltbaum und das Haus ist das Welthaus.
Und dabei erwacht das Bewusstsein: Jedes Mal, wenn wir in dieses Haus eintreten, er i n n e r n wir uns wieder ‒ nicht nur äußerlich an die Zeit des Entstehens ‒, sondern vielmehr innerlich, und wir wachen auf zu der Tatsache, dass wir in einem Welthaus wohnen, nicht in einer unwirtlichen Wüste.
Wir haben keine Ursprungsrituale mehr, aber Anfangsrituale, zum Beispiel Geburtstagsfeier, wo der Anfang eines neuen Lebensjahres gefeiert wird ‒ Maturafeier, mit der ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Sehr häufig sind unsere Abschlussrituale, die wir feiern, Anfangsrituale: Das ist erledigt, jetzt geht’s weiter. Jeder Abschluss ist der Anfang von etwas Neuem.
Unsere Rituale sind sehr schwach geworden. Wir leiden an einem Hunger nach Ritualen in unserer Zeit. Es wird auch immer wieder versucht, sie neu zu beleben.
Wenn wir an die Dankbarkeit denken,
dann ist der Anfang sehr häufig ein wichtiges Ritual.
Das kann man üben.
Die Augenblicke, in denen etwas anfängt, sind ganz wichtige Augenblicke, in denen man sich besinnen und dankbar sein kann für dieses Geschenk.
Denn letztlich:
Wer bin ich?
ist ein Geschenk:
Ich bin mir geschenkt.Stop ‒ Look ‒Go: unser Anfangsritual
Vor dem Computerstart kurz die Hände auf den Computer legen und bedenken, dass alles, was ES gibt, ein Geschenk ist.
Das ist zugleich auch ein Moment,
indem das Selbst im Ich durchscheint,
die immaterielle Wirklichkeit.
durch das Materielle.
Wenn man wirklich dankbar leben will, ist es sehr hilfreich, sich so kleine Stopps einzubauen in den Tag: Jetzt ist ein neuer Tag!
Schon am Morgen, wenn man die Augen aufmacht, kann man sich zur Gewohnheit machen, zu bedenken: Ich habe Augen, ich kann die Augen aufmachen. Es gibt 42 Millionen Menschen in der Welt, die nicht sehen können. Und zum Großteil Kinder und zum Großteil, weil sie unterernährt sind durch unsere Schuld, nicht persönlich, aber trotzdem: Wir sind die Ausbeuter in unserer Kultur.
Nur einen Augenblick zu bedenken: Ich habe Augen! Und jetzt wird’s ganz anders, der Tag wird ganz anders, ein ganz anderer Anfang. Und auch praktisch: eine größere Bereitschaft zu dienen, etwas zu tun.
Wie der Ursprung in der Dreieinheit von
SCHWEIGEN ‒ WORT ‒ VERSTEHEN
in unsern Alltag einfließt
1. Stop: Wir besinnen uns auf den Ursprung, das Geheimnis als das SCHWEIGEN.
2. Look / Listen: Wir horchen auf das WORT, das aus diesem SCHWEIGEN kommt.
3. Go: Wir VERSTEHEN durch Tun, indem wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Analog dem dritten Element in den Schöpfungsmythen, dem eigentlichen Schöpfungsakt, der darin besteht, dass sich der Schöpfer mit dem Geschöpf so innig wie möglich verbindet, geschieht neu die Wiederverbindung (‹re-ligio›: wieder-verbinden) zwischen dem Selbst und dem Ich, zwischen dem Urgeheimnis und meiner kleinen Tätigkeit hier in der Zeit.
Drei Phasen im Heldenmythos
Die Heldenmythen haben 1000 verschiedene Formen und Namen.
[Siehe das Buch von Joseph Campbell: ‹Der Heros in tausend Gestalten›, Insel Verlag 2024.
Bruder David hatte Joseph Campbell am Esalen Institut in Big Sur, Kalifornien, persönlich kennengelernt und ihn gefragt, warum die Heldengestalten fast immer Männer sind. Und Campbell hat auf den Animus hingewiesen, nach C. G. Jung die männliche Seite in der Psyche einer Frau.]
Die Abenteuerfahrt des Helden folgt immer demselben Muster in drei Phasen:
1. Phase: Der Held wird ausgesondert. Der Held muss besonders sein, aber nicht so besonders, dass wir uns nicht mit ihm identifizieren können. Siehe die Kindheitsgeschichte Jesu in den Evangelien oder die Legenden über die Kindheit des Buddha.
Er wird aus der Bahn geworfen oder er verlässt freiwillig sein Umfeld. Sein innerstes Begehren treibt ihn an, aufzubrechen und allein das Wagnis einzugehen, die Abenteuerfahrt des Helden. Wir identifizieren uns mit ihm, weil auch wir immer wieder in Situationen kommen, die wir allein bestehen müssen.
2. Phase: Die Auseinandersetzung mit dem Geheimnis: In der Mitte des Heldenmythos wird der Held mit etwas konfrontiert, was er nicht begreifen kann und mit dem er doch zurande kommen muss.
Wo und wie begegnet uns im Leben etwas,
das wir nicht in den Griff bekommen können
‒ unter keinen Umständen ‒,
und mit dem wir doch zurande kommen müssen?
Wenn Liebe und Tod uns ergreift.
Deshalb haben die schmerzlichen Prüfungen des Helden meistens mit Liebe und Tod zu tun, oft ganz eng miteinander verbunden: Der Held setzt sein Leben aufs Spiel aus Liebe zur Prinzessin, die krank ist und der er das Heilmittel bringt. Oder im Motiv des Drachenkampfes: Er will die Prinzessin befreien.
Die Mythenerzähler steigern in dieser Phase die Angst wie auch den Mut, mit dem der Held die Abenteuerfahrt besteht und der Kulminationspunkt ist das Paradox:
Der Held ist so tot wie möglich
‒ nicht nur tot, sondern zerstückelt,
und siehe: Er lebt!
3. Phase: Der Held kehrt zurück zur Gemeinschaft als Lebensbringer. Ein großes Fest ‒ Hochzeitsfest ‒ wird gefeiert: «Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.»
Sehr prosaisch ausgedrückt ist die Antwort des Heldenmythos auf die Frage: Worum geht es im Leben?
Es geht im Leben darum
immer ‒ immer wieder ‒ zu sterben:
in ein größeres, volleres Leben hinein
aus der Vereinzelung in die Gemeinschaft.
Aber um wirklich in der Gemeinschaft anzukommen, muss der Held zuerst aus der Gemeinschaft hinausgehen, um nach bestandener Abenteuerfahrt Lebensbringer der Gemeinschaft zu werden.
Auch der Heldenmythos muss rituell nachvollzogen werden.
Vom Heldenmythos zu den Übergangsriten
Das Ritual, das zum Heldenmythos gehört, sind die ‹Rites de passage›, die Übergangsriten, zu denen die Initiationsriten gehören.
Die Initiationsriten, feiern die Übergänge in unserem Leben anlässlich einer Geburt, beim Eintritt ins Erwachsenenalter, ins Leben als Mönch, bei der Eheschließung, bei Krankheit, Sterben und Tod.
Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs
[Ich füge in den folgenden Abschnitten Gesichtspunkte ein, die Bruder David aus zeitlichen Gründen in diesem Vortrag nur andeuten konnte. Wegleitend dafür ist das Kapitel ‹Eine tiefe Verbeugung› in seinem Buch Die Achtsamkeit des Herzens (2021), 141-143, siehe den Text auch in Dankbarkeit und Opferritus.]
«Wenn wir uns die großen Übergangsriten ansehen, die Teil des ältesten religiösen Erbes der Menschheit sind, dann wird uns die religiöse Bedeutung der Dankbarkeit klar.» (S. 142)
Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs: Ein Übergang findet statt:
«Ein Übergang von der Vielheit zur Einheit:
Zu Anfang waren es Geber, Geschenk und Empfänger;
daraus wird die Umarmung,
die Danksagung und entgegengenommen Dank umfasst.» (S. 141)«Und diese große Geste des Übergangs eint uns.
Sie eint uns als menschliche Wesen, denn wir erkennen,
dass wir in diesem ganzen vergänglichen Universum
die Einzigen sind, die um ihre Vergänglichkeit wissen.
Darin liegt ja unsere menschliche Würde.
Darin liegt zugleich unsere menschliche Aufgabe.
Sie besteht darin, den Sinn dieses Übergangs auszuloten
Unser ganzes Leben ist ja Übergang.
Sein Sinn will durch die Geste des Dankens gefeiert sein.
Ja, Dankbarkeit ist die große Geste des Übergangs.» (S. 141)
Drei Phasen in den Opferriten
und in der Geste der Dankbarkeit
«Im Mittelpunkt der Übergangsriten steht immer ein Opfer, was insofern verständlich ist, als das Opfer an sich typisch für alle Übergangsriten ist.» (S. 142)
Auch die Opferriten haben drei Phasen:
1. Die Opferung (Gabenbereitung): Die Opfergabe wird ausgesondert und der Opfernde identifiziert sich mit der Gabe. In der hl. Eucharistie:
«Du schenkst das Brot, die Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit.»
«Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit.»
Natur und Kultur sind darin eingeschlossen.
2. Wandlung (Konsekration): Die Gabe wird symbolisch, rituell, dem Geheimnis übergeben: die Aufopferung, oft mit andächtigem Hinaufheben der Gabe. Wie gestern (Tag 4, Freitagmorgen) begegnen wir wieder dem Schlüsselbegriff ‹aufheben› (G. F. W. Hegel), diesmal im Zusammenhang mit den Opferriten. Das muss nicht immer die Geste noch oben sein: Bevor man in Griechenland Wein trinkt, fällt mit einer Handbewegung ein Tropfen Wein auf das Geheimnis der Erde, aus der die Trauben aufgewachsen sind. Oder die Opfergabe wird verbrannt und der Rauch steigt auf, oder das Opfertier wird getötet.
3. Kommunion: Etwas davon wird verteilt: Bruder David erwähnt Orpheus, der Sänger, der von den Mänaden verrissen wird, aber sein Haupt schwimmt noch den Fluss hinunter und singt noch, seine Leier wird zum Sternbild.
«Schließlich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt,
während dein Klang noch in Löwen und Felsen verweilte
und in den Bäumen und Vögeln. Dort singst du noch jetzt.O du verlorener Gott! Du unendliche Spur!
Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte,
sind wir die Hörenden Jetzt und ein Mund der Natur.»Rilke: Die Sonette an Orpheus Teil 1, XXVI
Ein Chenchu aus einem Stamm in Südindien wirft eine Handvoll der gefundenen Nahrung in den Busch zurück und begleitet diese Opfergeste mit einem Gebet zur Gottheit, die als Herrin des Dschungels und all seiner Früchte verehrt wird.
Das Gebet lautet:
«Unsere Mutter, durch deine Güte haben wir gefunden.
Ohne dich empfangen wir nichts.
Dafür danken wir dir.» (S. 143)
Jeder Satz des einfachen Gebets, das die Gabe begleitet, entspricht einer der drei Phasen der Dankbarkeit:
1. «Unsere Mutter, durch deine Güte haben wir gefunden»: Der Intellekt erkennt die Gabe als Gabe.
2. «Ohne dich empfangen wir nichts»: Das bringt die Abhängigkeit zum Ausdruck. Der Wille wacht auf und anerkennt das Geschenk als Geschenk. «Ein Übergang findet statt von stolzer Isolation zu demütigem Geben und Nehmen, von der Versklavung in falscher Unabhängigkeit zur Selbst-Annahme in der befreienden gegenseitigen Abhängigkeit.» (S. 141)
3. «Dafür danken wir dir»: Das Gefühl ist angesprochen und drückt den Dank aus. «Man denke nur an die Hilflosigkeit, die wir empfinden, wenn wir ein anonymes Geschenk erhalten und folglich nicht wissen, wem wir dafür danken sollen.» (S. 140)
«Das größte aller Geschenke ist das Danksagen.
Geben wir Geschenke, dann geben wir,
was wir uns leisten könnten,
danken wir aber, dann geben wir uns selbst.
Ein Mensch, der zu einem anderen ‹ich danke dir› sagt,
sagt eigentlich ‹Wir gehören zusammen›.
Das Band, das sie vereint, befreit sie von Entfremdung.»
Bruder David in seinem Buch: Dankbarkeit: Das Herz allen Betens (2018), 23
Stop ‒ Look ‒ Go: unser Opferritus
Für uns sind die Opferriten nicht so zugänglich und durch dankbares Leben können wir ihren Kerngehalt selber rituell nachvollziehen mit dem Dreischritt Stop ‒ Look ‒ Go.
1. Stop ‒ innehalten und sich mit dem Geschenk identifizieren, indem wir das Geschenk als Geschenk erkennen.
Alles, was ES gibt, ist Geschenk:
Dieser eine Augenblick, diese Gelegenheit, ist Gabe.
2. Look ‒ innewerden: Ich anerkenne das Geschenk als Geschenk. Ein Geschenk kann man sich nie selber geben. Man kann sich, worum es geht, kaufen oder irgendwie aneignen, aber es ist dann nicht geschenkt.
Als Geschenk bin ich abhängig von dem, der mir das Geschenk schenkt. Ein gutes Bild ist die Mutter, der das Kind ein Blümchen schenkt. Das Kind hat alles von der Mutter, sogar die Freude des Schenkens ist ein Geschenk der Mutter an das Kind. Und doch kann sich die Mutter dieses Geschenk als Geschenk auf keine andere Weise verschaffen. Das Kind muss es schenken.
Und für uns ist das Aufgeben unserer Unabhängigkeit
absolut ein Tod,
aber zugleich ein H i n e i n sterben,
in die gegenseitige Abhängigkeit,
nicht jetzt Abhängigkeit:
sondern in das Netzwerk hineinsterben.
Das ist das volle Leben, die dritte Phase:
3. Go ‒ Danksagen und die Gegenseitigkeit feiern:
«Die Mutter beugt sich über das Kind in der Wiege und reicht ihm eine Rassel. Das Baby erkennt das Geschenk und erwidert das Lächeln der Mutter.
Die Mutter ihrerseits hochbeglückt von der kindlichen Geste der Dankbarkeit, hebt das Baby hoch und küsst es.
Das ist sie, die Spirale der Freude.
Ist nicht der Kuss ein größeres Geschenk als das Spielzeug?
Ist nicht die Freude, die darin zum Ausdruck kommt, größer als die Freude, die unsere Spirale ursprünglich in Bewegung setzte?» (S. 140)
«Zu Anfang waren es Geber, Geschenk und Empfänger;
daraus wird die Umarmung,
die Danksagung und entgegengenommenen Dank umfasst.
Wer kann im abschließenden Kuss der Dankbarkeit
noch zwischen Geber und Empfänger unterscheiden.» (S. 141)
Und wenn man das wirklich sieht und sich darauf einlässt und das nachvollzieht, dann sieht man, dass darin wirklich Orientierung im Leben liegt.
Dass im dankbaren Leben die Orientierung liegt, die Menschen schon seit unendlichen Zeiträumen, solange es uns gibt, immer wieder gesucht haben durch die Fragen: Wer bin ich? Und: Worum geht’s im Leben?
Wer bin ich?
Ich bin mir geschenkt.Worum geht‘s im Leben?
Mich dankbar zu erweisen für dieses Geschenk.
Bruder David antwortet auf Rückfragen:
Die Kindheitsgeschichte in den Evangelien von Matthäus und Lukas werden in der Form einer Heldengeschichte beschrieben. Siehe die besondere Empfängnis, besondere Schwangerschaft, besondere Geburt. Der zwölfjährige im Tempel: Das Kind ist ein Wunderkind. Und Jesus Christus stiftet wie ein Held Gemeinschaft.
Gemeinschaften haben immer gemeinsame Helden.
Rückfragen zu: ‹Warum kann ich mir nicht selber ein Geschenk machen›?
‹Wie gehe ich damit um, wenn ich mich beschämt fühle und in Verlegenheit gerate, ein wertvolleres Geschenk zu empfangen, als ich es selbst schenken könnte›?
Da berühren wir wieder den entscheidenden Punkt:
Wir sind auf ein Gegenüber angewiesen,
das Gegenteil von Unabhängigkeit
ist nicht Abhängigkeit,
sondern gegenseitige Abhängigkeit.
Die falsche Unabhängigkeit aufzugeben,
ist für uns wie ein Tod.