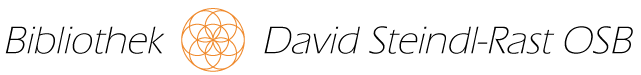Würde im Eltern-Kind-Verhältnis (2019)
Mitschrift des gleichnamigen Audios,
identisch mit dem Vortrag Menschenwürde (2019) (05:02-16:40)
Audio und Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
«Bei mir ist mein Selbstverständnis ‒ meine Haltung von Würde ‒ aus zweierlei entstanden ‒ von Kindheit an: Es wurde mir bedingungslose Liebe erwiesen ‒ das eine ‒, und ich wurde unterstützt in meiner Eigenart.
Und wenn ich sage: bedingungslose Liebe, dann schließt das gleich ein, dass meine Eigenart nicht nur angenommen, sondern gefördert und unterstützt wurde: also nicht geliebt unter der Bedingung, dass du brav bist oder so was. Natürlich mussten wir brav sein, aber auch wenn wir zurechtgewiesen oder sogar bestraft wurden, so war das nie eine Ausschließung. Man hat immer gewusst, ich gehöre dazu, ich bin bedingungslos geliebt, ganz unabhängig davon.
Und diese beiden Erfahrungen von Kindheit an haben mein Verständnis von Würde bis jetzt geprägt. Und so werden wir sehen, dass diese beiden Aspekte von würdevoller Haltung sich überall durchziehen: die Zugehörigkeit und die Eigenständigkeit. Ich stelle es so dar, wie ich es selber erlebt habe, aber ich glaube, es hat schon einen gewissen Allgemeinheitswert.[1]
Wenn ich sage, dass ich in meiner Eigenart unterstützt wurde, hat das viel mit Vertrauen zu tun. Und das ist etwas Wichtiges für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, nämlich Vertrauen in einem doppelten Sinn:
Das Erste ist, dass die Eltern den Kindern gegenüber sich vertrauenswürdig erweisen. Sie ermöglichen dem Kind, den Eltern zu vertrauen, und das Kind lernt, den Eltern zu vertrauen. Das wird heute ziemlich klar gesehen.
Aber ein zweiter Aspekt dieses Vertrauensverhältnisses zwischen Kindern und Eltern wird heute sehr häufig übersehen, und das ist, dass die Eltern auch dem Kind Vertrauen schenken müssen.[2]
Wenn Kinder nur einseitig den Eltern vertrauen, wird das zu einer Betreuung der Kinder, ohne dass sie heranwachsen können. Beides muss zusammenkommen: Ich bin für dich da ‒ ich erweise mich vertrauenswürdig für das Kind ‒, und ich vertraue dir: du kannst es schon selber ‒ also eine Art loslassen ‒, immer wieder: du kannst es schon.[3]
Und beides wurde mir geschenkt, und das ist ein großes Geschenk, und wenn einem das in der Kindheit geschenkt wird, wächst man einfach in das Bewusstsein der Würde hinein ohne große Schwierigkeiten. Wenn einem das nicht geschenkt ist, muss man es natürlich später nachholen und darüber werden wir noch sprechen: Die Zugehörigkeit zu den Eltern, zur Familie, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr verfügbar, da muss man in andere, größere Zugehörigkeit hineinwachsen.[4]
Jetzt noch ein bisschen autobiographisch, wie meine Eigenart unterstützt wurde. Ich schäme mich ja fast schon dessen, aber im Sport war ich entsetzlich. Ich bin sehr gerne geschwommen, gewandert, auf Bäume gekraxelt, aber der Schulsport, Ballspiele ‒ ich habe immer befürchtet, dass mich der Ball trifft ‒, waren mir unsympathisch. Aber meine Mutter wollte, dass ich mich doch auch sportlich irgendwie betätige und da ist mir eingefallen, ich möchte fechten lernen ‒ Florettfechten, mein Sport. Meine Mutter hat eigens Nachhilfestunden gegeben, um das Geld zu verdienen für die Fechtschule. So habe ich jahrelang fechten gelernt und es hat mir großen Spass gemacht. Das ist so ein Beispiel.
Wieder zweierlei kommt da zusammen: Du hast Würde und du musst dich der Würde gemäß benehmen. Wieder zwei Teile, sehr nahe an: du bist bedingungslos geliebt und du wirst unterstützt in deiner Eigenart: Du hast Würde, das wurde uns selbstverständlich ‒ ohne dass jemand je das Wort Würde verwendet hätte ‒, beigebracht, sehr traditionell in meinem Fall: du bist ein Gotteskind ‒ das war ganz klar. Was für eine höhere Würde kann man haben, als ein Gotteskind zu sein?
Aber ‒ und jetzt kommt die andere Hälfte ‒, alle andern Menschen sind auch Gotteskinder. Also musst du dich den andern gegenüber auch würdig erweisen. Diese beiden Dinge kommen da zusammen: Noblesse oblige.
Wir haben das sehr, ohne dass es uns eingedrillt wurde, gefühlt, immer gefühlt. Den Benachteiligten gegenüber war ich immer sehr sensibel, und meine Brüder auch, und noch mehr wie ich. Mein mittlerer Bruder Hans, der kürzlich gestorben ist, ist einmal ohne Schuhe nach Hause gekommen, weil er einem Kind, das keine Schuhe gehabt hat, seine Schuhe gegeben hat. Also, das war nicht eingedrillt, das haben wir irgendwie eingesogen.
Einmal ‒ erinnere ich mich ‒, ist mein Vater sehr zornig geworden wegen mir, weil ich mich einem Bettler gegenüber nicht respektvoll benommen habe. Am Weg zur Kirche sind immer die Bettler gesessen ‒ für mich waren die nicht weniger wert als andere Menschen ‒, da waren so Klettenbüsche, das sind so Kugeln, die auf den Sträuchern wachsen und die so Hackerl (Häkchen) haben, und wir haben so Kletten auf diesen Bettler geworfen, der dort gesessen ist: da ist mein Vater sehr ärgerlich geworden, sehr zornig. Wir haben viele Angestellte gehabt, damals hatte man noch zu Hause Angestellte gehabt in der Familie, und wir hatten ein großes Kaffeehaus mit vielen Angestellten: wir mussten sie mit größtem Respekt behandeln.
Und ich erinnere mich, dass ich diese Haltung auch mir zu eigen gemacht habe. Und ich habe diesen Respekt in Situationen, wo andere ihn nicht gezeigt haben, selber gezeigt. Zum Beispiel: In Wien gibt’s den Prater, das ist so ein ständiger Jahrmarkt zur Belustigung, und eine von den Belustigungen war eine Liliput-Stadt ‒ so hat sie geheißen ‒, da waren so Zwerge, die haben dort in kleinen Häusern gewohnt zur Besichtigung, eigentlich zur Belustigung. Und meinen Brüdern Hans und Max, die jünger waren als ich, hat das irgendwie gefallen, aber mich hat das sehr beleidigt, ich wollte absolut nichts davon wissen. Mir war ziemlich klar: das geht nicht. Ich habe mich mit ihnen identifiziert.
Ein anderes Beispiel: Bei uns hatte es fahrende Werkleute gegeben, die herumgezogen sind und verschiedenes repariert haben. Und da hat es auch jemanden gegeben ‒ ausserordentlich kunstvoll sehe ich das jetzt im Nachhinein ‒, der zerbrochene Schüsseln mit Draht geflickt hat, ein Fastelbinder, wie es damals hieß: wenn eine Porzellanschüssel gebrochen ist, hat man sie nicht weggeworfen, sondern aufgehoben, und der hat dann so ein Netz gemacht aus Draht und hat sie wieder zusammengefügt und so repariert. Das war ein ganz armer Mann ‒ er hat immer im Stall geschlafen ‒, und einmal hat er mir die Hand geküsst … irgendwie auch beschämend … aus Ehrerweisung … ich wollte nicht über ihm stehen … sehr schmerzlich.»
_______________
[1] Im Frühling 2018 erschien vom Neurobiologen Gerald Hüther das Buch Würde, und im ersten Kamingespräch vom 11. Juli 2018 in Gespräche im Lehrgang «Geistliche Begleitung» (2018) bezieht sich Bruder David auf dieses Buch. Auffällig ist, wie beide Autoren die begriffliche, bzw. wissenschaftliche Seite von Würde engstens mit ihrer persönlichen, vom Gefühl geleiteten Erfahrung verbinden. Der biographische Rückblick ist für beide ebenso wichtig wie die allgemein verbindlichen Aussagen. Das kommt auch deutlich zum Ausdruck im Gespräch von Helmut von Loebell mit Bruder David im SN-Saal in Salzburg am 23. November 2018. Dieses Gespräch ist aufgezeichnet im YouTube Video Würde ‒ was wären wir ohne sie? Im Zusammenhang von Würde, Rückgrat, Scham spricht Bruder David immer auch vom Verlust von Würde ‒ Ehrfurcht ‒ Scham in der heutigen Gesellschaft.
[2] Ich bin durch dich so ich (2016), 18:
«Dieses Vertrauen wurde mir auf zweierlei Weise geschenkt. Einerseits, indem sich all mir Nahestehenden als vertrauenswürdig erwiesen haben. … Und das Zweite, was ebenso wichtig war, ist, dass man mir Vertrauen geschenkt hat. Das ist etwas ganz anderes. Ich war manchmal sogar erstaunt, was ich alles tun durfte, ohne überwacht und kontrolliert zu werden.
Zum Beispiel beim Spielen. Meine Brüder und ich durften schon als ziemlich kleine Kinder stundenlang alleine in den Wald gehen, den Bach hinauf wandern und Entdeckungsreisen machen. Ich glaube, dass meine Mutter damals mehr oder weniger gewusst hat, wo wir sind und dass wir nicht in Gefahr waren. Wir haben uns einerseits geborgen gefühlt, weil wir doch irgendwie wussten: Sie kümmert sich. Aber anderseits hat sie uns das Vertrauen geschenkt, so dass wir ziemlich frei waren. Vor allem später waren wir wochenlang unterwegs, und sie hatte keine Ahnung, wo wir waren, weil es damals noch nicht die Möglichkeit gab, einfach anzurufen und Bescheid zu geben. Sie hat uns jedoch dieses Vertrauen geschenkt, dass wir schon gegenseitig aufeinander aufpassen, also dass wir uns als vertrauensvoll erweisen und Vertrauen schenken. Für diese beiden Aspekte bin ich am meisten dankbar.»
[3] Dazu ergänzend in Sterben lernen (2005):
«Umsomehr gilt dies für persönliche Beziehungen. Sind wir aufrichtig mit jemandem befreundet, müssen wir diesen Freund immer wieder lassen, um ihm Freiheit zu geben, wie eine Mutter, die ihr Kind unablässig freigibt.
Gibt die Mutter das Kind nicht frei, kann es schon gar nicht geboren werden; es stirbt im Mutterleib. Aber auch nach der physischen Geburt, muss das Kind immer wieder freigegeben und losgelassen werden.
Viele Schwierigkeiten, die wir mit unseren Müttern haben, und die unsere Mütter mit uns haben, kommen daher, dass sie uns nicht gehen lassen können; und offensichtlich ist es viel schwieriger für eine Mutter, einem Teenager das Leben zu schenken als einem Baby.
Doch ist dieses Auf-Geben nicht auf Mütter beschränkt; wir müssen uns alle gegenseitig bemuttern, egal ob wir Männer oder Frauen sind. Ich denke, Bemuttern ist in dieser Hinsicht wie Sterben; es ist etwas, das wir unser ganzes Leben hindurch tun müssen. Und immer, wenn wir einen Menschen oder einen Gegenstand oder einen Standpunkt aufgeben, wahrhaft aufgeben, dann sterben wir - ja, aber wir sterben hinein in eine größere Lebendigkeit. Wir sterben hinein in die Einheit mit dem Leben. Nicht zu sterben, nicht aufzugeben heißt, dass wir uns von diesem freien Lebensstrom ausschließen.»
[4] Ein eindrückliches und berührendes Beispiel für den Mangel an Liebe und Geborgenheit in der Kindheit ist Helmut Loebell, der seine Kindheit in schonungsloser Offenheit in seinem Buch Der Stehaufmann (2016) beschreibt und im Video Würde ‒ was wären wir ohne sie? (2018); siehe auch Auszüge aus dem Buch und Übersicht über die Themen des Gesprächs