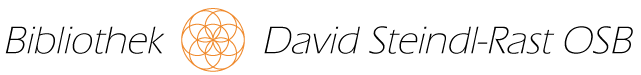Lebensorientierung (10.-15. Februar 2015)
Retreat im Felsentor mit Bruder David und Vanja Palmers
Nachschrift der Themen Tag 3, zusammengestellt von Susanne Latzel (2015) und neu bearbeitet von Hans Businger (2025)
Themenübersicht
Leben im Doppelbereich
von Ich und Selbst
Ich-Selbst und Ego
Verzögerte Bedürfnisbefriedigung
Begriffe wie ‹selbstlos› und ‹selbstvergessen›
Was bedeutet der Begriff ‹Seele›?
Zazen
Das Boddhisattva-Ideal
Tag 3: Donnerstagvormittag: 5. Impulsvortrag (Bruder David):
Bei diesem Seminar Lebensorientierung gehen wir jeden Tag von anderen Gesichtspunkten aus: Am ersten Tag waren die Ich-Du-Beziehungsachse und die Ich-Es-Beziehungsachse das Thema. Beide kommen aus dem Geheimnis und führen dahin. Am zweiten Tag haben wir uns mit dem Geheimnis beschäftigt. ES ist das, worum es letztlich im Leben geht. ES ist eine Wirklichkeit, ist etwas, das auf uns einwirkt. Die Wirklichkeit ist unbegreiflich, wir müssen uns ergreifen lassen. Im Augenblick der Ergriffenheit verstehen wir, verstehen wir das Unbegreifliche.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153) sagt:
«Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise.»
Leben im Doppelbereich von Ich und Selbst
Zwei Begriffe, die eng zum Doppelbereich gehören, sind:
Innen und Außen.
Die Wissenschaft versucht immer von außen zu sehen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Leben beginnt, wenn es ein Innen und Außen gibt, und etwas durch die Haut dazwischen hinein und hinaus gehen kann.
Wir haben die Ausdrucksweise:
Ich gehe in mich.
Was geschieht da?
Ein Schulkind antwortete auf die Frage:
Wozu ist Denken gut?
Damit man Geheimnisse haben kann.
Wir haben in uns eine Innerlichkeit, zu der kein anderer Mensch Zugang hat.
Wir kennen Innerlichkeit. Wenn wir in uns gehen und uns beobachten, bis wir der Beobachter sind, den niemand mehr beobachten kann, dann sind wir bei unserem Selbst.
Über das Selbst können wir verschiedenes aussagen, z.B. dass es nicht in Raum und Zeit ist. Das Ich dagegen ist offensichtlich in Raum und Zeit. Das Selbst ist immer da. Wir gehören dem immateriellen und dem materiellen Bereich an.
Wenn das Selbst immateriell ist,
ist es unteilbar.
Es ist verbunden mit dem Ich, es ist nicht unabhängig vom Ich. Das Selbst ist immer im Jetzt. Selbst und Ich sind immer verbunden. Die Konsequenz daraus:
Wir alle haben nur e i n gemeinsames Selbst.
Das ist keine neue Einsicht. Spirituelle Menschen wissen das seit Jahrtausenden. Es ist verankert in dem Gebot:
‹Liebe deinen Nächsten als dich selbst›!
Dein Nächster ist dein Selbst, ist mit demselben Selbst verbunden wie du. Wenn du das eingesehen hast, kannst du ihn nur anschauen und wissen, das ist mein Selbst.
Wie ist dieses Selbst mit dem Ich verbunden? Das Selbst ist Einheit und hat Bestand. Das Ich dagegen ist Vielheit und dem Wandel unterworfen.
Rilke nennt das Selbst in der Elegie an Marina Zwetajewa-Efron:
«Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst.»
Das immaterielle Selbst ist Geist.
Wie Geist und Materie verbunden sind,
so sind Ich und Selbst verbunden.
Materie ist die Außenseite von dem, was innen Geist ist. Außen bin ich Materie, innen Geist.
Ich-Selbst wird im indischen a-dwaita genannt,
die Nicht-Zweiheit.
[Bruder David in seinem Buch Orientierung finden (2021): ‹Innen / Außen ‒ zwei Aspekte der einen Wirklichkeit›, 76f.; siehe auch Jetzt im Doppelbereich: Ergänzend: 3.1.:
Von biologischem Leben können wir erst sprechen, wenn es ‒ wie bei den einfachsten Einzellern, die wir kennen, ‒ ein Innen gibt, das, durch die Zellwand vom Außen getrennt, auf die Außenwelt reagiert. Auf unser menschliches Leben und Erleben angewandt, sind Innen und Außen bildliche Ausdrücke für zwei Aspekte der einen Wirklichkeit.
Der Unterschied ist uns aus täglicher Erfahrung vertraut: Im Außen kennen wir nur Vielfalt. Innen aber können wir jene Einheit erfahren, welche die Vielfalt zusammenfasst, enthält und übersteigt.
So übersteigt unsre innerste Du-Erfahrung Einheit, aber auch Zweiheit.
Darum spricht der Hinduismus hier nicht von Einheit, sondern von Nicht-Zweiheit ‒ a-dwaita. Was mir als Außen bewusstwird, ist an Raum und Zeit gebunden und beständigem Wandel unterworfen. Als Innen kann ich etwas erleben, was unteilbar und immer jetzt ist. Rilke spricht von der ‹Mitte des Immer› und drückt mit diesem Bild ein innerstes Bleibendes aus.]
Wie hängen Ich und Selbst zusammen?
Das Selbst: grenzenlos, unteilbar, eins,
ist so unerschöpflich,
dass es sich immer wieder ausdrücken möchte in jedem Ich.
Ein spielerisches Bild dazu: Ein Puppenspieler spielt mit seinen Händen verschiedene Rollen. Er weiß, dass es nur ein Spiel ist. Doch es ist Spiel und Ernst zugleich.
Unsere Rolle ist, sich selbst bewusst zu spielen:
In diesem Doppelbereich Ich-Selbst zu leben,
ist das Entscheidende.
Die Persona ist nur die Maske, durch die das Selbst durchtönt. Das Wort ‹persönlich› kommt vom Lateinischen ‹per-sonare›: durchtönen.
Das Ich S. H. des Dalai Lama ist sehr betont, und trotzdem scheint das Selbst sehr durch. Da kann man fühlen: das bin ja ich!
Das ist das selbst-bewusste Leben, das Ich-Selbst.
Ich-Selbst und Ego
Und jetzt wissen wir auch, was das Ego eigentlich ist.
Das Ego ist das Ich in dem Augenblick,
in dem das Ich das Selbst vergisst.
Es ist das vereinzelte Ich, bzw. das Ich, das sich vereinzelt meint und sich mit der Rolle identifiziert. Wenn eine Schauspielerin plötzlich glaubt, sie sei die Minna von Barnhelm, ist sie verrückt geworden. Und wir sind die meiste Zeit verrückt, weil wir uns mit unserer Rolle identifizieren.
Wenn ich mein Selbst vergesse,
schrumpft mein Ich zusammen und fürchtet sich.Das Erste, was der Furcht entspringt, ist Gewalttätigkeit.
Das Zweite ist Konkurrenz,
das Vorankommen um jeden Preis.
Und das Dritte ist die Gier aus Angst,
dass nicht genug für mich da ist.
Diese drei Haltungen charakterisieren das Ego: Gewalttätigkeit, Konkurrenzkampf und Gier.
Wenn Furcht auftaucht, ist das für mich ein Hinweis, dass ich die Verbindung zum Selbst verloren habe und ins Ego gerutscht bin, denn das Selbst hat keine Furcht.
Unsere ganze Gesellschaft ist ins Ego gerutscht,
ist zu einer Egogesellschaft geworden.
Wenn das Ich die Furcht, das sich Sträuben gegen das Leben, aufgibt, wird es gewaltfrei. Das ist unsere einzige Freiheit.
Das Gegenteil von Gewalttätigkeit, Konkurrenzkampf und Habsucht
ist Gewaltfreiheit, Zusammenarbeit und Teilen,
was oft noch in armen Kulturen gelebt wird.
Unsere Ausrichtung ist der Einsatz für eine Welt, die nicht durchs Ego, sondern durchs Ich-Selbst geprägt wird. Wir gehen darauf zu, indem wir uns ans Selbst erinnern und Netze von Netzwerken bilden.
Bruder David zu Fragen im anschließenden Gespräch:
Vanja stellt die Frage: Dies ist ein Wissen seit Jahrtausenden. Warum sind wir in diesen Mustern, in dieser Welt gefangen? Was bremst uns da? Warum fallen wir immer wieder in die Falle des Ego?
Die persönliche Freiheit und Unabhängigkeit, die wir heute genießen, ist eine große Errungenschaft, aber wir haben sie zu weit getrieben – so weit, dass wir uns in Entfremdung und Vereinzelung verlieren. Das fordert, dass wir alles, was wertvoll ist an unserer Unabhängigkeit, schätzen und bewahren, jetzt aber lernen, persönliche Freiheit mit dem Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit zu verbinden.
Stichwort: Verzögerte Bedürfnisbefriedigung (deferred gratification):
Etwas vom Wichtigsten, das Eltern den Kindern beibringen können, ganz im Gegensatz zum heutigen Trend: Warten lernen, nicht alles gleich haben wollen. Unsere Ungeduld tut dem Leben Gewalt an, und die Gewaltfreiheit ist letztlich, sich aufs Leben zu verlassen. Auch hinsichtlich der Zeit, die es braucht.
Begriffe wie selbstlos und selbstvergessen:
Manchmal treffen wir ‒ wie bei Furcht und Angst ‒ auf Ausdrücke, die sehr verwirrend sind. Da hilft uns die Sprache nicht, da muss man vorsichtig sein. Statt Selbstlosigkeit müsste man richtigerweise ‹Egolosigkeit› sagen, die Selbstlosigkeit ist genau, was dem rechten Selbstbewusstsein entspringt.
‹Bruder David, meinst du mit Selbst dasselbe wie der Ausdruck Seele?›
Der Begriff Seele hat in der westlichen Tradition eine ganz klare Definition.
Seele ist, was mich zu mich selbst macht, was diesen Leib zu diesem Leib macht. Und nicht nur zum Leib, sondern:
Was diesen Menschen zu diesem einzigartigen Menschen macht.
Der Begriff Seele entspringt der Verwunderung: Wie können wir so viele verschiedene Ichs sein, obwohl wir alle e i n Selbst sind?
Es gibt so viele Missverständnisse. In mittelalterlichen Bildern sieht man die Seele als kleines Püppchen, das herauskommet, wenn man stirbt. Die Seele als ein Homunculus, ein kleines Menschlein, das da drinnen sitzt, manchmal nicht rein ist und gewaschen werden muss.
Jede Vergegenständlichung der Seele tut dem Begriff Seele Gewalt an.
Seele heißt einfach: Ich-Selbst. Mein wahres Wesen: Was mich zu mich macht, anders als die andern. Das kann nicht das Selbst sein ‒ das Selbst kann sich nicht teilen ‒, das kann nur das Materielle sein. Das Materielle macht den Unterschied aus. Das Immaterielle haben wir gemeinsam. Wir sind materiell sehr voneinander verschieden, ganz einzigartig.
So wie die Verschiedenheit nicht herumhüpft, ist die Seele nicht ‹etwas›, sondern ein abstrakter Begriff dafür, dass wir alle so ganz einzigartig und verschieden sind.
Thomas von Aquin (1225-1274) sagt: «Anima forma corporis est»:
‹Forma corporis› heißt:
Was diesen Leib zu diesem Leib macht,
und nicht nur zum Leib,
sondern was diesen Menschen
zu diesem einzigartigen Menschen macht.
‹Forma› als ‹Form› zu übersetzen ist falsch. Der Ausdruck ‹Forma› bedeutet soviel wie ‹causa formalis› in der Vierursachenlehre des Aristoteles (384-322 v. Chr.):
1. Causa materialis (Materialursache): Woraus ist es gemacht? Verweis auf das Material (hýle)
2. Causa formalis (Formursache): Was macht es zu dem, was es ist? Verweis auf die Wesensform (idéa, eídos: Gestalt, Urbild)
3. Causa efficiens (Wirkursache): Durch was ist es bewirkt? Verweis auf den Ursprung der Entstehung (arché tes kinéseos)
4. Causa finalis (Zweck-, Zielursache): Wozu dient es? Verweis auf die Ausrichtung, den Zweck, das Ziel (télos)
Seele ist der Begriff dafür, wie sich das Selbst durch mich ausdrückt,
dieses Einzigartige.
Eine Teilnehmerin: Für mich ist Seele der göttliche Funke, der jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze erfüllt, durchdringt und umgibt und mit diesem Lebewesen zusammen sich ausformt und zum Blühen kommt.
Bruder David: Dieser Funke heißt in der klassischen Philosophie: ‹logos spermatikos›. ‹Logos› ist das allumfassende WORT, durch das das Ur-Du mein Ur-Ich anspricht. Darum gibt es alles, und alles, was ES gibt, alle diese Dinge als WORT haben ein Fünklein in sich, oder mit einem anderen Bild: ‹sperma›, ein kleiner Same: das Fünklein, das zu einem Brand werden kann, oder der Same, der aufblühen und Frucht bringen kann. Und wenn dieses Fünklein aufleuchtet, dann bin ich wirklich Ich s e l b s t . Dann ist diese Blume oder dieser Stein oder was immer es ist, wirklich es selbst. Und in dem Augenblick scheint die Seele auf: das, was es wirklich in seinem Wesen ist.
Es ist viel wichtiger,
dass wir die Dinge so ausdrücken,
wie wir sie erleben,
als wenn wir genau die traditionelle Terminologie verwenden.
Donnerstagnachmittag: 6. Impulsvortrag (Vanja):
Zazen heißt soviel wie ‹in sich gehen und beobachten›. Es ist eine Haltung, die Haltung, achtsam zu sein gegenüber dem, was in uns vor sich geht. Es ist eine Art passiver Haltung. Die Qualität von Wohlwollen ist dabei, eine großmütterliche Haltung uns selbst gegenüber. Eine Großmutter sieht die Anlagen und fördert sie. Ich halte innerlich Ausschau nach Gesichtspunkten, die mich beruhigen und aufbauen. Freude ist so ein magnetischer Nordpol für meine Orientierung. Ich bin achtsam auf das, was mich positiv beeinflusst. Das ist oft nicht so leicht für Weltverbesserer. Als solcher gerät man leicht in eine negative Spirale, sieht und kritisiert das Schlimme.
Bruder David hat einmal gesagt, es geht darum, das Gute in jeder Situation zu unterstützen. 90% sollte unterstützend und positiv sein. Wir können das potenziell Gute in jeder Situation herausspüren. Hier im Felsentor feiern wir das gute vegane Essen und nebenbei kann die Botschaft vermittelt werden, dass das vegane Essen nicht nur das Beste für unsere eigene Gesundheit ist, sondern auch für die Ökologie der ganzen Welt. Auf diese Weise kann man ein Anliegen andern besser nahebringen.
Was mich auch inspiriert und berührt, ist das Ideal der Bodhisattvas, wie Buddhisten sie nennen.
[Bruder David in seinem Buch Credo: Ein Glaube, der alle verbindet (2015), 106:
Tiefes Mitgefühl lässt jene, die Befreiung von Selbstentfremdung erlangt haben, das Leid all derer teilen, die sich noch um Befreiung mühen. Diese ‹Bodhisattvas› ‒ wie Buddhisten sie nennen ‒ erreichen die Schwelle höchster Seligkeit, kehren aber um, weil sie an der Befreiung (Erlösung) mithelfen wollen, bis auch die Verstricktesten endlich befreit sind.
Wie tief sie auch aus Mitgefühl ins Leiden hinabsteigen,
sie strahlen doch immer die Freude aus, die sie schon verkostet haben.
Die Archetypen von Christus und Bodhisattva treffen da zusammen.]
Wir selbst können uns als Bodhisattvas sehen: Ich bin in dieser Welt, weil ich der Welt dienen möchte.
Wenn ich in Schwierigkeiten komme, hilft mir der Bericht einer italienischen Biologin, was im Bewusstsein einer Raupe vorgehen mag, wenn sie sich einspinnt. Erst passiert die totale Katastrophe, sie zersetzt sich und löst sich auf in Zellen. Doch dann kommt es zu einer neuen Findung von Zellen, die zum Schmetterling führt.
Gibt es vielleicht in einer Situation,
die wir als Katastrophe empfinden
und die sich immer weiter zuspitzt,
einen guten Ausgang, eine Verwandlung?
Mitgefühl und Weisheit sind die beiden Pfeiler, die sich gegenseitig ausbalancieren. Weisheit ist der Geist, der bereit ist für Neues, offen und frisch. Er hat nichts zu tun mit Fakten und Konzepten. Er ist älter als die Konditionierungen. Er hängt nicht an fixen Vorstellungen. Weisheit ist ein mutiger Geist, der die Fähigkeit hat, sich von der vertrauten Landschaft der mentalen Geschäftigkeit zu lösen. Er kann verweilen in der stillen Realität der Dinge und ihren Eigenwert sehen. Jedes Ding hat seinen Selbstwert, seinen Eigenwert.
Dem Gong zuzuhören ist auch eine Form von Zazen. Auch hier wenden wir die Achtsamkeit nach innen. Musik, der Gong kann ein Dharmator sein, eine Eintrittspforte ins Bewusstsein des Selbst.
Die Klänge des Gongs, den Vanja spielt, vibrieren in uns und durch uns.