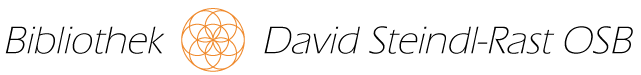Bruder David Steindl-Rast im Filminterview (2017)
mit Ramon Pachernegg
Transkription© von Hans Businger (2022)
(00:00) «Einerseits ist es ein Fortschritt ‒ ein positiver Fortschritt ‒, dass wir eigenständig geworden sind. Das hat ja lange gedauert und war ein schwieriger Prozess. Früher waren die Menschen völlig in Familie und Sippe und Gesellschaft eingeschlossen, dass sie gar nicht selbständig denken oder handeln konnten.
Und das war ein schwieriger und langwieriger Prozess, dass wir unsere Eigenständigkeit gefunden haben.
Es gibt heute noch Gesellschaften ‒ und ich habe die selber kennengelernt ‒, wo die Menschen nicht eigentlich individuell sind, sondern sie können zum Beispiel dir etwas versprechen oder einen Termin ausmachen, und sie halten es nicht ein oder sie kommen nicht, weil die Familie sich anders entschieden hat. Und da braucht man sich gar nicht zu entschuldigen, das ist selbstverständlich.
Also für uns ist diese Eigenständigkeit in unserer Gesellschaft zunächst einmal als Wert anzusehen.
Allerdings sind wir viel zu weit gegangen und sind nicht nur eigenständig, sondern sind vereinzelt worden und darunter leiden die Menschen heute sehr viel. Die Anonymität des Stadtlebens: Menschen sind völlig anonym, völlig vereinzelt, haben keine Einbindung an Irgendjemanden. Wenn ihnen etwas fehlt, gibt es Menschen, die keinen Menschen haben, an den sie sich wenden können. Das ist wieder in anderen Gesellschaften ganz anders.
Es geht also nicht um unsere Eigenständigkeit: die ist etwas Positives, aber um unsere Vereinzelung. Und unter der leiden Menschen sehr heute. Sie fühlen sich vereinsamt.»
(02:12) «Wenn man von der Selbstfindung spricht, denken leider sehr viele Menschen nicht an wirkliche Selbst-findung, sondern an noch größere Vereinzelung dadurch, dass man sein Ego, sein kleines Ich in Zeit und Raum beweihraucht oder genau definiert oder was immer.
Wirkliche Selbst-findung heißt ja, das in uns selbst finden, was uns mit allen andern verbindet:
Das Selbst ist, was uns mit allen andern verbindet.
Letztlich gibt es nur ein Selbst.
Und dieses eine Selbst drückt sich in vielen Ich aus.
Und wenn dieses Ich dann das Selbst vergisst, wird es vereinsamt und vereinzelt und wird zum Ego.
Das Ego ist ja nicht etwas Zusätzliches, sondern ist einfach das Ich ‒ ursprünglich sehr positiv ‒, diese einmalige, ganz einmalige Ausdrucksform des Selbst, ist nie wiederholt, ein großer Reichtum ‒ sehr positiv.
Aber wenn dieses Ich dann vergisst, dass es letztlich nur eine Ausdrucksform des Selbst ist, dann schrumpft es zusammen zum kleinen Ego.
Und das erste, was sich ereignet, ist, dass es Angst hat, weil auf einmal so viel andere da sind, und ich bin so ein kleines Ich unter Millionen und Milliarden von andern.
Aus der Angst wird dann Furcht: es fürchtet sich, und aus dieser Furcht wird alles, was auf unserer Welt schief geht:
Zunächst einmal Aggression, weil Furcht aggressiv macht, dann Konkurrenzkampf, weil die vielen Andern: da muss ich mich verteidigen oder muss ich mich stark machen gegen die Andern, und dann Habsucht, weil: da ist vielleicht nicht genug da für alle, da muss ich so viel wie möglich an mich reißen.
Und alle diese Aspekte: Aggression, Competition und Geiz und Neid, Habsucht: das entspringt alles dem kleinen Ego. Das charakterisiert dieses kleine Ego.
Und dieses kleine Ego hat ja auch die Welt gebaut, in der wir leben. Die Gesellschaft, die wir kennen, ist eine Ego-Gesellschaft. Und darum auch ist jedes einzelne Ego sehr vereinsamt, fühlt sich allein, fühlt sich einsam, abgeschnitten von allen Andern. Das Heilmittel dagegen ist, nicht alles das Positive, das wir durch unsere Eigenständigkeit errungen haben, aufzugeben, sondern zusätzlich uns bewusst zu werden:
Letztlich ist das nur eine Rolle, die ich spiele, und eine Rolle, die mein Selbst spielt, und dieses Selbst ist eines für uns alle.
(06:07) Dieses Selbst können wir ja auch leicht entdecken durch ein kleines Gedankenexperiment.
Wir können uns beobachten: Ich kann mich jetzt hier beobachten, wie ich hier sitze und spreche, und ich kann immer weiter zurückgehen. Wir verstehen diese Metapher ‹zurückgehen›, ‹in uns gehen›, ‹zurücktreten›, uns beobachten, bis wir den Punkt erreichen, wo ich der Beobachter bin, den niemand mehr beobachten kann ‒ das lässt sich leicht nachvollziehen.
Und dieser Beobachter ist das Selbst.
Dieser Beobachter ist einer für uns alle, denn er ist nicht mehr in Raum und Zeit. Er kann Raum und Zeit beobachten.
Er ist außerhalb von Raum und Zeit ‒ im Jetzt. Im Jetzt sind wir im Selbst.
Und weil wir nicht mehr in Raum und Zeit sind:
Dieses Selbst lässt sich ja nicht teilen. ‒
Um etwas teilen zu können, muss es in Raum und Zeit sein.
Es lässt sich nicht teilen, also können wir irgendwie uns der Wirklichkeit annähern, dass Ihr Selbst, mein Selbst, das Selbst jedes Menschen ein und dasselbe Selbst ist.
Und dieses Selbst ist so unerschöpflich, dass es sich immer wieder ausdrücken will und immer wieder ausdrückt in unzähligen Ich.
Jedes Ich ist ganz einzigartig.
Wenn wir Ich sagen, sagen wir etwas, was in dieser Art noch nie ein anderer Mensch gesagt hat und nie wieder sagen wird. Niemand hat genau die gleichen Eltern, ist zur gleichen Zeit, ist in die gleiche Kultur hineingeboren.
Unser Ich ist viel einzigartiger als wir das gewöhnlich annehmen. Und unser Selbst ist viel gemeinsamer, als wir das gewöhnlich denken.
(08:35) Denn, nachdem das Selbst, wie gesagt, Raum und Zeit nicht angehört ‒ mein Ich gehört Raum und Zeit an, aber nicht mein Selbst ‒, so finde ich mein Selbst immer, wenn ich über die Zeit hinausgehe. Und das ist das Jetzt.
Das Jetzt ist nicht ein kleiner Teil der Zeit, sondern richtig verstanden ist das Jetzt die Ewigkeit, also Nicht-Zeit ‒ das Gegenteil von Zeit, denn es geht über die Zeit hinaus.
Es ist falsch zu sagen, das Jetzt ist in der Zeit. Es ist richtiger zu sagen, die Zeit ist im Jetzt.
Denn wenn wir an die Vergangenheit denken, ist das jetzt ‒ wir können schon wissen: das war ‒, aber erinnern können wir uns nur immer als Jetzt. Und die Zukunft, wenn sie kommt, ist immer jetzt. Alles ist immer jetzt.
T. S. Eliot, der große amerikanisch-englische Dichter sagt: ‹All is always now› ‒ ‹Alles ist immer jetzt.›[1]
Wenn es Ist, ist es jetzt. Wenn es war, ist es nicht: es war. Wenn es sein wird, ist es nicht: es wird sein. Aber das Ist, ist Jetzt.
Und dieses Jetzt ist nicht ein kleiner Abschnitt in der Zeit.
Denn wenn’s ein kleiner Abschnitt in der Zeit wäre, könnte man es immer wieder unterteilen, und die Hälfte ist nicht, weil sie nicht mehr ist und die andere Hälfte ist nicht, weil sie noch nicht ist. Und solange es ein kleiner Abschnitt ist, kann man es immer teilen.
Also das Jetzt ist nicht in der Zeit.
Und wenn wir wirklich im Jetzt sind ‒ und das kann man üben ‒, wenn wir im Jetzt bleiben und sind, dann sind wir auch im Selbst.
Natürlich sind wir Ich. Wir sind eben −
T. S. Eliot nennt das Jetzt: ‹the moment in and out of time›, ‹der Augenblick, der innerhalb und außerhalb der Zeit ist› ‒ beides.[2]
Und wir leben in diesem Doppelbereich.[3]
Das ist sehr wichtig: Rilke hat sehr viel mit diesem Gedanken des Doppelbereichs gearbeitet, ist immer wieder auf den Doppelbereich zurückgekommen als Dichter.
Dieser Doppelbereich ist, dass wir einerseits in Raum und Zeit leben: einen gewissen Anfang haben, ein gewisses Ende unseres Lebens, überschaubar, und anderseits im Jetzt:
Einerseits das Ich ‒ in Zeit und Raum ‒, anderseits das Selbst: im Jetzt ‒ über Raum und Zeit erhaben.
Und diese beiden zusammenzuhalten ‒ es ist weder gemischt noch getrennt:
Es ist eben dieser sonderbare Doppelbereich; und in dem leben zu lernen, das ist in vielen spirituellen Traditionen eigentlich das Ziel.
Das ist Achtsamkeit: Achtsamkeit heißt, im Jetzt leben.»
(12:09) «Also ich habe wenigstens viel Zeit gehabt, ein langes Leben, um es zu üben. Und es hat sich aber ganz organisch entwickelt. Ich kann auf keinen Punkt hinweisen, der so der große Durchbruch oder die große Erleuchtung war. Ich bin, vor mehr als 60 Jahren jetzt schon, Benediktinermönch geworden, und unser benediktinisches Leben ist ein Leben der Achtsamkeit und der Dankbarkeit.
Und wenn wir dankbar sind ‒ richtig verstanden: es heißt ja nicht Danke, Danke sagen ‒, sondern Dankbarkeit kommt zustande, wenn einem etwas sehr Wertvolles frei geschenkt wird. Beides muss zusammenkommen:
Es muss für mich wertvoll sein ‒ braucht nicht viel Geld wert sein, aber es muss mir wertvoll sein ‒, und es muss mir wirklich frei geschenkt sein: nicht verkauft oder eingetauscht, oder später noch muss ich dafür arbeiten: es wird mir frei geschenkt.
Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann steigt in uns diese Freude auf und diese Freude ist schon die Dankbarkeit, und die kann man dann ausdrücken, indem man Danke sagt oder singt oder sonst irgendwie ausdrückt.
Aber die eigentliche Dankbarkeit ist die Freude, die aufsteigt, wenn uns etwas für uns Wertvolles ganz frei geschenkt wird.
Und der nächste Schritt, den wir dann in unserer mönchischen Erziehung im Benediktinerorden machen, ist, dass wir erkennen, dass jeder Augenblick das größte Geschenk ist, das wertvollste Geschenk, das man sich nur vorstellen kann.
Alles Andere hängt davon ab, dass dieser Augenblick mir noch geschenkt wird. Und zugleich wirklich frei geschenkt ‒ total frei ‒, weil ich mir ja auf keine Weise noch den nächsten Augenblick erwerben kann oder verdienen kann ‒ ein Geschenk.
Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wenn dieses Bewusstsein ‒:
Das größte Geschenk wird mir jetzt ganz frei geschenkt ‒ jetzt, jetzt, jetzt ‒, dann lernt man dankbar zu leben oder im Jetzt zu leben ‒, das kann man so oder so ausdrücken.
Und im mönchischen Leben habe ich das eben immer wieder erlebt, das halt dann durchdacht und überlegt und analysiert, und bin zu den Einsichten gekommen, die ich da jetzt ausgesprochen habe.»
(15:21) «Es ist sehr naheliegend, dann zu sagen: ‹Ja, ja, für Mönche ist es leichter, aber für uns im normalen Alltag: Wie macht man das?›
Da muss man zunächst sagen: ‹Vollkommen richtig, darum wird man ja Mönch, weil man den leichtesten Weg sucht.›
Unser Abt hat uns immer als junge Mönche gesagt: ‹Bildet euch nicht ein, dass ihr besser seid wie die Andern. Ihr braucht diesen Rahmen, um das zu machen, was die Andern unter sehr schwierigen Umständen machen müssen.›
Aber letztlich ist es doch die Aufgabe jedes Menschen, dankbar zu leben.
Das heißt, im Jetzt zu leben, und das heißt, sein Selbst zu finden.
Das große Argument vieler Menschen ist: ‹Wir haben keine Zeit! Ihr habt als Mönche alle Zeit, die ihr braucht, aber wir als Mütter, die für die Kinder sorgen müssen und Väter, die in die Arbeit gehen oder Mütter, die noch dazu in die Arbeit gehen müssen. Wir haben keine Zeit.›
Und das muss man mit viel Mitgefühl anschauen. Da ist schon sehr viel dran. Aber in dieser schwierigen Situation ‒ gerade in dieser schwierigen Situation ‒ ist dankbar leben eine enorme Hilfe, weil man dadurch über diesen Zeitdruck hinauskommt.
Und zwar dankbar leben heißt ja, diesen Augenblick ‒ der ist mir jetzt geschenkt: Was ist mir jetzt geschenkt?
Was schenkt mir das Leben für Gelegenheit in diesem Augenblick?
Gelegenheit, mich zu freuen ‒ meistens ‒, Gelegenheit, etwas zu lernen: das kann sehr schwierig sein, Gelegenheit zu wachsen: das kann auch schwierig sein, Gelegenheit zu protestieren gegen etwas, was nicht so sein soll.
Das sind alles schwierige Situationen, aber das Leben schenkt mir jetzt, in diesem Augenblick, diese Gelegenheit, und ich habe nicht genug Energie, um sie auf etwas Anderes zu verschwenden. Ich muss sie auf diesen Augenblick einstellen. Das gilt für jeden Menschen in jeder Situation.
Und wenn ich jetzt aber zu sehr an die Vergangenheit denke, besessen bin davon, wieviel schöner die Vergangenheit war, oder mich als Opfer der Vergangenheit fühle und das immer wieder hereinbringe, oder: Wenn ich mir schon voraus bin und gar nicht warten kann auf die Zukunft, oder ständig befürchte: Was kommt da jetzt auf mich zu in der Zukunft?
Das sind alles Formen des in der Zeit Steckenbleibens, in der Vergangenheit, in der Zukunft Steckenbleiben, und daraus entspringt das: Keine Zeit haben. Weil noch etwas auf mich wartet:
Im Augenblick wartet nichts.
Nur die Gegenwart wartet mir entgegen, sonst wartet nichts auf mich.
Und sich darauf einzustellen, darauf einzulassen, das ist auch Menschen unter großem Zeitdruck ‒ was wir Zeitdruck nennen ‒ möglich, und nicht nur möglich, es ist die einzige Lösung für großen Zeitdruck.
Und Menschen, die Stellungen ausfüllen müssen, Rollen spielen müssen, in denen sie ständig unter dem sogenannten Zeitdruck stehen und die das wirklich gut machen, denen sieht man es ja an, wie sie’s machen: Sie nehmen eins nach dem andern.
Was jetzt, im Augenblick die Gelegenheit ist, die von mir eine Antwort verlangt, dem wird geantwortet. Alles Übrige muss warten und wird im nächsten Augenblick …, wenn seine Zeit kommt.
Das sind große Vorbilder, solche Menschen, und das sind gewöhnlich sehr beschäftigte und sehr kreative Menschen.
Aber die Andern, die unter diesem Zeitdruck zusammenbrechen, denen fehlt eben genau das: im Augenblick sein.»
(20:10) «Wie schaut die Welt des Selbst aus? ‒ Genau das Gegenteil:
Die Welt des Selbst ist zunächst furchtlos.
Also man kann das von jeder Perspektive, die wir schon angesprochen haben, ansehen: Wenn wir im Jetzt leben, wenn wir dankbar leben, das heißt, die Gelegenheit dieses Augenblickes wahrnehmen und darauf antworten, dann sind wir über die Zeit erhaben, dann sind wir im Jetzt.
Und wenn wir also in diesem Jetzt sind, dann haben wir keine Furcht. Das ist das Entscheidende.
Furcht ist ein sehr wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang: Das Ego fürchtet sich ständig. Und das ist etwas anderes wie Angst.
Angst ist unvermeidlich im Leben. Jeder Mensch hat immer wieder Angst.
Das heißt: Angst hängt zusammen mit dem Wort Enge:
Wir kommen immer wieder in die Enge, wir kommen sogar schon in die Welt durch die Enge des Geburtskanals ‒ das ist unsere Urangst ‒, aber wir kommen furchtlos, denn wir haben den Instinkt, uns aufs Leben zu verlassen und durchzugehen. So kommen wir ins Leben.
Und immer wieder, wenn wir in die Enge kommen und furchtlos durch diese Angst durchgehen ‒ ‹ja, ich habe Angst, aber ich fürchte mich nicht› ‒, dann kommt eine neue Geburt.
Was heißt: ‹Ich fürchte mich?› Es heißt: ‹Ich sträube mich.›
Das ist das Gegenteil von Mut.
Mut hat auch Angst. Wenn man keine Angst hat, kann man auch keinen Mut zeigen. Das hängt damit zusammen. Nur, der wirklich Angst hat, kann sich trotzdem mutig erweisen.
Aber mutig erweisen wir uns, indem wir uns nicht gegen das sträuben, was uns Angst macht, sondern es aushalten ‒ durchgehen ‒, mit dem Leben durchgehen.
Und wenn wir das tun, dann ergibt sich aus dieser Furchtlosigkeit genau das Gegenteil, was sich aus der Furcht des Ego ergibt, nämlich zunächst Gewaltfreiheit ‒ Gewalt entspringt der Furcht ‒, kein Konkurrenzkampf, sondern eher Zusammenarbeit: nicht Rivalität, sondern Zusammenarbeit, und keine Habgier, sondern Teilen.
Also Gewaltfreiheit, Zusammenarbeit und Teilen.
Das ist, was die Welt des Selbst charakterisiert. Und das ist, was wir uns ersehnen. Das ist etwas ganz anderes.
(23:29) Wir leben in einer Gesellschaft, die eben durch das Ego geprägt ist, und die daher eine Art Pyramide ist. Der Stärkste ‒ zugleich auch wahrscheinlich der, der am meisten Furcht hat, das macht ihn so aggressiv ‒, ich sage ihn, das ist eine sehr männliche Haltung, aber es kann auch Frauen passieren:
Wer am meisten Angst hat, der kommt am höchsten hinauf, weil er die Andern am stärksten tritt. Und da baut sich diese Pyramide auf und jeder ‒ auf jeder Schicht ‒, buckelt nach oben und tritt nach unten, wie ein Radfahrer.
So baut sich diese Machtpyramide auf.
Das Gegenteil ist eine Welt, nicht der Pyramide, sondern der Vernetzung.
Eine Vernetzung, etwas Horizontales, eine vernetzte Gemeinschaft: Idealerweise kennt jeder jeden, das muss ein kleines Netz sein. Und eine Welt, die ein Netzwerk aus kleinen Netzwerken ist, das ist auch das Ideal, dem wir nachstreben dürfen für die Zukunft.
Die Machtpyramide ist ja in unserer Zeit ‒ und das charakterisiert unsere Zeit ‒ im Zusammenbrechen.
Besonders die, die an der Spitze stehen, sagen: ‹So kann’s nicht weitergehen.›
Wir haben einen Endpunkt erreicht.
Ob das jetzt in der Wirtschaft ist oder in der Politik: Auf vielen Gebieten, wo diese Machtpyramide so betont wird: sie bricht vor unsern Augen zusammen.
Und Raimundo Panikkar, ein ganz großer Denker des 20. Jahrhunderts, hat gesagt:
‹Wir sollen die Zukunft nicht in einem neuen Turm von Babel suchen, wieder so einen Turm bauen und bis zum Himmel kommen, sondern in wohlausgetretenen Pfaden von Haus zu Haus.›
Das ist die Zukunft, das ersehnen wir uns: ‹wohlausgetretene Pfade von Haus zu Haus.›
Und das ist die Welt des Selbst, wo wir alle zusammengehören, obwohl wir ‒ und gerade darum ‒ unsere individuelle Selbständigkeit und Einzigartigkeit betonen dürfen und können. Und auch geschätzt werden von den Andern, was wir für Begabungen haben:
Diese gegenseitige Wertschätzung, die gehört auch dazu ‒ für das Ich −, weil wir eben alle zusammen sind, und weil wir letztlich halt doch nur das eine Selbst sind, das so viele verschiedenen Rollen spielt.
Und da schaut man sich dann den Andern an: ‹Ich spiele auch nur eine Rolle, der Andere spielt auch seine Rolle.›
Wir müssen nun versuchen, unsere Rollen so gut wie möglich zu spielen.»
(26:47) «An dem Beispiel der Flüchtlinge und der Flüchtlingskrise, in der wir leben, zeigt sich eigentlich recht schön, wie das im Praktischen ausschaut:
Aus der Furcht ‒ Furcht vor den Andern: Fremdenfurcht und Furcht, wir können es nicht bewältigen ‒ das ist ja auch eine Furcht ‒, sträubt man sich.
Die Angst ‒ ‹Wie sollen wir mit so vielen auskommen, wie können wir das lösen?› ‒ diese Angst ist ganz verständlich, die sollten wir auch anerkennen.
Und zu behaupten: ‹Ich habe keine Angst›: Das ist auch nur eine Form, sich gegen die Angst zu sträuben, das ist auch Furcht.
Aber zuzugeben: ‹Ja, das ist wirklich beängstigend›, und dann zu sagen:
‹Aber das Leben hat uns in diese Situation gebracht, das Leben wird uns auch schöpferische Wege zeigen, mit dieser Situation umzugehen›:
Das ist schon der Ansatzpunkt, das ist schon ein ganz anderer Ansatzpunkt, der Kreativität erlaubt.
Es heißt noch nicht: ‹Ich weiß schon, was man da machen muss ‒, ich habe schon alles ausgedacht› ‒
‹Keine Ahnung, ich habe sogar Angst, dass mir gar nichts einfallen wird. Aber ich vertraue, ich sträube mich nicht. Diese Situation ist gegeben. Ich baue keine Zäune, das ist das Sträuben. Ich setze mich damit auseinander und gemeinsam werden wir irgendeine Lösung finden.›
Man braucht noch nicht das Rezept zu haben, man muss nur die Haltung haben, aus der sich früher oder später die Lösung entwickelt.
Vielleicht ganz ohne Rezept sich einfach entwickelt, weil man gewisse Grundsätze, zum Beispiel Ehrfurcht vor dem Andern: Das ist ja nicht nur Nummer 50364 von den Flüchtlingen, das ist ein Mensch mit einem ganz eigenen Schicksal ‒, dem trete ich ehrfürchtig entgegen und versuche gemeinsam:
‹Was können wir da machen?›
Und wenn genügend Leute fragen: ‹Was können wir da machen?› ‒ das ist schon ein Weg auf eine Lösung hin, wenn genügend Leute fragen.
… Aber das Gegenteil ist, zu sagen: ‹Abschließen, Mauern, Zäune, niemanden mehr hereinlassen› …
Das ist ganz ein anderer Ansatz. Und dieser kreative Ansatz entspringt dem Bewusstsein:
Wir sind ein Selbst, das viele, viele verschiedene Rollen spielt, aber es ist das eine Selbst und es wird schon etwas herauskommen, wenn wir unsere Rolle gut spielen: Der Flüchtling spielt die Flüchtlingsrolle, der Helfer spielt die Helferrolle. Der Zuschauer spielt die Zuschauerrolle. Wir müssen unsere Rollen gut spielen.»
(30:10) «Dieses Stichwort Heimat für das Selbst, das ist schon ein sehr schönes Wort. Das gefällt mir sehr gut. Besonders, weil die Gedanken an das Selbst ja auch eine wichtige Rolle spielen, wenn das Ich, das eben in Raum und Zeit begrenzt ist, ans Ende kommt.
Also ich lebe in diesem Doppelbereich, aber ein Teil dieses Doppelbereichs kommt ans Ende und war vor gar nicht langer Zeit nicht und wird in gar nicht langer Zeit nicht mehr da sein.
Was also zu dem Doppelbereich gehört an meiner leiblichen Existenz und alles, was mit Raum und Zeit zusammenhängt, ist zeitlich begrenzt.
Und da ergreift uns dann auch wieder zugegebenermaßen die Angst: ‹Was ist dann? Ist dann alles aus?›
Das wäre vielleicht nicht einmal das Ärgste, aber meine Beziehungen, meine Lieben, die Menschen: ‹Bin ich von denen dann getrennt oder finde ich sie wieder?›
Da hilft dieser Gedankengang vom Selbst sehr, weil:
Alle die Menschen, die mir in meinem Leben lieb waren, sind Ausdruck dieses einen Selbst.
Das Selbst ‒ haben wir schon gesehen ‒, ist über Raum und Zeit erhaben.
Und wenn meine Zeit zu Ende ist, dann bleibt das Jetzt.
Das Jetzt ist nicht in der Zeit.
In diesem Jetzt ist das Selbst mit allen, in denen sich dieses Selbst ausgedrückt hat. Also wir sind verbunden.
Vorstellen können wir uns das nicht, weil unsere Vorstellung jetzt, in diesem Leben, von Raum und Zeit abhängt. Wir können nur in raumzeitlichen Begriffen und Bildern denken.
Wir können es uns nicht genau vorstellen, aber wir können uns schon vernünftigerweise daran heranarbeiten:
‹Ich lebe ja schon jetzt in diesem Doppelbereich auch zugleich in der Ewigkeit, in dem, was über die Zeit hinausgeht. Und wenn dann meine Zeit um ist, bleibt all das. Und jeder Augenblick nimmt an der Ewigkeit teil.›
Zum Beispiel in der christlichen Tradition spricht man von der Auferstehung des Fleisches oder der Auferstehung der Toten ‒ eigentlich Auferstehung des Fleisches ‒, das ist viel weiter gefasst, das heißt: das überzeitliche Leben von allem, was vergänglich ist.
Bergengruen, der Dichter, sagt ja: ‹Weil nichts vergänglicher ist als die Vergänglichkeit.›
Die Vergänglichkeit, also Zeit vergeht, aber in der Zeit, in unsern besten Augenblicken, in unsern innigsten Beziehungen haben wir etwas erlebt, was im Jetzt war, was über die Zeit hinausgeht.
Besonders in ganz großen Augenblicken unseres Lebens sind wir uns ja irgendwie bewusst: ‹Die Zeit steht still›, sagen wir oder so ‒ für Liebende steht die Zeit still ‒, das gehört zum Überzeitlichen:
‹Warum soll das verloren gehen, weil meine kleine Zeitspanne hier um ist?›
Das gehört zum großen Jetzt. Und ist unverlierbar. ‒
Das kann tröstlich sein.»
(34:44) «Mein innigster persönlicher Wunsch ist eigentlich, inmitten aller Angst die Furcht in mir selber zu überwinden und andern Menschen zu helfen, sich nicht zu fürchten.
Denn alles, was schief geht, entspringt dieser Furcht. Und wenn man zu Menschen freundlich ist – richtig freundlich sein –, dann nimmt man ihnen irgendwie die Furcht weg.
Die Angst kann man niemandem wegnehmen, nur die Furcht:
‹Sträube dich nicht!›
Und darum kommt es mir sehr viel drauf an, freundlich zu sein.
Ich hoffe immer, wenn ich in der Früh die Augen aufschlage, dass ich heute einmal Gelegenheit habe, wirklich jemandem was recht Liebes zu tun, was die freut.
Und wenn wir uns freuen, bricht dieser Sträube-Mechanismus irgendwie zusammen und dann fürchten wir uns nicht.
Das ist schon der wichtigste Satz:
‹Fürchte dich nicht!›
Und den möchte ich selber verwirklichen und Andern dazu helfen.»
________________
[1] «... wie eine chinesische Vase
Regungslos und dennoch in sich unendlich bewegt ist.
Nicht das Schweigen der Geige, solange der Ton noch schwingt,
Nicht dies nur, sondern vielmehr ihr Zugleich-Sein,
Und, sagen wir, dass das Ende dem Anfang vorangeht,
Dass Ende und Anfang bestehen von jeher
Noch vor dem Anfang und noch nach dem Ende.
Dass alles immer jetzt ist. ...»
«The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
Not the stillness of the violin, while the note lasts
Not that only, but the co-existence,
Or say that the end precedes the beginning,
And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.›
And all is always now.»
T. S. Eliot: «Four Quartets»: «Burnt Norton», V, Quelle: FN 1) 113; 2-5) 115; 6) 115f.
[2] Kennen Sie
«… den Augenblick in und außer der Zeit,
Den Wachtraum, verloren im Sonnenstrahl,
Den ungesehenen Thymian, das Wetterleuchten im Winter,
Den Wasserfall oder Musik, die so innig gehört wird,
Dass du sie nicht mehr hörst, weil du selbst die Musik bist,
Solange sie forttönt.»
… the moment in and out of time
The distraction fit, lost in a shaft of sunlight
The wild thyme unseen or the winter lightning,
Or the waterfall, or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.
T. S. Eliot: «Four Quartets»: «The Dry Salvages», V, Quelle: AH 1-2) 122; 3-5) 119
[3] Der Doppelbereich Tod ‒ Leben, Ich ‒ Selbst, Zeit ‒ Ewigkeit und Doppelbereich Ich-Selbst