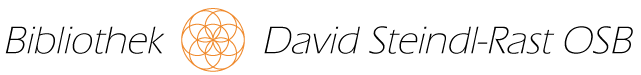Von Beate Kortendieck-Rasche
Das Leben wird uns gegeben
In einem bestimmten Leib
In einer Familie
In einer Zeit
Und das Leben wird wieder zurückgenommen
Es ist nicht die Zeit zu hadern
Kostbar ist jeder Augenblick
Ungefähr 14 Jahre war ich, als ich das erste Mal fühlte und verstand, dass auch ich irgendwann sterben würde. Ich erinnere mich noch gut, wie ich als Mädchen voller Schrecken und Verzweiflung vor dem großen Spiegel in unserem Badezimmer stand, mein junges Gesicht betrachtete, und wie ich versuchte, mir vorzustellen, dass es mich einfach irgendwann nicht mehr geben würde. Wie würde sich das anfühlen? Wie sollte das sein? Fast körperlich stürzte ich ins Nichts. Über meine Angst konnte ich mit keinem der Erwachsenen sprechen. Das Wissen ‒ oder auch Unwissen ‒ um den Tod hatte mich erreicht. Und beschäftigte mich.
Es folgten Jahre, in denen ich mich immer wieder von diesem Schrecken ergreifen ließ, manchmal mitten in einem Fest meiner Eltern, manchmal beim Lesen eines Buches oder auch beim Einschlafen. Mit Herzklopfen sprang ich dann auf und schaute in einen Spiegel: Was ist es denn, tot zu sein? Doch der Spiegel zeigte mir nur mein Gesicht.
Krankheit und Tod waren Thema seit meiner frühen Kindheit. Wegen einer Hüftgelenkserkrankung war ich schon als sehr kleines Kind häufig im Krankenhaus, getrennt von den Eltern, in einer fremden, Angst auslösenden Umgebung. Lange Zeit konnte ich nicht laufen. Krank waren auch meine Großeltern, meine Großmutter war gelähmt! Beide lebten mit uns im gleichen Haushalt und wurden gepflegt bis zu ihrem Tod.
Mein Kinderglaube, dass man nach dem Tod in den Himmel komme, war inzwischen brüchig geworden und die Eltern vermittelten zu diesem Thema auch eher Angst und Ratlosigkeit. Vielleicht waren die Kriegsjahre für sie noch zu nahe, sie wollten leben, nachholen, was sie entbehrt hatten, und vergessen. So wichen sie meinen fragenden Augen aus. Viele Jahre blieb ich mit meiner Angst alleine. Die Panikgefühle kamen seltener und ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass man als alter, kranker Mensch vielleicht auch leichter stirbt.
Es kamen die Studentenjahre, die Studentenbewegung, ich studierte Medizin und wurde Frauenärztin. Fragen nach Spiritualität, Transzendenz oder Glauben beschäftigten mich damals nicht. Wir wollten hier und jetzt Veränderung. Wir konfrontierten uns mit den Schreckensbildern des Holocaust, mit der Schuld unserer Eltern, dem Grauen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges und des Vietnam-Krieges, der Armut in Afrika und Indien. Ich wollte möglichst viel lernen und wissen, um besser zu verstehen. Niemals wollte ich auf der Seite der Täter stehen. Ich erinnere mich an Gefühle von Traurigkeit und Auflehnung, Wut über die Situation unserer Erde, aber auch an Stolz und die Gewissheit als politisch bewusster Mensch zu handeln und an einer neuen Welt mitzubauen.
An das Gefühl von Dankbarkeit erinnere ich mich nicht. Dankbarkeit für diese beschädigte Welt? Für dieses beschädigte Leben? Dankbarkeit für ein Leben voller Ungerechtigkeit und Leid, an dessen Ende dann auch noch der Tod steht?
Dann wurde ich schwanger. Es war kein geplantes Kind, aber ein tief erwünschtes Kind von dem Mann, den ich liebte. Ich erlebte es als ein Geschenk des Lebens an mich. Außer zu lieben, mich immer wieder zu öffnen, hatte ich nichts zu diesem Wunder des Lebens beigetragen, das sich nun in mir entfaltete. Ich brauchte nur Ja sagen, Ja zu einem geschenkten Leben, Ja zu dem Wagnis des Mutterwerdens und des Elternwerdens. Es war zu dem Zeitpunkt in meinem Leben eigentlich alles ungewiss. Aber trotz der Ängste und Ambivalenzen war da auch immer wieder eine unsägliche Freude und Erwartung, wenn ich das Kind in mir spürte. Mein Mann und ich (damals waren wir noch nicht verheiratet) feierten das erste Mal gemeinsam Weihnachten mit dem ersten Christbaum nach vielen baumlosen Studentenjahren. Es war auch in der Zeit, dass ich die alten Bilder von Maria Verkündigung, Christgeburt und der Pietà wiederentdeckte. Sie beschäftigten und bewegten mich tief, wie sie es schon in meiner Kindheit getan hatten.
Im Februar war es dann so weit, mit Wehen kündigte sich die Geburt an. Ich habe unseren Sohn zu Hause geboren, nach vielen Stunden von Wehen und Warten, Schmerzen, manchmal Verzagen und Ungewissheit, aber auch Vertrauen und Hingabe, ein Erleben von Ermutigung und großer Liebe. Unser Kind konnte in dem Moment geboren werden, als ich tief in mir beschlossen hatte, loszulassen ‒ was so einfach scheint und doch so schwer ist.
Als dieses kleine Neugeborene auf mir in unseren Armen lag, habe ich tiefste Dankbarkeit erlebt ‒ und auch das Gefühl des Geheiltseins. Ich wusste plötzlich: Mit dieser Erfahrung kann ich auch irgendwann sterben.
Dankbar war ich für dieses kleine, wunderbare Kind, dass ich es hatte bergen dürfen und jetzt loslassen konnte, dankbar für die Liebe und Zuversicht meines Mannes, dankbar für die Hilfe meiner Hebamme und meiner Freundinnen und Freunde. Gleichzeitig mit dieser Dankbarkeit stellte sich aber noch ein anderes Gefühl ein, das Bedürfnis, das Kind in die Kirche zu tragen und taufen zu lassen.
Auch die Geburten meiner anderen beiden Kinder habe ich als ein sehr körperliches Geschehen erlebt, das gleichzeitig mit spiritueller Tiefe verbunden war.
Doch die Geburt ist ja nur der Anfang des Mutterseins. Das Leben schenkt uns die Kinder und wir schenken ihnen das Leben durch die Weise, wie wir mit ihnen leben und sie lieben.
Vor einigen Monaten erkrankte ich schwer, und das Thema Abschied und Tod trat plötzlich sehr deutlich in mein Leben. In dieser Situation hatte ich folgenden Traum: Ich war in einer Grabkapelle und wollte meiner Tochter den verstorbenen Großvater (meinen Vater) zeigen, damit sie sich von ihm verabschieden könne. Die Sargträger sollten dazu den Sarg auf einen großen dunklen Stein in der Kapelle stellen. Aber als ich mit meiner Tochter zu dem Stein trat, stand auf dem Stein ein Kinderwagen mit einem kleinen Baby.
Der Traum hat mich bewegt. So ist wohl das Sterben ein Abschiednehmen zu etwas Neuem. Dankbarkeit erfüllt mich, wenn ich an diesen Traum denke.
Dankbarkeit erfüllt mich auch, wenn ich an die Begegnung mit Bruder David denke. Er ist der Mensch gewesen, der mir das Evangelium in eine Sprache übersetzt hat, der ich mich öffnen konnte und die mich erreichte. Er hat mir vermittelt, dass die Wege von Martha und Maria gleich viel wert und gleich wichtig sind. Dass jeder nur einen Teilaspekt leben kann, dass wir aber in unserer Verbundenheit das Ganze herstellen. Er lebt ebenso das Leben des Mönches für mich, wie ich für ihn das Leben einer Mutter und liebenden Frau. Wir sollen das Leben in diesem Leib und seiner Endlichkeit wohl auch als einen Teilaspekt der Ganzheit begreifen und annehmen können.
Ein Gedicht von Bruder David hilft meinem Verständnis:
Beim langsam wiegenden Tanz
Sah ich Dich tanzen,
mir gegenüber,
obwohl Du nicht da warst.
Nicht da?
Oder nur, wie manchmal
Ein Stern, den wir
Gespiegelt sehen im Teich?
Was heißt schon da sein?
Tanzt nicht alles mit allem?
Quelle: Die Augen meiner Augen sind geöffnet – Hommage an Br. David-Steindl-Rast OSB zu seinem 80. Geburtstag, S. 120-123
© Beate Kortendieck-Rasche (2006)
Beate Kortendieck-Rasche, *1949, Medizinstudium und Ausbildung in Marburg und Berlin, arbeitet als niedergelassene Frauenärzin in Berlin mit Schwerpunkt Psychosomatik, Sexualberatung und Paarberatung. Lebt in Berlin.