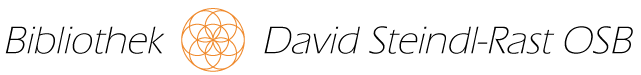Beten – mit dem Herzen horchen (1988)
Vortrag von Bruder David in der Fragerunde «Rechtgläubigkeit und Mystik»
Mitschrift bearbeitet von Hans Businger
Teil I
00:00 Dogmatische Kämpfe vom mystischen Erleben her verstehen
Bruder David: «Die Frage ist im Zusammenhang mit meiner Gegenüberstellung von dem Glauben und den Glaubensüberzeugungen, von der ich gesagt habe, sie gehören zusammen — sie dürfen nicht getrennt werden, aber sie müssen klar unterschieden werden:
Wie sehen wir in dem Zusammenhang jetzt Jahrhunderte der Kirchengeschichte, besonders die ersten Jahrhunderte, in denen es so weitgehend um Glaubensüberzeugungen geht, bis der Glaube an den dreieinigen Gott und an Christus, die ganze Christologie, herausgehämmert wird, und manchmal herausgehämmert mit Waffengewalt und sich gegenseitig auf den Kopf hämmernd?
Wie sehen wir das?
Ich glaube, wir sehen es falsch, wenn wir es aus der tiefsten Überzeugung herauslösen, das worauf es letztlich ankommt, der Glaube ist.
Wenn auch da Gegensätze waren zwischen den verschiedenen Strömungen in der Kirche, und dann schließlich zwischen der Kirche, die sich herauskristallisiert hat, und denen, die sich abgespalten haben — auch wenn diese Gegensätze da waren:
Was allen gemeinsam war und was wir nicht übersehen dürfen, nicht vergessen dürfen, ist, dass worauf es letztlich ankommt, der tiefste Glaube ist.
Aber, worum es in der Ausformung der Glaubensbekenntnisse geht, ist der Ausdruck — und ein immer nicht ganz völlig gelungener Ausdruck, das muss man auch sagen — es ist ein Aussprechen des Unaussprechlichen, um was es da geht, dessen waren sich auch alle bewusst:
Es geht darum, dass die tiefsten Erkenntnisse des Herzens auszusprechen sind, genau das, worum wir uns heute bemüht haben.
Wenn wir an diese Glaubensstreitigkeiten und die Glaubensentwicklung der ersten Jahrhunderte nur so von außen herangehen, nur so geschichtlich, und sehen dabei nur eine Folge von Strömungen, bei denen eine aus oft sehr politischen Gründen
gewonnen hat und eine andere unterlegen ist, dann bleibt das völlig an der Oberfläche.
Wir müssen uns fragen: Worauf haben sich diese Menschen gestützt?
Ja, sie haben sich auf die Schrift gestützt, aber nicht auf die Schrift als einem toten Buchstaben, der dort steht: Aus der Schrift als einen toten Buchstaben kann man viel Widersprüchliches herauslesen: Und daher auch diese Glaubensstreitigkeiten.
Worauf sie sich wirklich gestützt haben, war ihr mystisches Erleben, ihr Christus Erleben, genau das, wovon wir auch heute gesprochen haben, und das hat sich als Ergebnis eines mühsamen Ringens in den Glaubenssätzen ausgesprochen:
Zum Beispiel gegen alle gnostischen Tendenzen — das ist heute wieder sehr spruchreif: Die Gnostiker haben den Leib und den Geist — das war eines der wichtigen Merkmale dieser ganzen Bewegung, die man Gnostik genannt hat: Sie haben den Leib und den Geist völlig polarisiert — ‘geistig‘ oder ‚leiblich‘—, soweit das manchmal so ausgedrückt wurde, dass der Widersacher, der Teufel, die Leiber baut und die Seelen darin fängt — die werden dann von Christus befreit, oder so etwas —, und dagegen hat sich zum Beispiel die orthodoxe Kirche ausdrücklich ausgesprochen, dass eben wir eins sind, und dass Christus im Fleisch gekommen ist.
Und schon das Johannesevangelium beginnt sich gegen diese gnostischen Einstellungen auszusprechen — ausdrücklich in dieser Richtung formuliert zu sein, dass also:
Leib und Seele — ‚Was er angenommen hat, das hat er erlöst‘,
Christus ist: ‚Wahrer Mensch und wahrer Gott‘:
Das wäre so ein Punkt, aber das Wichtige daran ist, zu fragen:
Worauf haben sich die Kirchenväter, die unsere Lehrsätze formuliert haben, gestützt?
Ja, sie haben sich auf die Schrift gestützt, weil sich auch ihre Gegner auf die Schrift gestützt haben. Auf was haben sie sich sonst noch gestützt? —
Auf ihr mystisches Erleben! Sonst wäre uns das nicht nachvollziehbar.
Das ist nicht etwas, was so in der Luft hängt, das ist nicht etwas, was vom Himmel heruntergefallen ist, das ist etwas, was Menschen in der Nachfolge Christi, die ja mit dem Herzen — das schließt den Verstand ein und den Willen und die Gefühle —, völlig durchgearbeitet haben, und manchmal nicht nur die Theologen, nicht nur die Bischöfe:
Der Arianismus zum Beispiel: Die ganze Welt, die Mehrzahl der Bischöfe waren Arianer zur Zeit der Hochblüte des Arianismus, und es war das christliche Volk, das den christlichen Glauben festgehalten hat.
Das ist für uns heutzutage sehr wichtig, dass jeder Einzelne von uns verantwortlich ist für den Glauben und nicht nur für das, was im Katechismus steht.
Viele Leute haben den Katechismus gelesen oder gelernt, und haben keinerlei Beziehung mehr zum Christentum.
Für wen ist das Christentum lebendig?
Für alle jene, denen es möglich war, die Lehren der Kirche mit ihrem Erleben zu verbinden.
Auf das Erleben kommt es an: Was nicht aus dem Erleben stammt und zum erlebten Erleben führt, ist tot!»
06:02 Liebe statt Rechtgläubigkeit — Das Jüngste Gericht (Mt 25,31-46)
Ein Teilnehmer: «Worauf es ankommt, ist die Liebe!»
Bruder David: «Ich hab dem kaum etwas hinzuzufügen: Wonach wir gerichtet werden — im 25. Kp. von Matthäus — ist unsere Liebe: Unsere Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, nicht unsere Rechtgläubigkeit!
Und das interessante ist dort noch, dass die, die also nicht richtig gehandelt haben, die sind, die ja Christus gekannt haben.
Denn die Szene ist die: Jesus sagt: ‚Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank und ihr habt mir nicht geholfen‘ usw. Und die einen sagen: ‚Wann haben wir dich krank gesehen?‘ Das heißt: ‚Wir kennen dich ja, und wir haben dich nie krank gesehen‘. Und die sind es, die fehl gegangen sind.
Die anderen, denen der Richter hier sagt: ‚Ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist‘, sagen: ‚Wann haben wir dich gesehen? — Wir kennen dich ja gar nicht.‘
So die, die ihn so gar nicht kennen, sind die, die am Ende gerechtfertigt werden in der Geschichte als die, die sich richtig verhalten haben.
Und die, die ihn gekannt haben, haben ihn nicht erkannt. Das ist noch ein Schritt weiter hinein in diese Problematik. Das ist ein ungeheuer wichtiges Kapitel.»
07:37 Mystik in einer Kirche, die sich auf die Lehre versteift?
Ein Teilnehmer: «War es nicht ein Fehler der Kirche, dass sie sich auf Dogmatik und auf Scholastik versteift hat und die Mystik dabei zu kurz kommen ließ?»
Bruder David: «Wenn man einen geschichtlichen Überblick macht, legt vieles dieses Urteil nahe. Ich würde das schon sagen.
Andererseits richtig verstanden, war die Mystik immer da, und wenn Sie sich an ihre Großmütter erinnern, und an alte, einfache Leute in den Bergen, die ihren Rosenkranz gebetet haben und ihren Angelus, wenn die Glocken geläutet haben, und die am Sonntag in die Kirche gegangen sind und zu den Maiandachten:
Da ist eine so tiefe Mystik unter Umständen drin, eine so tiefe Verbundenheit mit Gott, erlebnismäßige Verbundenheit mit Gott, dass wir mit all unseren ganzen mystischen Erlebnissen denen nicht einmal das Wasser reichen können — unter Umständen:
Es ist nicht damit gegeben, aber irgendeiner Religion, inklusive des Christentums, wirklich das religiöse Leben, das heißt das mystische Leben, abzusprechen, das wäre falsch.
Aber Sie haben vollkommen recht: Geschichtlich gesehen ist das Schwergewicht immer auf die Rechtgläubigkeit gefallen, anstatt auf das rechte Leben aus dem Geist heraus.»
Und deshalb müssten wir als die Neuerer innerhalb der Kirche — wenn wir noch in der Kirche stehen —, uns auf das Älteste besinnen, und das ist wieder das Mystische, und das trifft sich mit dem Neuen ganz.»
09:21 Mystische Phänomene im Unterschied zu Mystik
Bruder David zu einer Teilnehmerin: «Sie haben ausdrücklich über Mystik gefragt und da möchte ich sagen, wenn ich über Mystik hier spreche, ich nicht irgendwelche Phänomene im Auge habe, die oft mit der Mystik Hand in Hand gehen und oft so als besonders betont werden, wenn man von Mystik spricht.
Das ist mir hier wichtig: Mystik ist etwas, was keiner von uns sich absprechen lassen darf, Mystik ist das tiefste Erleben unseres Herzens von der Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen, das ist das Mystische.
Alles Drum und Dran: Elevation und an zwei Orten zugleich sein und in Sprachen sprechen und alle diese Erscheinungen usw., das kann oder kann nicht dabei sein, und kann sogar davon getrennt vorkommen. Das sind Phänomene, die wir heutzutage noch nicht völlig verstehen, und die mit dem Mystischen als solchem nicht ausdrücklich zu tun haben.
Die Mystiker sind die Ersten, die das immer wieder betonen und die Kirche hat das immer wieder betont.»
10:27 Pantheismus: Zustimmung und Abgrenzung.
Die Frage war: «Ja, ich habe diese Einstellung, von der Sie da gesprochen haben, öfters ganz spontan, aber dann fürchte ich mich immer, das kommt mir immer so wie Pantheismus vor».
Bruder David: «Wo stehen wir in Hinblick auf den Pantheismus?
Ich glaube, man kann mit Recht sagen: Dass unter allen Religionen der Erde das Christentum dem Pantheismus so nahe kommt, wie man nur überhaupt nahe kommen kann, ohne Pantheist zu sein.
Also: Alles ist da, was sich der Pantheismus nur erträumen kann, mit einem Unterschied: Und das ist die Dankbarkeit:
Denn im klassischen Pantheismus, und die Frage ist — es ist eine ganz berechtigte Frage unter Religionsphilosophen —, ob es überhaupt je einen klassischen Pantheisten gegeben hat. Es ist eine große Frage, denn man kann nicht eigentlich religiös und Pantheist sein im klassischen Sinn, so dass auch die Leute, die sich für Pantheisten halten, vielleicht gar nicht klassisch Pantheisten sind, sondern zutiefst religiös.
Der Unterschied ist der: Im klassischen Pantheismus fließt die Welt und wir und alles, was ist, unweigerlich aus Gott sozusagen. Gott kann sich gar nicht helfen, wenn man das so ausdrücken will. Es ist nur so eine Ausstrahlung von Gott. Alles ist Gott — nicht wahr? Dann bin ich einfach Gott.
Das entspricht aber unserem religiösen Erleben gar nicht.
Das Herz des religiösen Erlebens ist unsere Dankbarkeit.
Und ‚dankbar‘ ist etwas, was wir nicht uns selber sein können. Sie können sehr freundlich zu sich sein und sich alles gönnen, aber wenn sie nach Hause kommen, nachdem sie sich alles gegönnt haben, können sie nicht sich selber danken dafür. Das ist einfach Akrobatik, die unserem Geist nicht möglich ist.
Dankbarkeit richtet sich immer auf einen anderen, aber auf einen anderen, dem wir so tief verbunden sind — und je tiefer wir dem anderen verbunden sind: ein Herz und eine Seele —, umso dankbarer sind wir.
Das schließt gar nicht aus, dass Gott uns näher ist als wir uns selber sind.
Aber die Dankbarkeit ist der kleine Unterschied zwischen echter Religiosität und einem einfach philosophischen Pantheismus, der sich religiös nicht nachvollziehen lässt.
Und darum kann man sagen:
Wenn ‚das Wort Fleisch geworden ist‘, wenn wir Gott mit unseren Sinnen erfassen können, — und das schließt schon die erste Seite vom 1. Johannesbrief, eine ganz wichtige Stelle im Neuen Testament ein:
‚Den wir angefasst haben, den unsere eigenen Augen gesehen haben, was wir berührt haben, was wir mit unseren Sinnen erfahren haben vom ewigen Wort Gottes, von dem sprechen wir, nicht von irgendwelchen Überlegungen, so dass unsere Freude allen zuteilwerde‘ (1 Joh 1,1-4).
Also: Pantheismus: Keine Angst!
Solange wir Angst haben vor dem Pantheismus, brauchen wir keine Angst davor zu haben — so kann man es auch ausdrücken.
Solange wir dankbar sind, wenn es auch jemand anderen vielleicht pantheistisch erscheint: Es ist nur umso christlicher, wenn wir glauben, dass ‚das Wort Fleisch geworden ist‘ (Joh 1,14), dann übertrifft das alles, was der Pantheismus überhaupt sich nur erträumen kann.»
Jemand fragt nach: «Was ist mit Pantheismus gemeint?» —
«Dass alles Gott ist — pan, griechisch alles / theos — Gott, dass alles einfach Gott ist, einfach Gott.
Dass Gott in allem ist und dass alles in Gott ist, das nennt man übrigens auch: Pan-en-theismus:
Das ist mit der christlichen Überzeugung nicht nur vereinbar, sondern es wird eigentlich verlangt von unserem christlichen Glauben. Dass, wenn Gott spricht, dass das ja nicht eine Konversation ist, sondern, dass Gott sich selbst ausspricht, dass Gott das göttliche Wesen ausspricht:
‚Und Gott sprach und es ward Licht‘ (Gen 1,3).
Und seit dem, wenn immer jemand Licht sieht, sieht man Gott, — das von Gott, was eben zu sehen ist durch die Augen. Und wenn man etwas hört, so hört man Gott, das Meer und das Firmament und die Sterne und die Erde und alles ist Wort Gottes in der Bibel schon von der ersten Seite an, das heißt, in allem können wir Gott finden, und daher auch im Menschen dann: ‚Lass uns den Menschen schaffen nach unserem Ebenbild‘ (Gen 1,26).
Auch wenn wir einen Menschen sehen, sehen wir Gott in letzter Hinsicht, und wenn wir Gott nicht sehen, haben wir den Menschen noch nicht richtig gesehen, nicht mit dem Herzen haben wir den anderen Menschen gesehen.»