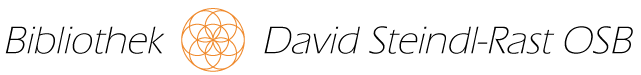Interview mit David Steindl-Rast OSB von Teresa Schaur-Wünsch
Sie sagen, dass Sie sich als Teil einer größeren, bewusstseinsverändernden Bewegung verstehen. Was meinen Sie damit?
Mir kommt vor, dass sich in unserer Zeit ein Bewusstseinswandel in der Menschheit und besonders in unserer Gesellschaft abspielt. Es geht darum, unsere Zusammenhänge immer mehr zu erkennen, unsere Vernetzungen. Das ist ungeheuer wichtig, weil wir mit schrecklichen Problemen konfrontiert sind, die wir nur gemeinsam lösen können. Unser jetziger Bewusstseinsstand ist noch nicht integriert genug, als dass wir wirklich gemeinsam handeln könnten.
Woran fehlt es denn?
Aus einer gewissen Perspektive könnte man sagen: Was wir heute brauchen, ist, dass die Machtpyramide, die Tausende Jahre zu unserer Kultur gehört hat, in ein Netzwerk verwandelt wird. Diese Machtpyramide ist an ihr Ende gekommen. Ich habe das Privileg, mit vielen führenden Menschen in der Wissenschaft zu sprechen, auch in der Politik. Jeder, der Einsicht hat, sagt auf seine oder ihre Weise: So geht's nicht weiter. Wir haben ein Ende erreicht. Einfach gesagt ist es so, dass wir auf dem Weg sind, uns selbst zu zerstören. Unsere Kultur und Gesellschaft und die Welt. Die, die oben an der Spitze stehen, fürchten, dass sie gestürzt werden, die, die weiter unten sind, fürchten, dass ihnen jemand zuvorkommt, da entsteht Rivalität. Unter einem Netzwerk verstehe ich nicht Gleichmacherei. Autorität wird es immer geben. Aber wir brauchen echte Autorität.
Sie selbst waren immer autoritätskritisch, in der NS-Zeit, später in Bezug auf die Kirche.
Um ein guter Christ zu sein, muss man kritisch sein. Wir sind als Propheten gesalbt, schon in der Taufe, und müssen diesen prophetischen Beruf dann auch wirklich ausüben. Propheten sind ja nicht Vorhersager, sondern Kritiker im Namen Gottes, Kritiker des Status quo.
Glauben Sie, dass es ein anderes politisches System braucht?
Sicher. Wir kennen das noch nicht, das muss sich erst entwickeln. Irgendwie sehe ich, dass kleine Gruppen zusammenarbeiten, wo jeder sich noch kennt, und dass die sich vernetzen. Dass man von unten hinauf arbeitet.
Generell schlagen Sie mehr Dankbarkeit vor, das mache auch glücklicher.
Wenn wir dankbar sind, werden wir automatisch glücklich. Es gibt leider viele Menschen, die alles haben, was man brauchen würde, und die doch nicht glücklich sind, weil sie nicht dankbar sind. Aber noch wichtiger ist Dankbarkeit deshalb, weil wir heutzutage eine Spiritualität brauchen, die alle verbindet. Es gibt viele ganz hervorragende Spiritualitäten, aber die sind alle irgendwie konfessionell gebunden oder uns kulturell sehr fremd, aber alle Menschen auf der Welt kennen Dankbarkeit. Dankbar leben ist auch eine wirkliche spirituelle Praxis, so wie Yoga oder Zazen. Das steht allen Menschen offen, das kann man auch in Schulen propagieren und das wird es auch. Wenn wir eine lebensfähige und kreative Gesellschaft wollen, brauchen wir eine spirituell praktizierende Gesellschaft, und Dankbarkeit praktizieren ist sehr leicht und allen zugänglich.
Ihre Formel dafür ist: Stop – look – go. Als würde man eine Straße überqueren.
Wir leben in einer so raschlebigen Gesellschaft, dass wir ständig abgelenkt werden von dem, was uns wichtig erscheint, und hineingezogen werden in einen Strom von Aktivitäten. Es geht darum, die Gelegenheit des Augenblickes zu erkennen und wahrzunehmen. Dazu muss man zunächst einmal innehalten. Und wenn man still wird, und das kann man üben und innerhalb einer Sekunde tun, dann kann man schauen: Was ist die Gelegenheit, die das Leben mir jetzt gerade gibt? Gegenseitige Aufmerksamkeit etwa. Und wenn man das sieht, muss man auch etwas daraus machen. Es genügt nicht innezuhalten. Ohne das «Go» wird nichts draus. Und das muss man schnell machen, sonst ist die Gelegenheit schon wieder vorüber. Aber wenn man sie versäumt, ist das Leben so großzügig, dass es uns im nächsten Augenblick wieder eine Gelegenheit gibt.
Warum tun sich viele leichter, fernöstliche Praxen anzunehmen als das, was das Christentum bietet?
Dafür sehe ich zwei Gründe. Einerseits hat das Neue einen gewissen Reiz. Andererseits hat leider unsere eigene christliche Tradition es sehr vernachlässigt, die Menschen mündig zu machen. Denn das macht ja eine spirituelle Praxis: mündig. Die Kirche als Institution hat leider alle die Fehler, die andere Institutionen haben – vor allem, dass sie nach kürzester Zeit nur noch an Selbsterhaltung interessiert sind. Da hat die institutionelle Kirche leider versäumt, den Menschen zu helfen, sie nicht mehr zu brauchen. James Fowler, ursprünglich in Harvard, hat übrigens die Stufenleiter des Glaubenslebens untersucht, so wie Piaget die sich entwickelnde Intelligenz oder Kohlberg die Entwicklung des moralischen Sinnes. Die letzte, reichste Stufe ist nicht die, wo jemand den religiösen Rahmen, in dem er aufgewachsen ist, zurücklässt, weil er alles bekommen hat, was er braucht und eine allgemeine Religiosität pflegt. Die reifste Stufe ist, dass man den eigenen Rahmen zwar nicht mehr braucht, aber ihn pflegt, weil es schön ist und mit anderen verbindet.
Sie sind in den Sechzigern offiziell in ein Zen-Kloster entsandt worden. Obwohl es im Buddhismus gar keinen Gottesbegriff gibt?
Ich habe sehr bald gesehen, dass sich die Buddhisten ebenso mit diesem großen Geheimnis auseinandersetzen müssen wie alle anderen Menschen, und halt das Wort Gott nicht verwenden. Und zwar weil man in ihrer Kultur nicht unterscheiden kann zwischen Gott und den Göttern. In Gesprächen mit meinem buddhistischen Lehrer habe ich das Wort Gott immer sehr höflich vermieden und zum Beispiel vom Urgrund des Seins gesprochen. Nach kurzer Zeit hat der Lehrer ganz ungeniert von Gott zu sprechen angefangen. Er wisse schon, was ich meine.
Die katholische Glaubenskongregation hat eine Gleichwertigkeit der Zugänge zurückgewiesen. Bekamen Sie Schwierigkeiten?
Ich persönlich habe unglaublich wenig Schwierigkeiten gehabt. Weil ich mich wirklich bemühe, die christliche Lehre und das christliche Leben authentisch darzustellen. Es bleibt immer eine Bemühung. Aber zugleich bemühe ich mich auch, es in einer zeitgenössischen Sprache auszudrücken und als wacher Mensch im 21. Jahrhundert zu leben. Und da gibt es vieles, wo die traditionelle Kirche noch aufholen muss.
Was raten Sie im Umgang mit dem Islam?
Ich kann mich gut einfühlen in das Bewusstsein eines gläubigen Muslimen, in dessen Perspektive unsere westliche Zivilisation völlig gottlos ausschauen muss. Leider wird dieser Unterschied politisch missbraucht. Aber wenn wir das ehrlich anschauen, müssten wir sagen, wir können viel lernen von den wahrhaft religiösen Muslimen.
Schwierig ist, dass im Islam Religion und Tradition stark verwoben sind, worunter die Gleichberechtigung leidet.
Vereinfacht kann man sagen, dass für den Islam die Aufklärung noch nicht stattgefunden hat. Aber man kann hoffen, dass sich die Muslime an uns ein Beispiel nehmen. Oder auch ein abschreckendes Beispiel, und dass die Aufklärung, die im Islam schon ansteht, das verwirklicht, was auch unsere am Anfang wollte: Dass man religiöse Rückständigkeit, Verhärtung und Enge überwindet, aber religiös bleibt.
Sie haben Kunst, Psychologie und Anthropologie studiert. Wollten Sie sich von verschiedenen Seiten dem Menschsein nähern?
Ich erinnere mich, mit 18, 19, als andere schon klar gewusst haben, was sie werden wollen, habe ich noch keine Ahnung gehabt. Da habe ich mir das so zurechtgelegt: Je breiter man die Basis macht, umso höher wird die Pyramide. Ich versuche heute noch täglich, mich mit den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen bekannt zu machen.
Was lesen Sie denn gerade?
Jetzt bin ich gerade fertig geworden mit einem Buch, das mich sehr herausgefordert hat, von Evan Thompson: «Mind in Life». Eine dicke Studie über Phänomenologie in Verbindung mit der neuesten Neurowissenschaft. Das hat mich sehr begeistert. Besonders Spaß hat mir gemacht, dass ich Thompson schon als Kind gekannt habe.
Haben Sie Pläne für die nächsten Jahre?
In meinem Alter kann man nur für diesen Tag einen Plan haben. Aber ich hoffe, ich kann ausreifen.
Glauben Sie, dass Sie das noch nicht sind?
Nein, das sagt mir das Leben. Dass ich noch eine Gelegenheit bekomme heißt: Du hast noch was zu lernen. Jeden Tag.
Herr Steindl-Rast, darf man Sie auch fragen, . . .
1. . . was das Schwierigste war, was Sie je lernen mussten?
Vertrauen. Ich habe leider eine schwere Geburt gehabt, hat mir meine Mutter erzählt. Es hat lang gedauert, und ich bin mit der rechten Hand zuerst auf die Welt gekommen. Und ich fühle das immer noch, Enge und Höhlen sind mir nicht sehr sympathisch. Wenn das Leben eng und bedrängend wird, sich darauf zu verlassen, dass es nur Geburtswehen sind und man auf der anderen Seite neugeboren herauskommt, das ist die Herausforderung.
2. . . was Sie vom Jenseits erwarten?
Ich versuche, mich zu hüten, zu klare Vorstellungen zu haben. Aber was ich doch erwarte, ist, dass dann das Bleibende mein Zuhause wird. Aber wissen tun wir nix, und je offener wir das zugeben, umso besser.
3. . . was es mit Ihren Augenbrauen auf sich hat? Die darf ja nur der Dalai-Lama zwirbeln.
(lacht) Die wachsen einfach. Das ist mein Markenzeichen.
Quelle: Die Presse, Print-Ausgabe, 17.03.2019