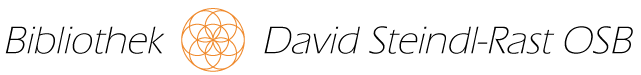Interview mit David Steindl-Rast OSB geführt von Stefan Seidel im Januar 2021, veröffentlicht im September 2022

Die Bedeutung David Steindl-Rasts (geboren 1926) für die Gegenwart liegt wohl darin, dass er dazu befähigt ist, den Kern der Religiosität in einer Weise in diese Zeit hinein zu übersetzen, dass sie wieder zugänglich wird für Menschen, die den traditionellen Zugängen zur Religion entfremdet sind. Wie kaum ein zweiter Theologe, Kirchen- oder Ordensmann dieser Tage findet der österreichisch-amerikanische Benediktinermönch David Steindl-Rast eine weltweite Resonanz und ist insbesondere über Internetkanäle zu einem gefragten Lehrer für Wege des Sich-Rückverbindens mit «Gott» geworden. Dabei verkündet er nicht Dogmen und Formeln und besteht nicht auf theologischen Richtigkeiten, sondern ist mit seinen Impulsen ganz nah an den Lebenserfahrungen vieler Menschen und macht diese durchscheinend für größere, spirituelle Zusammenhänge. Weltweite Bekanntheit hat Steindl-Rat erlangt, als er im Jahr 2000 - im fortgeschrittenen Alter von über 70 Jahren – ein Internetnetzwerk für dankbares Leben gegründet hat (www.gratefulness.org). Darin erschließt er die Dankbarkeit als unmittelbare und lebenspraktische Form der Spiritualität, des gelebten Bezogenseins auf das göttliche Geheimnis − die bewusste Dankbarkeit für das, was einem tagtäglich vom Leben geschenkt wird, das Staunen über so viel Gnadenhaftes, so viel Nicht-Selbstverständliches, so viel Schönes und Gutes, aber auch die darin enthaltene Fähigkeit zum Annehmen und Durchtragen des Schweren im Vertrauen auf Überwindungskräfte und das verwandelte Neue, das kommt. Mit dieser «einfachen» Weise, das Leben nicht einfach nur zu leben, sondern es mit Bewusstheit und tieferen Verbindungskräften zu durchweben, hat er unzählige Menschen inspiriert und zu einem bewussteren, getrosteren und erfüllteren Leben geführt. Über die Dankbarkeit als eine Art Schlüssel für eine Mystik der Gegenwart schreibt er in seiner Autobiografie «Ich bin durch Dich so ich» (2016): «Dankbarkeit steht der Liebe sehr nahe, denn die Liebe ist das Ja zur Zugehörigkeit, und Dankbarkeit ist das Immer-wieder-Ja-Sagen zum Leben. Es geht da um ein freudiges, feierndes Ja-Sagen.» So schafft er auf ganz «niedrigschwellige» Art einen Weg, die engen Grenzen des Ichs zu übersteigen und zu einem umfassenderen Existieren in Verbundenheit zu gelangen, das für ihn das wesentliche Kennzeichen religiösen Lebens ist. So definiert er Religion als «ein Wiederverbinden von gebrochenen Beziehungen» − «die Beziehung zwischen uns und unserem wahren Selbst, zwischen uns und allen anderen, zwischen uns und dem Großen Geheimnis». Diese Beziehungshaftigkeit macht ihm zufolge das Wesen des Lebens aus, das auf Vernetzung angelegt ist und gleichzeitig ins Offene weist, auf ein «Mehr», auf eine umfassendere Kraft. Aus seiner Sicht zwingen die unvermeidlichen Grunderfahrungen jeden Lebens dazu, sich zum Geheimnishaften des Lebens zu verhalten: «Die Geburt eines Kindes, der Tod der Eltern, Freunde, Verwandten, das eigene Sterben − das alles sind Ereignisse, die zutiefst religiös sind, weil sie uns unumgänglich mit dem Geheimnis des Lebens konfrontieren und zu einer Auseinandersetzung zwingen.» Bewusst mit diesen Erfahrungen umzugehen − in Dankbarkeit, in Demut, im Lieben, im Vertrauen, im Verantwortung übernehmen, im Verbundensein − heißt für David Steindl-Rast, sich letztlich «religiös» zu beziehen auf das umfassende Geheimnis, das große Ganze, das geheilte Eine und zu versuchen, mitten im Geheimnis zu leben. Dies war für ihn auch der entscheidende Impuls, Mönch zu werden: die Gespaltenheiten zu überwinden und sich auf das große Geeinte, auf das Eine, das in, mit und unter allem ist, vollumfänglich zu beziehen und darin zu leben, in Gott. Dazu schreibt er: «Heilsein heißt, in sich ein sein, und im Wort monachos (Mönch) steckt monos, was nicht nur ‚allein’ bedeutet, sondern auch auf das Einssein der Gemeinschaft hinweist und auf das All-eins-Sein Kraft der einen ewigen Mitte.» Und auf alle Menschen bezogen heißt das für Steindl-Rast: «Mir scheint, letztlich kommt es darauf an, sich vom Geheimnis ergreifen zu lassen. (...) Ergriffenheit vom Großen Ganzen ist das Erlebnis grenzenloser Zugehörigkeit.»
Steindl-Rast sieht die Mystik der Gegenwart verwirklicht in einer «Spiritualität der Netzwerke»: dass man die Vorstellung «von einem isolierten und abgetrennten, abgesonderten und daher, ‚sündigen’ Ich, vom Ego» überwindet und in ein «Ich-Selbst» hineinfindet, das sich mit allen anderen verbunden weiß und jedem Leben in all seinen Formen tiefe Achtung und Ehrfurcht entgegenbringt. Und so stellt sich für ihn auch die Bezogenheit auf das göttliche Ganze dar − nicht als etwas, das abgetrennt im Transzendenten liegt, sondern als eine große Kraft der Verbundenheit, die auch über Raum und Zeit hinaus da ist. Es sei ihm zur tiefen Erkenntnis geworden, schreibt er, dass er «nicht in einem Nebeneinander von Zeit und Ewigkeit lebe, sondern in ihrem Ineinander, in der dynamischen Spannung des einen Doppelbereichs. (...) Er ist ungeteilt und unteilbar eins.»
So will David Steindl-Rast auch der letzten Enge des Lebens, dem Sterben, vertrauensvoll entgegengehen, in dem Bewusstsein und der Erfahrung, schon jetzt teilhaftig der größeren Wirklichkeit des All-Einen zu sein. «Ich erlebe schon mitten in Raum und Zeit − in der Erfahrung des Jetzt − eine Dimension, die über Raum und Zeit hinausgeht, und die unterliegt dem Tod nicht. (...) Hier und jetzt bringen mich meine Sinne und mein Denken an die Grenze von etwas, das über Zeit und Raum hinausgeht, das nicht gebunden ist durch Zeit und Raum. Und dieser Dimension meines Daseins − dem Bleibenden − gehöre ich genauso an, wie ich Zeit und Raum angehöre. Das ist eben der Doppelbereich, in dem ich lebe. Diese Erfahrung gibt mir Vertrauen und Zuversicht auf etwas Bleibendes, auch wenn meine körperliche Wirklichkeit endet. Schon jetzt berühre ich eine bleibende Wirklichkeit.» Und weiter: «Wenn unser Ich in Raum und Zeit vergeht, bleibt noch unsere Beziehung zum Ur-Du. Die war und ist das grundlegend Erste, aus dem alles entspringt, und wird das Letzte sein, was übrig bleibt.» Dies ist der tiefste mystische Gedanke, den Steindl-Rast mitteilt und der vermutlich auf eine frühe Kindheitserfahrung zurückgeht, die ihn zeitlebens prägte und führte: «In diese Zeit, also etwa in mein viertes oder fünftes Lebensjahr, fällt auch ein Traumbild, das mir − ohne dass ich es damals ahnte − grundlegend werden sollte für mein Lebensgefühl: Ich gehe die steinerne Wendeltreppe vom ‚alten Stock’ hinunter. Auf halber Höhe begegnet mir Jesus Christus, der von unten heraufkommt. Er sieht so aus wie auf dem Bild, das über dem Bett meiner Großmutter hängt. Wir bewegen uns aufeinander zu, aber antstatt aneinander vorbeizugehen, verschmelzen wir miteinaner.»
Herr Steindl-Rast, können Sie sich noch daran erinnern, wann und wie Ihr Gottesglaube begann? Ist das rückblickend für Sie möglich zu beschreiben, wann und wie der Glaube zu einer entscheidenden Bezugsgröße in Ihrem Leben wurde?
In meinem Elternhaus war Gott für mich als Kind ebenso selbstverständlich gegenwärtig wie meine Eltern und Brüder, unsre Haustiere und was es sonst noch gab. Gott war unsichtbar, aber seine Gegenwart war wichtiger als die alles Sichtbaren, weil er alles erschaffen hatte, sich liebend um alles kümmerte und uns allen vorschrieb, was man tun sollte und was man nicht tun durfte. Daher tauchte die Frage ob es Gott gebe überhaupt nicht auf. Sonntagsmesse, Morgen- und Abendgebet, Tischgebete vor und nach den Mahlzeiten und Gebete, die meine Großmutter mich lehrte, hielten mein Bewusstsein von Gottes Gegenwart wach und stärkten mein Gottvertrauen.
So war also die Wirklichkeit Gottes durch ihre Wirkung von Anfang an fraglos gegeben und mein Glaube bestand – wie noch heute – in Gottvertrauen und liebender Beziehung zu Gott.
Sie haben als junger Mensch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Inwiefern haben die Erlebnisse aus dieser Zeit Sie geprägt? Und welchen Einfluss hatten sie auf Ihre Gottessuche und Ihren Glauben?
1938, beim «Umbruch», war ich zwölf. Zwei Jahre im Internat der Neulandschule hatten mich mit Begeisterung das Beste der «christlichen Jugendbewegung» erleben lassen, und es fiel mir nicht schwer, die Hitlerjugend als Verfälschung unsrer Ideale zu durchschauen. Unsre Lehrer aus dem Bund Neuland wurden sofort durch Nazis ersetzt, die Feindseligkeit des Staates gegen die Kirche wurde immer offensichtlicher, und deshalb mussten meine Freunde und ich hinsichtlich all dessen, was uns das Wichtigste war, «untertauchen». Wir identifizierten uns vollkommen mit unsrem Glauben. Für uns als Jugendliche machte die damit verbundene Gefahr das alles nur umso spannender. Wir trafen uns im Geheimen, sangen geheim unsre Lieder und gingen auf Fahrt in abgelegene Gebiete, wie es damals der Böhmerwald war. Die Triebkraft unsrer Lebensbejahung und Lebensfreude war unser Glaube. Wir bildeten eine geheime Runde um Pater Arnold Dolezal, später Domprobst in der Wiener Neustadt, der unsre Glaubensfragen ernst nahm und uns half, uns aufrichtig über unsre Überzeugungen Rechenschaft zu geben. Diese Haltung beizubehalten, wurde mir zur Lebensaufgabe.
Was hat Sie dazu bewogen, in einen Mönchsorden einzutreten? In gewisser Weise ist dieser Schritt ein sehr radikaler, der im Gegensatz zu gängigen Lebensentwürfen steht. Viele verbinden damit vor allem den Verzicht auf vieles, was gemeinhin als wichtig angesehen wird – wie Familie und Eigentum, zum Beispiel. Haben auch Sie diesen Schritt als Verzicht gesehen, war es ein schmerzhafter Preis, den Sie dafür gezahlt haben? Oder wurden Sie in einer anderen Weise erfüllt?
Meine Großmutter lebte schon seit Jahrzehnten in den USA, weil sie dort für ein von ihr in Österreich gegründetes Kinderhilfswerk Spenden sammelte. Sie ermöglichte es gleich nach Kriegsende meinen beiden Brüdern drüben zu studieren. Ich selber aber hatte mein Studium schon in Wien begonnen, wollte es hier zum Abschluss bringen und folgte erst nach meinem Doktorat in Psychologie 1952 der Familie in die Vereinigten Staaten. Während meines Studiums war Stift Heiligenkreuz mein geistliches Zuhause, wo ich durch Pater Walter Schücker den Geist des Hl. Benedikt kennen und lieben lernte. Schon damals fühlte ich mich vom benediktinischen Mönchsleben tief angezogen, mir schien aber, dass die großen Klöster sich im Laufe ihrer langen Geschichte weit entfernt hatten vom ursprünglichen Ideal des Hl. Benedikt, wie ich es aus dem Regelkommentar des großen Abtes von Maria Laach, Ildefons Herwegen (1874-1946), kannte.
In den USA jedoch erlebte ich zunächst einen argen Kulturschock, entdeckte aber bald das von P. Damasus Wizen, einem Mönch aus Maria Laach neugegründete Reformkloster Mount Saviour im Staat New York. Bei meinem ersten Besuch, der weniger als 24 Stunden dauerte, wurde mir sofort bewusst, dass ich in diese Gemeinschaft eintreten wollte. Das ist jetzt schon 67 Jahre her, und ich habe diesen Entschluss niemals bereut. Jede Wahl ist zugleich Verzicht auf das Nicht-Gewählte, aber ich habe das gewählte Mönchsleben so erfüllend gefunden, dass Verzicht mir kaum bewusst wurde.
Sie lebten auch viele Jahre als Eremit. Was hat Sie in die Einsamkeit gezogen und warum ist Ihnen diese Art des Lebens wichtig geworden?
Die für einen Benediktinermönch recht ungewöhnliche Form meines Lebenslaufes und besonders die weiten Vortragsreisen verlangten nach einem Gegengewicht in der Einsiedelei, um das innere Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Das erkannte auch mein Abt und verhalf mir dazu.
Wir alle verbringen unsre Zeit teils gemeinsam, teils allein; wieviel Alleinsein wir brauchen, ist Veranlagungssache. Mir gab beides Grund für Dankbarkeit, das Geschenk von Gemeinschaft und das Geschenk allein sein zu dürfen. Beides bringt Schwierigkeiten, beides bringt Freuden. Die große Freude beim Alleinsein ist für mich die Gelegenheit, in tiefe Stille einzutauchen.
Wie hat sich Ihr zunächst sehr christlich geprägter Glaube weiterentwickelt? Heute vertreten Sie eine Anschauung, nach der es nicht möglich ist, den einen und einzigen «Heilsweg» zu bestimmen. Was hat Sie zu dieser Weite geführt und wie fügt sich dahinein Ihre Verbundenheit mit dem christlichen Glauben?
Mir wurden ungewöhnliche Gelegenheiten geschenkt, andre spirituelle Traditionen aus nächster Nähe kennenzulernen, besonders den Zen Buddhismus. Das gab meinem christlichen Glauben Anstoß, allumfassend, also im Vollsinn des Wortes «katholisch» zu werden. Ich sehe jetzt, dass die verschiedenen Religionen – meine eigene eingeschlossen – wie verschiedene Brunnen aus ein und demselben Grundwasser menschlicher Religiosität schöpfen. Diese Religiosität ist die uns als Menschen angeborene Beziehung zu dem großen Geheimnis, das wir Gott nennen. Ein solcher Brunnen, wie unsere christliche Tradition einer ist, stellt ein unermessliches Geschenk dar. «Geh nicht von einem zum andern», warnt Swami Satchidananda; «wenn du einen gefunden hast, grab‘ immer tiefer». Das habe auch ich mir zu Herzen genommen. Es erweitert den Horizont und ist für das dringend notwendige gegenseitige Verständnis ungemein wichtig, andre Religionen kennenzulernen; es ist aber auch wichtig zu wissen, wo wir zuhause sind.
Welche prägenden Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen gab es, die Einfluss auf Ihren weiteren Glaubensweg hatten?
Mein wichtigster christlicher Lehrer war wohl Karl Rahner, durch seine streng vor der Tradition verantwortliche und doch schöpferische Theologie. Martin Buber und Ferdinand Ebner haben mich durch ihre Betonung der Ich-Du-Beziehung stark beeinflusst. Auch dem großen amerikanischen Psychologen Abraham Maslow verdanke ich wichtige Einsichten, vor allem aber dem dichterischen Werk Rainer Maria Rilkes. Mir scheint, dass diese Lehrer mich durch ihre Schriften stärker beeinflussten, als alle, die ich persönlich kennenlernen durfte, mit Ausnahme von Raimundo Panikkar dem Religionsphilosophen und ökumenischen Theologen, der mir ein halbes Jahrhundert lang Lehrer und Freund war.
Das Schicksal hat mir so viele Begegnungen mit wegweisenden Menschen geschenkt, dass es mir schwerfällt die Wichtigsten hervorzuheben; jedenfalls gehören dazu der Dalai Lama, P. Thomas Keating, Thor Heyerdahl, Fritjof Capra, Rupert Sheldrake, Dorothy Day, Cynthia Bourgeault, Pema Chödrön, Kumar Satish, Fritz Schumacher, Joan Baez und Ken Wilber. Auch als Mitglied der Lindisfarne Fellowship und als Referent bei den Cortona Wochen in der Toscana und den Waldzell Meetings im Stift Melk wurden mir ungemein viele bereichernde Begegnungen zuteil.
Heute sind Sie weltbekannt für Ihr eindrückliches Eintreten für die Dankbarkeit. Gab es hierfür eine Art Schlüsselerlebnis? Wann und wie ist Ihnen diese besondere Kraft und Dimension der Dankbarkeit aufgegangen?
Beim Nachdenken über unsre benediktinische Spiritualität wurde mir nach und nach klar, dass sie im Begriff «dankbar leben» zusammengefasst werden kann. Mein erstes Buch, «Dankbarkeit, das Herz allen Betens», erschien 1982 in Englisch und fiel auf so fruchtbaren Boden, dass es seither in viele Sprachen übersetzt und unter verschiedenen Titeln gedruckt wurde und heute nach fast 40 Jahren mehr gelesen wird denn je. Es hat sich nämlich gezeigt, dass für viele Menschen Dankbarkeit eine recht einfache Form der Spiritualität ist, die sich im Alltag bewährt und als wirkungsvoll erweist. Das Buch hat mitgeholfen ein anschwellendes Interesse an Dankbarkeit auszulösen, das heute fast schon zum Trend geworden ist. Sogar ernstzunehmende wissenschaftliche Studien konnten den positiven Einfluss von Dankbarkeit auf viele Lebensbereiche nachweisen. Darüber staune ich selber und freue mich.
Gerade haben viele ein schweres Jahr 2020 verlebt, mit vielen Zumutungen und Einschränkungen und zum Teil auch schweren Krankheitsverläufen und Verlusten. Man wagt kaum, auch in dieser Situation von Dankbarkeit zu sprechen. Aber können Sie dazu ein paar Worte sagen, wie auch angesichts von Schwerem der Dankbarkeit Raum gegeben werden könnte?
Es gibt vieles wofür man nicht dankbar sein kann. Und doch kann man in jedem Augenblick dankbar sein. Auch wenn das Leben uns etwas Widerwärtiges auftischt, schenkt es uns zugleich die Gelegenheit es zu nutzen – die Gelegenheit etwa, die ungute Lage zu verbessern, aus der Erfahrung zu lernen, daran zu wachsen, oder sich gegen Unrecht zur Wehr zu setzen. Für diese Gelegenheiten können wir dankbar sein. Dankbarkeit aber ist der Schlüssel zur Freude, der in unsren eigenen Händen liegt. Auch Glück schenkt uns nur dann Freude, wenn wir dafür dankbar sind; mitten im Unglück aber macht Dankbarsein uns freudig. Freude ist das Glück, das nicht davon abhängt, ob uns etwas glückt oder nicht; sie ist das bleibende Glück, das unser Herz ersehnt.
Haben Sie Angst vor dem Tod? Und: Welche Hoffnung haben Sie über den Tod hinaus?
Wer dem Leben vertraut, braucht vor dem Tod keine Angst zu haben, denn Leben und Sterben gehören untrennbar zusammen. Nur vor dem physischen und psychischen Zusammenbruch, der oft dem Tod vorausgeht, habe ich Angst. Das gibt mir aber Gelegenheit, mein Lebensvertrauen zu stärken. Bisher hat das Leben stets besser gewusst als ich selbst, was gut für mich war; das wird wohl so bleiben. Und dem Leben vertrauen, heißt Gott vertrauen, der uns in allem, was wir erleben, begegnet. Lebensvertrauen ist Gottvertrauen. Wir können vieles erleben, das über unser vergängliches Leben hinausgeht: etwa selbstlose Liebe, Vertrauen und die Lebendigkeit selbst. Darauf verlasse ich mich, auch wenn ich mir ein Leben jenseits des Todes so wenig vorstellen kann, wie eine Raupe ihr Leben als Schmetterling in einer Blumenwiese.
Quelle: Interview aus dem Buch Grenzgänge - Gespräche über das Gottsuchen